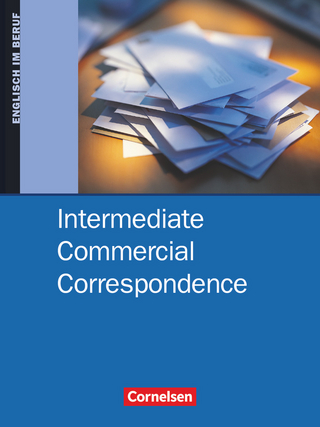Born in the GDR – angekommen in Deutschland
Bussert u. Stadeler (Verlag)
978-3-942115-50-6 (ISBN)
Einleitende Worte7
Vorwort · Klaus Dörre9
Rhony Bajohr13
Ralf Uwe Beck23
Tely Büchner33
Heike Buslowski47
Alexa Dreesmann59
Willy Dünnbier73
Uwe Dziuballa87
Cornelia Ernst101
Kristin von Faber-Castell111
Klaus Fritsche125
Bernd Fuckel135
Heiko Gessert143
Peter Hanss157
Jost Heyder165
Heike Janetzko175
Barbara Kirstein185
Bernd Klinkhardt 201
Eike Küstner209
Christine Lieberknecht217
Georg Lohr 229
Anne Kathrein Maschke243
Udo Mauersberger253
Doris Müller265
Uwe Müller273
Ludwig Schumann285
Renate Stahn 299
Uwe Steimle309
Volkmar Wirth-Kresse325
Thomas Wischnewski339
Wolfgang Zeyen351
»Bottroper Protokolle – Gespräche aus dem Ruhrgebiet«, so nannte sich eine später in Buchform veröffentlichte WDR-Reportage der Filmemacherin und Autorin Erika Runge. Darin kamen Menschen aus dem kriselnden Kohlebergbau zu Wort. Sie sprachen über ihre Arbeit, ihr Leben, über Frauenbilder, Sex und Musik und nicht zuletzt über ihre Sicht auf die Stadt Bottrop. Ohne es selbst darauf angelegt zu haben, entdeckte Erika Runge etwas, das es angeblich nicht mehr gab – Arbeiter in der westdeutschen Klassengesellschaft. Gut 50 Jahre nach dem Erscheinen der Bottroper Protokolle liegt wiederum ein Buch vor, das Lebensgeschichten erzählt. Wiederum geht es um eine Gesellschaft, die es angeblich nicht mehr gibt. Diesmal sind es jedoch nicht die Arbeiter im Kohlerevier, von denen die Protokolle handeln. Nun sind es die »Ostdeutschen«, die in exemplarischen Erzählungen zum Thema werden. Deutschland Ost und Deutschland West – sind das, 30 Jahre nach der Maueröffnung, noch immer verschiedene Gesellschaften? Liest man die biographischen Schilderungen, die von der Autorin Uta Heyder feinfühlig verdichtet wurden, ist die Antwort ein klares »Ja, aber«. Ja lautet die Antwort allerdings nicht deshalb, weil das dokumentierte Material gängige Klischees über die Ostdeutschen bestätigen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Wer sich als Leserin oder Leser in die biographischen Erzählungen vertieft, wird von der Fülle des Materials geradezu erschlagen. Die Ostdeutschen – selbiges begründet das dem »Ja« hinzugefügte »aber« – gibt es eben nicht! Sicher, Mauerfall und Systemwechsel sind prägende Erfahrungen, die teilt, wer in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Es handelte sich um Ereignisse, die im Osten, wohl stärker als im Westen, eine politische Generation hervorgebracht haben. Politische Generationen entstehen, wie der Soziologe Karl Mannheim herausgearbeitet hat, aufgrund einer gemeinsamen zeithistorischen Lagerung im sozialen Raum. Sie werden durch Schlüsselereignisse geprägt, was keineswegs ausschließt, dass sich einzelne Generationseinheiten sozial, politisch und kulturell aufs Heftigste bekämpfen. Verbundenheit in ständigen Auseinandersetzungen – das ist ein gemeinsames Merkmal der (Nach-)Wendegeneration mit eigener DDR-Erfahrung. Wie die dokumentierten Lebensgeschichten belegen, wurde der gemeinsam erlebte Systemumbruch individuell jedoch höchst unterschiedlich verarbeitet. Er mündete in biographische Auf- und Abstiege, öffnete Chancen für die einen, drängte andere jedoch an den Rand der Gesellschaft und unter die Schwelle sozialer Respektabilität. Die »Erfurter Protokolle« (gemeint sind die im Buch veröffentlichten, redigierten Gesprächsprotokolle aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) decken dementsprechend eine große Bandbreite an Erfahrungen, Verarbeitungsformen und individuellen Weltsichten ab. Da steht der ehemalige Arbeiter, der nach zahlreichen biografischen Stationen im Hartz-IV-Bezug landet, neben der erfolgreichen Betreiberin einer Model-Agentur, die sich beruflich bis zum Burnout verausgabt hat. Der Migrationskritiker mit Sympathie für manche inhaltlichen Positionen der AfD trifft auf die in der globalisierungskritischen Bewegung engagierte Attac-Aktivistin. Freude über neu gewonnene Freiheiten mischt sich mit der noch immer nicht überwundenen Enttäuschung, dass für einen dritten Weg zwischen DDR-Sozialismus und BRD-Kapitalismus kein Experimentierspielraum blieb. Und das Bewusstsein, ein Regime zum Einsturz gebracht zu haben, das fest im Sattel zu sitzen schien, mischt sich mit Ohnmachtserfahrungen und Sorge um die Zukunft der Gesellschaft und des Planeten. Trotz aller Unterschiedlichkeit findet sich in den Biografien doch so etwas wie eine gemeinsame Tiefengeschichte. Als Tiefengeschichte, deep story, bezeichnet die US-amerikanische Soziologin Arlie Hochschild eine Erzählung, die sich für viele Menschen wie die eigentliche Wahrheit anfühlt. Es wäre sicher möglich, eine solche deep story für Ostdeutsche aus den »Erfurter Protokollen« herauszulesen. Wie die Menschen im tiefen Süden der USA haben sich die Ostdeutschen in eine Warteschlange eingereiht, die am Fuße eines Berges auf Gerechtigkeit durch Aufstieg wartet. Doch in der Schlange geht es nicht vorwärts. Im Gegenteil, immer wieder machen sich soziale Mechanismen bemerkbar, die den Aufstieg blockieren oder die zum Abstieg zwingen. Mit anderen Worten: Viele Angehörige der Nachwendegeneration sehen sich zu erheblichen Teilen nicht nur materiell benachteiligt, sondern zusätzlich auch kulturell stigmatisiert. So heterogen die sozialen Positionen auch sein mögen – Abwertungserfahrungen machen all jene, die sie teilen, tendenziell gleich. Wer in der »arbeiterlichen Gesellschaft« (Wolfgang Engler) der DDR heranwuchs, betrachtet sich in der Gegenwart häufig als Objekt einer doppelten Abwertung. Arbeiter, vor allem aber Handwerker waren in der DDR »Könige«, heute zählen sie nichts mehr: »Ich mache meine Arbeit nach wie vor ordentlich und wenn ich jetzt behandelt werde wie der letzte Dreck, na ja. Wir haben gemerkt, wir sind kein Arbeiter- und Bauernstaat mehr. Wir sind Dienstleister und diejenigen, die die Werte schaffen und der Geldgeber, der die Sachen bezahlt, der sagt, wo es langgeht und wie es läuft. Und das war ein ganz schöner Einschnitt. Da hatte ich mächtig dran zu kauen«, erklärt der ausgebildete Installateur Willy Dünnbier im Interview und beschreibt damit treffend eine Grunderfahrung sozialer Abwertung, die sich mit einer zweiten Abwertung verbindet: In ihrem Selbstverständnis sind viele Ostdeutsche Meister der Improvisation. Sie wissen auch bei widrigsten Verhältnissen zu überleben. Sie sind von Natur aus Kämpfer, unter ihnen gibt es Zusammenhalt und schon einmal haben sie bewiesen, zu einer demokratischen Revolution fähig zu sein. Aus der Westperspektive stellt sich das häufig völlig anders dar. Ostdeutsche gelten in der Fremdwahrnehmung als nichtautoritär geprägte Persönlichkeiten, die zur Demokratie erst erzogen werden müssen. Dass mit ungleichen Maßstäben gemessen wird, ist eine Wahrnehmung, die zumindest einen Teil der Ostdeutschen ungeachtet sonstiger sozialer Unterschiede noch immer in einer kollektiven Schicksalsgemeinschaft verbindet. Gleich wo man sich sozial verortet, bei Lohn, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, vor allem aber bei Anerkennung und Wertschätzung ist man noch immer nicht auf dem versprochenen Westniveau angelangt. Wer selbst immer wieder zum Objekt sozialer Abwertung wird, tendiert dazu, Selbstaufwertung mittels Abwertung anderer zu betreiben. Das Ressentiment, die Abwehr von Fremden und Unbekanntem kann dann leicht zum Mittel werden, um sich in der gesellschaftlichen Anerkennungspyramide zu behaupten. Das trifft auch auf Ostdeutsche zu, die mit der radikalen Rechten eigentlich nichts zu tun haben möchten: »Mit der AfD habe ich nicht viel am Hut, weil sich da sehr viele Nazis drin tummeln. Und das Schlimme ist auch: Es gibt viele Argumente, die die AfD bringt, die ich teilen kann, wo ich sage, da haben sie recht. Die sprechen das mal aus, was viele hinter der Gardine denken. Ich werde diese Flüchtlingsentwicklung nicht stoppen können. Aber ich habe Angst, in G. abends über die Straße zu gehen. Da sehen Sie natürlich die Ausländer, wie sie sich in unserem Land benehmen. Laufen Sie mal auch am Tage über die Eisenbahnbrücke in G., da kommen Ihnen Gruppen entgegen, die sich völlig hemmungslos in arabischer Sprache unterhalten. Und zwar lautstark. Wenn ich im Ausland bin, dann bin ich etwas zurückhaltend. Keiner weiß, worüber die reden. Keiner weiß, was die in ihren Moscheen über den Koran für Schulungen bekommen. Die Medien haben auch einen großen Anteil, es wird ja jeden Tag darüber berichtet. Gestern war wieder eine Messerstecherei, ein Überfall, eine Begrabschung einer deutschen Frau. Und immer wird gesagt, es war ein Libanese oder ein Syrer. Ein Deutscher kommt da kaum vor. Es ist hier eine Entwicklung losgetreten worden, die nicht mehr steuerbar ist und die Folgen sind noch gar nicht absehbar, aber sie sind nicht gerade beruhigend. Und manchmal denke ich mir, ob das jetzt die Umwelt betrifft oder die Weltpolitik: Vielleicht ist es ganz gut, dass ich keine Kinder habe. Denn die nächste und die übernächste Generation wird es sein, die das ausbaden muss, was wir angerichtet haben.« (Willy Dünnbier) Es ist nicht zuletzt der erlebte Verlust intakter Sozialbeziehungen, aus dem sich das Ressentiment gegen Fremde speist. Der Verlust intakter Sozialbeziehungen wird aber auch von jenen beklagt, die den individuellen Aufstieg geschafft haben und sich weltoffen geben. Selbst die erfolgreiche Unternehmerin, die froh ist, den Stasi-Staat überwunden zu haben, trauert der verloren gegangenen Alltagssolidarität, die sie aus DDR-Zeiten kannte, nach: »Ich habe damals sehr genossen, dass die Menschen sozialer und freundlicher miteinander umgegangen sind. Die Hausgemeinschaften, die Nachbarn, alle sind solidarischer miteinander umgegangen. Ja. Es gab viele, viele nette Kontakte. Man hat sich geholfen, man hat zusammen gefeiert. Man hat aufeinander aufgepasst ein Stück weit. Da entdecke ich doch jetzt nach 30 Jahren Wende, dass die Gesellschaft kälter geworden ist oder wie ich es vorhin auch schon mal sagte: Der Mensch egoistischer geworden ist. Dennoch bin ich froh, dieses andere System zu erleben, weil es eben auch die großen Chancen bietet, Dinge zu verwirklichen, Träume zu erleben, die wir so vorher nicht hatten. Reisefreiheit: Die Welt sehen war für mich zentral und entscheidend. Und deswegen habe ich auch mit daraufhin gearbeitet und daraufhin gehofft, dass die Grenzen sich öffnen und das habe ich in den letzten 30 Jahren auch genossen, die Welt zu sehen und meinen Koffer zu packen und einfach Wünsche zu äußern und diese, wenn machbar, mir zu erfüllen.« (Kristin Gräfin von Faber Castell) Allerdings, auch das machen die Protokolle deutlich, war auch die DDR keine homogene, gleichgeschaltete Gesellschaft. Es gab durchaus Nischen und wer Mut hat, fand, wie der ausgebildete Koch Ludwig Schumann, durchaus Gelegenheit zu alltäglichem Prostest und Widerständigkeit: »In die Zeit meiner Lehre fiel der Besuch Willy Brandts und Willi Stophs in Erfurt. Nein, für die beiden Willys durften wir nicht kochen. […] Wir hatten als Lehrlinge den großen Spaß, dass wir unseren Chef das erste Mal Kartoffeln und Möhren schälen sahen, also die Arbeit tun, die bei normalem Tagesablauf unsere war. In Erwartung der beiden Staatsmänner öffneten wir die im Souterrain liegenden Küchenfenster, um die Ankunft Willy Brandts nicht zu verpassen. Doch stand die Staatssicherheit unmittelbar vor den Fenstern und befahl, die Fenster zu schließen. Dafür fühlte sich von uns keiner verantwortlich, so dass sie jedes Mal selbst in die Küche kommen mussten, um die Fenster zu schließen. Dass solche Widerborstigkeiten von vornherein verhindert werden konnten, wurden die Fenster nach dem legendären Staatsbesuch kurzerhand mit Glasstein zugemauert. Das war für ein halbes Jahr, bis wir in der Küche eine Lüftung bekamen, die Hölle. Wir arbeiteten bei 40 bis 45 Grad. Es war völlig irre.« (Ludwig Schumann) Nicht selten sind jene, die schon zu DDR-Zeiten widerspenstig waren, auch diejenigen, die sich im übernommenen Gesellschaftssystem nicht mit allem arrangieren wollen. Die Erinnerung an einen »dritten Weg« zwischen staatsbürokratischem Sozialismus und westdeutschem Finanzkapitalismus enthält für manche noch immer einen utopischen Überschuss, der noch nicht abgegolten ist: »Eine reformierte DDR hätte ich mir eher vorstellen können. Das wäre mein Wunsch gewesen. Also zwei deutsche Staaten mit durchlässiger Grenze. Mein Gedanke, dass es bei zwei deutschen Staaten bleiben solle, ist, das weiß ich noch, durch eine Ausstrahlung von Werner Höfers Sonntagvormittagssendung ›Der Internationale Frühschoppen‹ inspiriert worden, in welchem über die Deutsche Einheit gesprochen wurde und in welchem ein dänischer Journalist vor einem einheitlichen Deutschland in Europa warnte, das zwangsläufig durch seine schiere Größe und wirtschaftliche Macht zu einer Art ›Übermacht‹ würde. Die Deutschen sollten die Zweistaatlichkeit als ein Ergebnis des von ihnen angezettelten Krieges endlich akzeptieren. Das konnte ich als Argument verstehen und auch akzeptieren. Hinzu kommt aber noch, dass sich mir die Mär von der ›friedlichen Revolution‹ ganz anders zeigt. Ich habe das vor kurzem auch mal geschrieben: Da wurde aus ideologischen Gründen eine völlig falsche Begrifflichkeit eingeführt, die im Osten dankbar entgegengenommen wurde, weil sie die östliche Seele streichelte: Wir haben die erste deutsche Revolution siegreich und dazu noch friedlich über die Weltbühne gebracht. Das, was wir erlebten und gestalteten, war nichts anderes als eine friedliche Restauration. Eine Rückkehr in die alte Gesellschaft. Wir haben nichts Neues aufgebaut. Wir haben das mögliche Neue nicht einmal gesucht. Eine friedliche Revolution wäre eine linke Geschichte gewesen. Für mich war beispielsweise Volkseigentum nicht, was wir aus unseren Betrieben alles herausschleppen konnten, sondern immer noch gemeinschaftliches Eigentum. Und ich habe mich immer sehr geärgert darüber, dass man diese Führung der DDR gleichsetzte mit dem Grundgedanken der gesellschaftlichen Gerechtigkeit.« (Ludwig Schumann) Auch wer z. B. zwischen der Höflichkeit des Kavaliers und der Gleichstellung der Geschlechter keinen unmittelbaren Zusammenhang sah, konnte sich in der neuen gesamtdeutschen Bundesrepublik mitunter fremd fühlen, wie der Soziologe Georg Lohr berichtet: »Schlechte Erfahrungen gab’s aber auch. Für mich prägend war Folgendes, das klingt jetzt nicht wirklich lustig: Ich war zu Besuch in einer westdeutschen Akademie. Und es ist symptomatisch, deshalb will ich das so erzählen, auch weil es eigentlich lapidar ist. Ich habe in diesem westdeutschen Institut zwei Frauen die Tür aufgehalten. Das habe ich so in meinem Elternhaus gelernt. Gute Kinderstube eben. Da wurde ich von den beiden Damen aber sogleich dermaßen barsch angefahren: Ich solle mich doch nicht erdreisten, mich hier dermaßen zu benehmen. Sie könnten sich schon selbst die Tür öffnen und die Zeiten, wo man sowas macht, wären vorbei. Ich habe gedacht, was ist das bloß für eine Krankheit. Ich bin dann aber in mich gegangen (guckt lange vor sich hin) und habe letztlich mein Verhalten trotzdem nicht geändert. Es ist mitnichten so, dass mir das jedes Mal widerfahren ist. Aber es ist ein Stück weit symptomatisch. Ich gebe jetzt auch einfach mal die Meinung oder die Haltung meiner Frau wieder. An der Stelle haben wir bemerkt, dass die Probleme der westdeutschen Frauen grundverschieden waren von den Problemen der ostdeutschen Frauen. Dass da überhaupt sehr, sehr schwer eine auf Augenhöhe stehende Kommunikation herzustellen war. Ich muss dazu sagen, meine Frau hatte dann, als die Akademie abgewickelt war, bei mir in einem Sozialmanagement-Kurs auch Platz gefunden und hat danach sofort eine Anstellung bei der Gewerkschaft gehabt. Wo sie auch lange Jahre erfolgreich gearbeitet hat. Und sie hat da schon diesen Konflikt erlebt in dem Seminar, wo westdeutsche Dozentinnen tätig waren. Sehr unterschiedlich. Vielleicht war es Zufall. Sie hat es so wahrgenommen. Also die, die von ganz weit weg kamen, aus Nordrhein-Westfalen beispielsweise oder aus dem Saarland, die waren ganz extrem. Mit Westberliner Dozenten hatte man gar kein Problem. Die waren halt so, wie sie waren und haben neugierig zugehört und haben sich dann auch schnell drauf einstellen können. Das ging ja bei den Saarländerinnen schon los, dass die einen entsetzt angeguckt haben, wenn man ihnen die Hand reichen wollte. Also diese eigentliche Isolation von westlichen Kleinstaaten, so erschien es uns, war überwältigend und hatte nicht eben eine positive Ausstrahlung auf uns hier im Osten. Ja, solche Tänzchen hatten wir im Osten nicht auszufechten mit Frauen beispielsweise. Das gab‘s einfach nicht. Es war im weitesten Sinne Gleichberechtigung vorhanden. Natürlich gibt es damals wie heute Benachteiligung der Frau, die man aber nicht dadurch kompensiert, indem man sich zu einem Wesen besonderer Art hochstilisiert. Sondern wo man wirklich sehen muss, wie lösen wir die Fragen im Alltag. Und wo gibt es dafür Lösungen und wo gibt es leider Gottes keine. Ich erlebe das heute ganz massiv bei meiner Schwiegertochter, die Ärztin ist und ungeheuer benachteiligt ist gegenüber meinem Sohn, der seine Promotion längst hat, der sich auf dem Facharztweg befindet und viel, viel weiter ist als sie. Weil sie nun mal diejenige war, die die erste Zeit zu Hause beim Kind blieb. Sie ist diejenige, die dann das Kind auf sich fixiert. Und wenn sie sich irgendwo beworben hat, kriegt sie die bange Frage, wie ist denn das mit ihrer Tochter? Das sind Probleme, die wir so damals nicht hatten. Wir waren ganz bestimmt nicht perfekt, aber schon allein die Frage des Umgangs mit den Kindern war eine viel entkrampftere als heute.« (Georg Lohr) Daran, dass große Veränderungen vor uns liegen, hegen viele, die ihre Lebensgeschichte erzählen, keine Zweifel. Während der letzten Jahre habe sie immer scherzhaft gesagt: »Wollt Ihr denn die Monarchie wieder einführen?«, berichtet Frau Faber-Castell und fügt hinzu: »[…] das sind alles Dinge, die Jahrhunderte bestanden haben und aus irgendwelchen Gründen heute nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, dass es das ideale System eben nicht gibt. Ich habe nur die große Sorge, dass unsere Zukunft von einem Zusammenbrechen dieses Planeten beeinflusst wird. Dass die Natur den Menschen nicht mehr verkraftet. Dass wir unsere Meere, unser Wasser, unsere Insektenwelt, unsere Vögel so weit in die Knie zwingen, dass wir uns am Ende als Menschen, ich will nicht sagen vernichten, aber doch drastisch reduzieren werden. Und dann ist es nicht mehr die Frage, welches Gesellschaftssystem wir haben, sondern nur noch: Wo ist das Brett, an dem wir uns über Wasser halten können? Das wird vielleicht noch nicht in den nächsten Jahren passieren, aber perspektivisch ganz sicher. Wenn es uns nicht gelingt, diese Erde zu retten, diese Natur zu erhalten, werden ganz andere Kräfte unseren Weg bestimmen. Das ist meine Sorge und auch meine Überzeugung, wenn ich sehe, wie wir in diesem Land, auf dieser Welt im Moment leben und haushalten.« Wie eine gute Gesellschaft der Zukunft aussehen kann, ist nicht nur für die am Buch beteiligten Ostdeutschen unklar. Doch eines muss eine solche Gesellschaft bestimmt ermöglichen – den freien Zugang zu Kultur, den es in der DDR nicht gab. Für den schriftstellernden Herrn Schumann gehört die Nichtverfügung über Beatles-Schallplatten zu den traumatischen Erlebnissen, die er bis heute nicht vergessen kann: »[…] es [gab, KD] in der DDR die Beatles-Langspielplatte, drei Beatles-Singles, die Bob-Dylan-Platte und ich hatte keinen Plattenspieler. Ich konnte mir freilich das Geld verdienen, indem ich in unserer Gastwirtschaft Flaschenbier verkaufte und das Trinkgeld behalten durfte. Ich habe innerhalb eines Jahres 150 Mark für den Plattenspieler zusammengespart, ihn gekauft, hatte jetzt aber kein Geld mehr, auch die Platten zu erstehen. Ich musste also weiter Flaschenbier verkaufen. Als ich nun für die erste Platte das Geld zusammen hatte, ging ich ins Kaufhaus, nicht ahnend, dass zwei Tage vorher der »Bitterfelder Weg« (läutete Anfang der 60-iger Jahre in der DDR eine neue programmatische Entwicklung der Kulturpolitik ein; d.R.) beschritten wurde, das heißt, es war keine der von mir gewünschten Platten mehr im Verkauf. Jetzt hatte ich also einen Plattenspieler und nix drauf zu legen. Wir hatten auch keine Westverwandtschaft. Ich war ein begeisterter Beatles-Fan, seit ich ›Komm gib mir deine Hand‹ gehört hatte. Statt Beatles kaufte ich mir jetzt eben die Mondschein-Sonate von Beethoven, später eine Langspielplatte von Louis Armstrong und die ›Alabama-Blues‹ von J. B. Lenoir. Im Nachhinein habe ich es Walter Ulbricht zu verdanken, dass auf diese Weise mein Interesse für Jazz und Blues geweckt wurde. Der Schock freilich, dass ich in das Kaufhaus ging und die Platten weg waren, wurde zum Lebenstrauma. Ich habe bis heute keine tolle Stereo-Anlage, weil da immer noch die panische Angst ist, ich hätte die Anlage und die Platten wären aus den Läden verschwunden. Ich habe also eine großartige Platten- und CD-Sammlung, aber keine wirklich klangschöne Anlage. Ist doch verrückt, oder?« Nun ja, »Komm gib mir deine Hand« war ehrlich gesagt Mist, und die wirklichen Revolutionäre im Westen hörten damals nicht Beatles, sondern Rolling Stones. Für einen Plattenspieler mussten auch wir lange sparen. Und wenn nur die Schwester einen hatte, war der Kulturkampf vorprogrammiert. Led Zeppelin und Ten Years After gegen Heino und Heintje war ein keineswegs leicht zu gewinnender Fight. Dennoch wären wir in einem sicher gewesen. In einem Staat, der Rolling-Stones-Platten nicht frei verfügbar machte, hätten wir nicht leben wollen. Womit sich der Kreis zu den Bottroper Protokollen schließt: 50 Jahre nach Erscheinen dieser legendären Reportage heißt es von Erika Runge, dass sie sich an einen Elektriker, der in einer Band singt, besonders gern erinnert: »Dafür habe ich die ›Bottroper Protokolle‹ gemacht, dass man singt! Mitten in dem Elend, wo man nicht mehr weiterweiß, sagt, wir schaffen das: Wir singen!« Vielleicht wird man über das Buch von Uta Heyder irgendwann etwas Ähnliches sagen und schreiben. Ihren »Erfurter Protokollen, ist – ich schreibe das als Jenaer – eine große Leserschaft zu wünschen! Wer genau liest und auf die Zwischentöne achtet, wird anschließend genau wissen, was künftig nicht gebraucht wird, wenn es um das innerdeutsche Ost-West-Verhältnis geht: Schwarz-Weiß-Malerei ist gänzlich unangebracht. Nur wer das versteht und die Abwertungserfahrungen ernst nimmt, aus denen sich das Sonderbewusstsein Ost noch immer speist, besitzt die Chance, jene gesellschaftliche Kluft zu überwinden, die nicht nur in den Köpfen, sondern auch aufgrund ungleicher sozialer Verhältnisse noch immer existiert.
»Bottroper Protokolle - Gespräche aus dem Ruhrgebiet«, so nannte sich eine später in Buchform veröffentlichte WDR-Reportage der Filmemacherin und Autorin Erika Runge. Darin kamen Menschen aus dem kriselnden Kohlebergbau zu Wort. Sie sprachen über ihre Arbeit, ihr Leben, über Frauenbilder, Sex und Musik und nicht zuletzt über ihre Sicht auf die Stadt Bottrop. Ohne es selbst darauf angelegt zu haben, entdeckte Erika Runge etwas, das es angeblich nicht mehr gab - Arbeiter in der westdeutschen Klassengesellschaft. Gut 50 Jahre nach dem Erscheinen der Bottroper Protokolle liegt wiederum ein Buch vor, das Lebensgeschichten erzählt. Wiederum geht es um eine Gesellschaft, die es angeblich nicht mehr gibt. Diesmal sind es jedoch nicht die Arbeiter im Kohlerevier, von denen die Protokolle handeln. Nun sind es die »Ostdeutschen«, die in exemplarischen Erzählungen zum Thema werden.Deutschland Ost und Deutschland West - sind das, 30 Jahre nach der Maueröffnung, noch immer verschiedene Gesellschaften? Liest man die biographischen Schilderungen, die von der Autorin Uta Heyder feinfühlig verdichtet wurden, ist die Antwort ein klares »Ja, aber«. Ja lautet die Antwort allerdings nicht deshalb, weil das dokumentierte Material gängige Klischees über die Ostdeutschen bestätigen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Wer sich als Leserin oder Leser in die biographischen Erzählungen vertieft, wird von der Fülle des Materials geradezu erschlagen. Die Ostdeutschen - selbiges begründet das dem »Ja« hinzugefügte »aber« - gibt es eben nicht! Sicher, Mauerfall und Systemwechsel sind prägende Erfahrungen, die teilt, wer in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Es handelte sich um Ereignisse, die im Osten, wohl stärker als im Westen, eine politische Generation hervorgebracht haben. Politische Generationen entstehen, wie der Soziologe Karl Mannheim herausgearbeitet hat, aufgrund einer gemeinsamen zeithistorischen Lagerung im sozialen Raum. Sie werden durch Schlüsselereignisse geprägt, was keineswegs ausschließt, dass sich einzelne Generationseinheiten sozial, politisch und kulturell aufs Heftigste bekämpfen. Verbundenheit in ständigen Auseinandersetzungen - das ist ein gemeinsames Merkmal der (Nach-)Wendegeneration mit eigener DDR-Erfahrung. Wie die dokumentierten Lebensgeschichten belegen, wurde der gemeinsam erlebte Systemumbruch individuell jedoch höchst unterschiedlich verarbeitet. Er mündete in biographische Auf- und Abstiege, öffnete Chancen für die einen, drängte andere jedoch an den Rand der Gesellschaft und unter die Schwelle sozialer Respektabilität. Die »Erfurter Protokolle« (gemeint sind die im Buch veröffentlichten, redigierten Gesprächsprotokolle aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) decken dementsprechend eine große Bandbreite an Erfahrungen, Verarbeitungsformen und individuellen Weltsichten ab. Da steht der ehemalige Arbeiter, der nach zahlreichen biografischen Stationen im Hartz-IV-Bezug landet, neben der erfolgreichen Betreiberin einer Model-Agentur, die sich beruflich bis zum Burnout verausgabt hat. Der Migrationskritiker mit Sympathie für manche inhaltlichen Positionen der AfD trifft auf die in der globalisierungskritischen Bewegung engagierte Attac-Aktivistin. Freude über neu gewonnene Freiheiten mischt sich mit der noch immer nicht überwundenen Enttäuschung, dass für einen dritten Weg zwischen DDR-Sozialismus und BRD-Kapitalismus kein Experimentierspielraum blieb. Und das Bewusstsein, ein Regime zum Einsturz gebracht zu haben, das fest im Sattel zu sitzen schien, mischt sich mit Ohnmachtserfahrungen und Sorge um die Zukunft der Gesellschaft und des Planeten.Trotz aller Unterschiedlichkeit findet sich in den Biografien doch so etwas wie eine gemeinsame Tiefengeschichte. Als Tiefengeschichte, deep story, bezeichnet die US-amerikanische Soziologin Arlie Hochschild eine Erzählung, die sich für viele Menschen wie die eigentliche Wahrheit anfühlt. Es wäre sicher möglich, eine solche deep story für Ostdeutsche aus den »Erfurter Protoko
| Erscheinungsdatum | 16.06.2019 |
|---|---|
| Illustrationen | Falko Behr |
| Vorwort | Klaus Dörre |
| Verlagsort | Jena & Quedlinburg |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 210 x 297 mm |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Mikrosoziologie | |
| Schlagworte | DDR • Deutsche Einheit • Friedliche Revolution • Lieberknecht • Mauerfall • Restaurant Shalom in Chemnitz • Steimle • Wende |
| ISBN-10 | 3-942115-50-6 / 3942115506 |
| ISBN-13 | 978-3-942115-50-6 / 9783942115506 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich