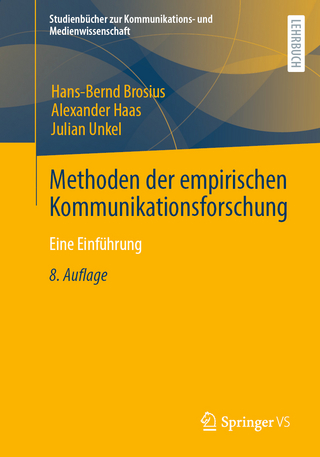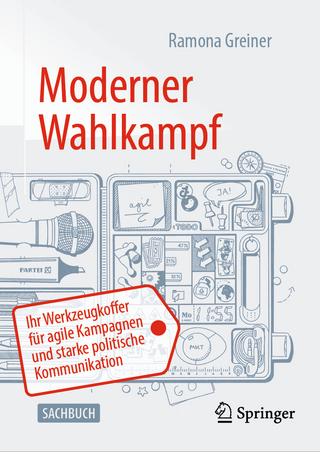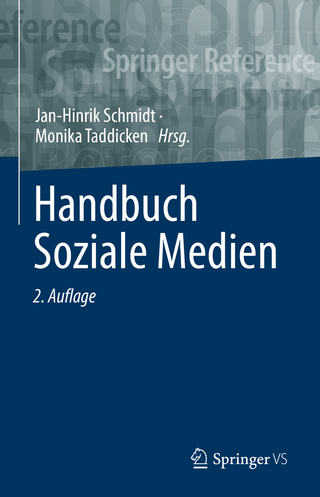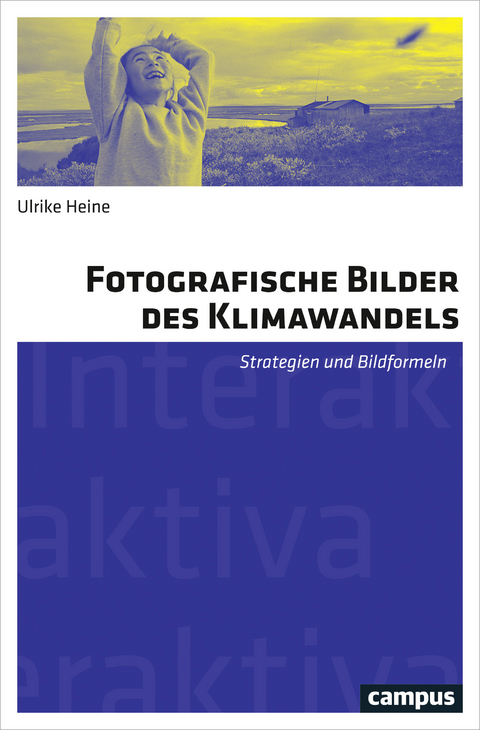
Fotografische Bilder des Klimawandels
Campus (Verlag)
978-3-593-51066-8 (ISBN)
Warum sind Fotografien im Diskurs über den Klimawandel so omnipräsent? Anhand einer Analyse von 19 fotojournalistischen und fotokünstlerischen Projekten arbeitet die Autorin konzeptuelle und ästhetische Strategien sowie dominante Bildformeln heraus und zeigt damit, warum sich fotografische Bilder so großer Beliebtheit bei der Vermittlung des Klimawandels erfreuen und welche Funktionen sie dabei übernehmen können: Mit diesem Bildprogramm, so hoffen seine Urheber, wird der Klimawandel als globales Phänomen erfahrbar, verständlich und relevant.
Ulrike Heine studierte Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften in Leipzig und St. Petersburg. Sie arbeitet als freie Kuratorin mit Schwerpunkt Fotografiegeschichte und Ökologie.
Inhalt
1 Einleitung 9
1.1 Forschungsbericht 13
1.1.1 Bilder des Klimawandels 13
1.1.2 Eco-Images und Environmental Photography 17
1.2 Untersuchungskorpus 22
1.3 Methodisches Vorgehen 42
1.3.1 Künstlerische Strategien und Paratexte 43
1.3.2 Die ikonografisch-ikonologische Methode und die Bestimmung von Bildformeln 46
2 Das Unsichtbare sichtbar machen: Konzeptuelle und ästhetische Strategien in fotografischen Projekten zum Klimawandel 55
2.1 Die Realität des Klimawandels bezeugen 61
2.1.1 Archivalische Ordnungen des Klimawandels 63
2.1.2 Die fotografische Augenzeugenschaft des Klimawandels 70
2.1.3 Den Klimawandel als Ereignis bezeugen 78
2.2 Die Klimaforschung zeigen 85
2.2.1 Der epistemische Status von Fotografien 88
2.2.2 Die Klimaforschung dokumentieren 95
2.2.3 Illustrierte Sachbücher zum Klimawandel 101
2.3 Den Klimawandel bedeutsam machen104
2.3.1Die sinnliche Erkenntnis 106
2.3.2 Der Handlungsaufruf 113
3 Vom treibenden Eisberg zum Kreismotiv: Bildformeln des Klimawandels 120
3.1 Mess- und beobachtbare Veränderungen 125
3.1.1 Das Schmelzen der Pole 127
3.1.2 Das Auftauen des Permafrosts 144
3.1.3 Das Schrumpfen der Gletscher 156
3.1.4 Der Anstieg des Meeresspiegels 168
3.1.5 Die Zunahme des Extremwetterereignisse 178
3.2 Prognostizierte Folgen 192
3.2.1 Der Verlust der Biodiversität 194
3.2.2 Der Mensch als Opfer des Klimawandels 213
3.3 Ursachen 232
3.3.1 Die schädlichen Gase 234
3.3.2 Die Konsumgesellschaft 245
3.3.3 Überformte Landschaften 256
3.4 Lösungen 270
3.4.1 Transnationale Verhandlungen und globaler Aktivismus 272
3.4.2 Die technologische Revolution 285
3.4.3 Der Kulturwandel 299
4 Fazit und Ausblick 308
Fotografische Projekte zum Klimawandel 318
Literatur und Quellen 321
Dank 349
1 Einleitung Im Mai 2010 veröffentlichte das Wissenschaftsmagazin Science einen offenen Brief mit dem Titel »Climate Change and the Integrity of Science«. Er wurde von 255 Mitgliedern der US-amerikanischen National Academy of Science unterschrieben und bezieht sich auf die bis dahin »jüngste Eskalation politischer Anfeindungen« , mit denen sich Wissenschaftler im Allgemeinen und Klimawissenschaftler im Besonderen konfrontiert sehen. Die Autoren sprechen die Aufarbeitung des sogenannten Climategate an – sowohl vonseiten unabhängiger politischer Gremien in den USA und Großbritannien als auch in der Blogosphäre. Die Diskussion entwickelte sich, nachdem die gehackte E-Mail-Korrespondenz von Klimaforschern der Climate Research Unit an der East Anglia University in England im November 2009 online zugänglich gemacht wurde. Kritisch gelesen gibt die teilweise sehr informelle Korrespondenz zwischen vier an der Unit tätigen Forschern Anlass zu Spekulationen, wissenschaftliche Messdaten seien möglicherweise so modifiziert worden, dass sie den Zusammenhang zwischen globalem Temperaturanstieg und CO2-Ausstoß argumentativ stützen könnten. Die Wissenschaftler reagierten mit einem offenen Brief im Science-Magazin auf diesen vermeintlichen Skandal, fassen dabei die zentralen Erkenntnisse der Klimaforschung, über die in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft Konsens besteht, zusammen und appellieren daran, die Unabhängigkeit der Forschung zu bewahren. Der Beitrag wurde nur kurz nach seiner Veröffentlichung ebenfalls zum kontroversen Gegenstand in der Blogosphäre, allerdings nicht wegen der im Artikel formulierten Thesen, sondern aufgrund der Abbildung, welche die Redakteure der Zeitschrift zur Illustration des Beitrags verwendeten. In die linke der beiden Textspalten der ersten Seite des Artikels gesetzt zeigt ein annähernd quadratisches Bild (Abb. 1) einen Eisbären, der auf einer nur wenige Quadratmeter großen Eisscholle auf dem offenen Meer treibt. Die Beschaulichkeit und getragene Stille des Bildes, verstärkt durch die unbewegte Wasseroberfläche, täuscht über die lebensbedrohlichen Implikationen der Szenerie hinweg: Trifft der Eisbär nicht bald auf eine Packeisdecke, muss er die Suche nach Nahrung schwimmend fortsetzen. Obwohl Eisbären zähe Schwimmer und Faster sind, ertrinken immer mehr Tiere bei der Nahrungssuche im Sommer, da das saisonale Packeis schmilzt und Robben und Walrosse, die hauptsächliche Nahrung der Eisbären, aus deren Reichweite geraten. Mit dem Eisbären auf der Scholle haben die Science-Redakteure ein Motiv gewählt, das in zahlreichen Kontexten als Illustration für die durch den Klimawandel verursachte polare Schmelze und der damit einhergehenden Zerstörung des Habitats der Tiere verwendet wird. Aber nicht das Motiv selbst oder seine Ubiquität waren Anstoß für die umfassende Kritik. Vielmehr rückte ins Zentrum, dass es sich bei dem Bild nicht um eine Fotografie handelt, sondern um eine mit Grafiksoftware erstellte Montage. Abb. 1: Coldimages, »The Last Polar Bear«, 2011, computergeneriertes Bild (© Coldimages). Diese Diskussion, die sich im Frühjahr 2010 in Blogs und Online-Foren um das Bild entfaltete, gibt Aufschluss über die Funktionen, die Fotografien in der medialen Vermittlung des Klimawandels zugewiesen werden. Einerseits zeugt die Entscheidung, den offenen Brief zu illustrieren, von der generellen Bedeutung, die man visuellen Botschaften – vor allem Fotografien – bei der Präsentation klimawissenschaftlicher Thesen beimisst. Andererseits zeigt sich an der Kontroverse um die Verwendung des Bildes der noch immer starke Glaube an die Objektivität und Wirklichkeitstreue des Mediums Fotografie. Eine echte Fotografie durch ein computergeneriertes Bild zu ersetzen, unterminiert scheinbar nicht nur die Aussage des Bildes, sondern auch die Glaubwürdigkeit des Kontextes. An diese Beobachtungen anschließend lässt sich gleich eine Reihe von relevanten Fragen für die Untersuchung fotografischer Bilder innerhalb der Klimawandeldebatte formulieren: Warum wird Fotografien eine so wesentliche Rolle in der öffentlichen Diskussion zugeschrieben und welche Funktionen übernehmen diese Bilder dabei? Was zeigen sie und in welchem Verhältnis stehen die Bildthemen zu wissenschaftlichen und politischen Diskursen, in denen der Klimawandel definiert wird? Und, abschließend und prospektiv, werden die Bilder der Aufgabe gerecht, das vielgestaltige Phänomen Klimawandel zu vermitteln? Die vorliegende Arbeit knüpft an Studien an, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der vielschichtigen Produktion fotografischer Bilder zum Klimawandel beschäftigen. Zum einen analysiere ich die Konzepte und Strategien, die den zahlreichen fotografischen Projekten zum Klimawandel zugrunde liegen, und interpretiere sie im Hinblick auf die von den Fotografen und Redakteuren selbst formulierte Zielstellung, den Klimawandel sichtbar machen zu wollen (Kapitel 2). Zum anderen unterziehe ich das umfangreiche Bildrepertoire einer Analyse und stelle dessen Bedeutung für die Diskussion zum Klimawandel heraus (Kapitel 3). Obwohl diese beiden Analyseschritte zunächst einer recht unterschiedlichen methodischen Behandlung bedürfen (Kapitel 1.3), bedingen sie sich gegenseitig. Die ineinander verschränkte Diskussion von Bildfunktionen und Bildinhalten soll diese Verschränkung aufzeigen und eine kritische Einschätzung der fotografischen Bildproduktion zum Thema Klimawandel ermöglichen (Kapitel 4). 1.1 Forschungsbericht Diese Arbeit ist im Schnittpunkt von zwei relativ jungen Forschungsfeldern entstanden: zum einen der Erforschung verschiedener Bildformen, mit denen der Klimawandel anschaulich gemacht wird, zum anderem einer historisch orientierten Analyse der Rolle von Fotografien in ökologischen Diskursen. Diese Felder lassen sich anhand der aktuellen Literaturlage adäquat umreißen. 1.1.1 Bilder des Klimawandels Ein im Frühjahr 2014 veröffentlichter Sammelband mit dem Titel Image Politics of Climate Change. Visualizations, Imaginations, Documentations bietet einen umfassenden Überblick über die methodischen und disziplinären Ansätze, die in den letzten Jahren die kritische Analyse der visuellen Dar-stellungen des Klimawandels konstituiert haben. In den fünf Kapiteln der Publikation sind 14 Beiträge von Kommunikations- und Medienwissenschaftlern, Historikern, Kunsthistorikern, Politikwissenschaftlern, aber auch von Künstlern, Klimatologen und Datenvisualisierern versammelt. Die unterschiedlichen Autoren teilen die Ansicht der Herausgeber Birgit Schneider und Thomas Nocke, dass »images have started to shape the imagination of a world under the conditions of climate change«. Als Beleg für ihre Aussage führen Schneider und Nocke die Zunahme der Bild-produktion an, die sich in der intensiver werdenden öffentlichen Diskus-sion wissenschaftlicher Ergebnisse der Klimaforschung seit der Jahrtausendwende beobachten lässt: »[…] the reports of the IPCC are filled with a plethora of colorful graphs; every week, another popular book on climate change broadcasting scientific data graphics is published, but also plenty of expensive photobooks have been com-piled depicting landscapes under the impact of climate change; magazines print high quality photo series of a changing world and the latest natural disasters caused by climate impacts; art galleries have put together a great number of shows in the last few years addressing climate change issues at an artistic level; numerous movies have been produced focusing on the issue of a final and global catastrophe or addressing climate change from a documentary perspective; innumerable websites and blogs with scientific, journalistic or political backgrounds exist which make use of climate change pictures; pictures of climate change have even become a permanent backdrop for the visual language of advertising.« Vor diesem Hintergrund werde die kritische Analyse der visuellen Dar-stellungen des Klimas und des Klimawandels notwendig, da diese, so die Herausgeber weiter, durch den weitläufigen Gebrauch in vorgegebenen Kommunikationsstrukturen normalisiert werden, sich dabei aber das Wissen über ihre Produktion und Produktionsbedingungen verliert. Bei der Strukturierung des Forschungsfelds orientieren sich Schneider und Nocke an Fragestellungen und thematischen Klammern, die transdisziplinär sind und für unterschiedliche Bildtypen wirken. Die Abfolge der Kapitel ergibt einen Bogen von den Funktionen der Bilder bei der Produktion klimawissenschaftlicher Ergebnisse hin zu ihrer Rolle für die Kommunikation dieser Resultate, ihrem Einsatz als positive Stimulatoren für individuelle und kollektive Strategien zur Vermeidung des Klimawandels und letztlich ihrem Gebrauch für die Kontrolle klimabeeinflussender Maßnahmen. In der Zusammenschau bestätigen die Beiträge im Sammelband die multiplen Funktionen, die Bilder in der Darstellung und für die Vorstellung des Klimawandels übernehmen, und geben zugleich einen Überblick über die unterschiedlichen methodischen Perspektiven, die an die Bilder angelegt werden. Auch Fotografien und ihre unterschiedlichen Funktionalisierungen werden in mehreren Aufsätzen diskutiert. Der folgende Abschnitt fasst die verschiedenen Positionen zusammen und stellt sie in größere Forschungszusammenhänge. Die Hamburger Kommunikationswissenschaftlerin Elke Grittmann untersuchte im Vorfeld der Klimakonferenz in Kopenhagen den Gebrauch von Fotografien in der deutschen Presseberichterstattung und stellte typische Bildthemen und deren »framing« im medialen Diskurs heraus. In einem Aufsatz, den Grittmann bereits 2012 zu diesem Thema veröffentlicht hat, vertieft sie methodische Überlegungen und skizziert das weitere Forschungsfeld, das sich mit der visuellen Berichterstattung zum Klimawandel verbindet. Diese spezielle Forschungsperspektive ist Teil einer umfangreichen, internationalen und vorwiegend an quantitativen Methoden ausgerichteten Forschung zur Medienberichterstattung zum Klimawandel. Die britische Künstlerin, Aktivistin und Medienwissenschaftlerin Julie Doyle analysiert in ihrem Aufsatz Fotografien in Klimaschutzkampagnen der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die NGO ist seit den 1990er Jahren nicht nur ein zentraler Akteur der Klimawandeldebatte, sondern, so Doyle, auch »the arguably most image-centric environmental campaign group«. Aus fototheoretischer Sicht bewertet Doyle dokumentarische Fotografien für die Vermittlung von Umweltthemen, besonders des Klimawandels, als problematisch, da deren inkrementelle Entwicklung dem »Here and Now«-Dogma fotografischer Aufnahmen konzeptuell zu widersprechen scheint. Vielmehr plädiert sie für einen offenen Umgang damit, dass Erscheinungen des ökologischen Wandels nur selten unmittelbar fotografisch dokumentiert werden können. Stattdessen sollte die mit den Bildern verbundene Bedeutungsambivalenz dabei helfen, den Klimawandel vorstellbar und bedeutsam zu machen. Daran anschließend lässt sich der Beitrag der US-amerikanischen Künstler Susannah Sayler und Edward Morris lesen. Sie reflektieren mit theoretischen Modellen das aufklärerische und aktivistische Potenzial ihrer künstlerischen Fotografien zum Klimawandel. Zentral sind die Ausführungen des französischen Philosophen Jaques Rancière zum »emanzipierten Zuschauer«, der sich beim Betrachten in einem Zustand der Nachdenklichkeit (»pensiveness«) befindet, einem Zustand zwischen Aktivität und Passivität. Auf der Basis von Rancières Konzept entwickeln Sayler und Morris im Rahmen ihres Langzeitprojekts »A History of the Future« das Konzept des »pensive photograph«, des nachdenklichen oder gedankenstimulierenden fotografischen Bildes, das als Gegenentwurf zu illustrativ gebrauchten Fotografien verstanden werden soll, deren Inhalt sich in der Regel aus dem unmittelbaren Kontext erschließt.
| Erscheinungsdatum | 12.09.2019 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Interaktiva, Schriftenreihe des Zentrums für Medien und Interaktivität, Gießen ; 15 |
| Zusatzinfo | 69 Farbabbildungen |
| Verlagsort | Frankfurt |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 141 x 213 mm |
| Gewicht | 444 g |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Kommunikation / Medien ► Kommunikationswissenschaft |
| Sozialwissenschaften ► Kommunikation / Medien ► Medienwissenschaft | |
| Schlagworte | Bildformeln • Bildprogramm • Bildwissenschaft • Fotografie • Globalisierung • Klima • Klimawandel • Ökologie |
| ISBN-10 | 3-593-51066-9 / 3593510669 |
| ISBN-13 | 978-3-593-51066-8 / 9783593510668 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich