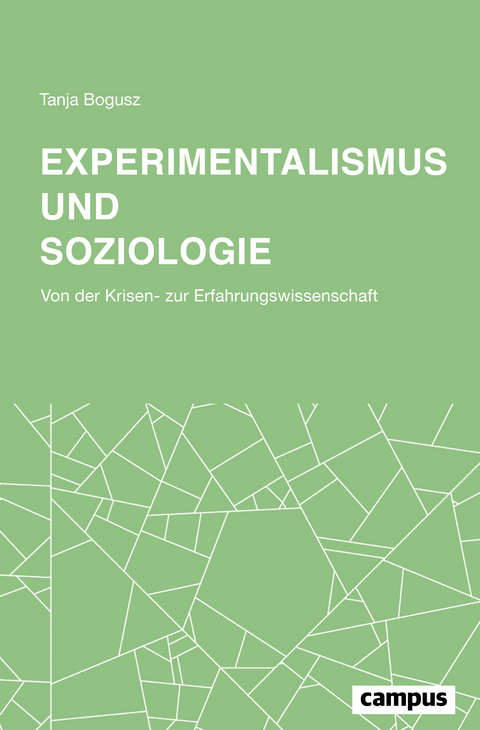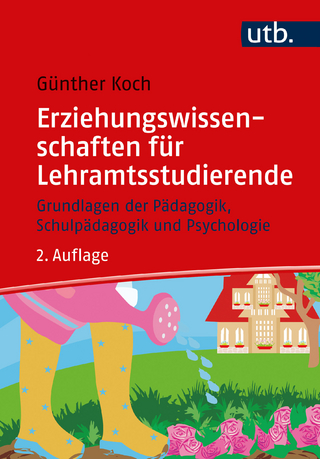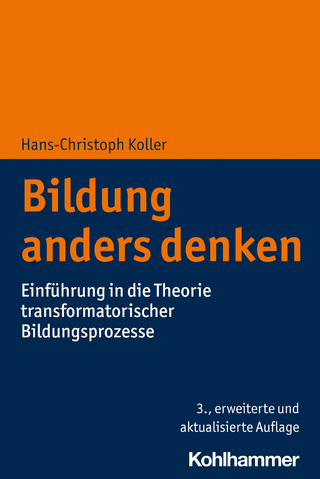Experimentalismus und Soziologie
Die Soziologie muss ihre gesellschaftliche Funktion, ihre interdisziplinäre Anschlussfähigkeit und ihr Interventionsspektrum im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Transformationsprozesse neu bestimmen. "Soziologischer Experimentalismus", verstanden als eine Umstellung des Faches von der Krisen- zur Erfahrungswissenschaft, ist eine Antwort auf diese Herausforderung. Experiment und Erfahrung gehören zusammen. Als Erfahrungswissenschaft wird Soziologie damit zu einer Praxis, die Erfahrungen nicht nur beobachtet, sondern zur Voraussetzung jeder Art von Erkenntnis macht. Die Zukunft des soziologischen Experimentalismus liegt folglich in der Aufgabe, attraktive Laboratorien für entsprechende Kooperationen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft dauerhaft bereit zu stellen.
Tanja Bogusz ist Gastprofessorin an der Universität Kassel, wo sie seit 2016 das Fachgebiet Soziologie sozialer Disparitäten leitet.
Einleitung: Experimentalismus - ein alter Name für einige neue Denkweisen
Der Experimentalismus ist alt und erfindet sich immer wieder neu. Zwischen wissenschaftlicher Neugier und Objektivitätsstreben, der kulturellen Faszination für abweichende Lebensformen und politischer Krisenrhetorik steht er für vielfältige Konjunkturen. Bereits 1927 hatte der Philosoph John Dewey den Begriff des "?demokratischen Experimentalismus?" geprägt. Für ihn beruhte Erkenntnis auf Erfahrungen, die aus Krisenmomenten hervorgehen. Dieses Buch fragt, welche Schlüsse aus Deweys Sozialphilosophie für die Gegenwart gezogen werden können. Es zeigt, wie ein soziologischer Experimentalismus den Weg von einer Krisen- zu einer Erfahrungswissenschaft bereitet, die Ungewissheit als notwendigen Ausgangspunkt jeder forschenden Praxis versteht.
Ende der 1950er Jahre tauchte das Experiment in besonders erhöhter Frequenz in Politik und Medien auf. "?Keine Experimente?!?" rief Konrad Adenauer 1957 einer verunsicherten westdeutschen Bevölkerung zu. Das ungewollte Experiment wurde mit der Wahl der SPD identifiziert, deren Ostpolitik in der Phase des Kalten Krieges aus Sicht der Christdemokraten zu einer politischen Destabilisierung der Bundesrepublik führen würde. Der Imperativ machte das Experiment zum politischen Gegner von normativen Setzungen, die Gewissheit und Stabilität versprachen. Nach einer Phase der relativen Rezession schossen die Koeffizienten Ende der 1980er Jahre erneut in die Höhe und bleiben seit den 1990er Jahren unverändert hoch. Mit dem Fall der Berliner Mauer wurde zweiunddreißig Jahre später das "?realsozialistische Experiment?" ein für allemal für gescheitert erklärt und neue Unsicherheiten in den Dienst des Experiments gestellt. Der Super-GAU, die Reaktorkatastrophe des Kernkraftwerkes im sowjetischen Tschernobyl 1986 lenkte die Aufmerksamkeit auf die lebensbedrohlichen Konsequenzen des wissenschaftlichen Fortschritts und damit auf Experimentalanordnungen ganz anderer Qualität. Ihre unerwünschten Nebenfolgen warfen ein alarmierendes Licht auf die Grenzen des Wissens und die unvorhersehbaren Effekte des Nichtwissens, das jedem Experiment innewohnt. Weitere Technik- und Umweltkatastrophen machten Schlagzeilen, auf die, wie zuletzt im Fall des Reaktorunfalls im japanischen Fukushima 2011, auch eine kurzfristige Neuorientierung politischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Programmatiken erfolgte. Ergänzend zu diesen an Technikkatastrophen orientierten Debatten über den Laborcharakter der Industriegesellschaften wurden die Verwerfungen des Experiments in Kontext der Kolonialgeschichte offenkundig. So bemerken Andreas Eckert und Albert Wirz: "?Schließlich dienten überseeische Beziehungen auch als Laboratorien der Moderne, in denen sich Missionare, Lehrer und Ärzte frei von Eingrenzungen der europäischen Gesellschaftsordnung ›?experimentell?‹ zu betätigen vermochten, wobei die Ergebnisse dieser Experimente häufig wiederum ganz konkrete Effekte für die Metropole haben konnten.?"
Im Gegensatz zu seiner vergleichsweise fatalen Geschichte fällt heute eine durchgängig positive Deutung des Experiments in Kunst und Kultur auf. Kaum ein Medienbeitrag, der nicht den experimentellen Charakter künstlerischer Produktionsformen lobend hervorhebt; kaum eine künstlerische Selbstdarstellung, die nicht ihre unabgeschlossene, abenteuerliche, riskierte Handlungsorientierung betont, da nur diese, so die unterschwellige These, schließlich Neues zu erfinden vermag. Kritiker einer "?versteinerten?" Bürokratie- und Dienstleistungsgesellschaft heben ihre Praktiken der symbolischen Grenzüberschreitung hervor, die, wie Pierre Bourdieu das einst genannt hat, als "?Institutionalisierung der Anomie?" längst als traditionsreicher Traditionsbruch etabliert ist. Der kulturalisierte Experimentalismus erinnert damit zugleich an die Ausgangsthese des Kulturbegriffes selbst: Kultur als vom Menschen gelenkte Umwelteinwirkung, als eine Praxis also, die jedes forschende Tun grundsätzlich einbezieht. Und je nachdem, wie sicher sich Politik oder Wirtschaft im Sattel fühlen, lässt man sich auch dort auf experimentelle Aushandlungsformen politischer Willensbildung ein. Dies betrifft insbesondere das Feld der partizipativen Demokratiebewegungen, der sogenannten Bürgerwissenschaften ("?citizen science?") und solcher Organisationsformen, die eine Verbesserung zivilgesellschaftlicher Kooperationen und öffentlicher Mitbestimmung anstreben.
Analog zu diesen Entwicklungen schien es naheliegend, wie es Wolfgang Krohn und Johannes Weyer in ihrem gleichnamigen Aufsatz von 1989 getan haben, anschließend an Ulrich Becks Proklamation der "?Risikogesellschaft?" (1986) die "?Gesellschaft als Labor?" zu bezeichnen. Die soziologische Reflexion der bedrohlichen Seiten des Experiments stand zu Beginn der 1960er und erst recht in den 1980er Jahren noch für die zeitdiagnostische Entfremdungsthese zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Das Experiment wurde an eine Soziologie als Krisenwissenschaft gekoppelt, welche die Aporien eines übersteigerten Technikoptimismus kritisch begleitete. Erst seit den 1990er Jahren wird diese Laborsituation auch in den Sozialwissenschaften gleichsam kulturalisiert, indem sie nicht nur die gefährdenden, sondern auch die produktiven Aspekte des Experimentierens zum Zwecke der Stärkung gesellschaftspolitischer Akteurskompetenzen reflektieren. Die Wiederentdeckung mündiger, streitbarer und kompetenter Akteure leitete den Beginn der Umstellung der Soziologie von der Krisen- zu einer Erfahrungswissenschaft ein, um die es in dem vorliegenden Buch geht.
Krisenwissenschaften, die sich als "?kritische Wissenschaften?" verstehen, beharren auf einer epistemischen Außenposition, die das Beobachten von Gesellschaft von vermeintlich neutralem Boden aus unternimmt. Dies war lange Zeit die Rolle der Soziologie. Doch im Zeitalter von Klimawandel und Biodiversitätsverlust, von Digitalisierung und Globalisierung, andauernden Bürgerkriegen und Finanzkrisen haben NaturwissenschaftlerInnen, IngenieurInnen, PolitikwissenschaftlerInnen und ÖkonomInnen der Soziologie den Rang als erste Krisenwissenschaft der Moderne abgelaufen. Auf die Nebenränge der Kulturkritik geschoben, schmollt das Fach und sinniert in eigenen Krisendebatten über gesellschaftliche Relevanz und Funktion. Doch wenn es stimmt, dass wir in einem fortdauernden "?Realexperiment?" leben, stellt sich die Frage, was in dieser Situation das Alleinstellungsmerkmal des Faches ausmacht. Die kulturkritische Pose allein genügt nicht, um die epistemischen Beiträge des Experiments und seine produktiven Irritationseffekte langfristig sicher zu stellen.
Niemand wusste dies besser als William James. In seiner berühmten Vorlesung von 1906 hatte James den Pragmatismus "?einen neuen Namen für einige alte Denkweisen?" genannt. Mit dieser - für James untypisch bescheiden anmutenden - Definition wollte der populäre Protagonist der pragmatistischen Bewegung die Befürchtungen seiner Kritiker dämpfen, der Pragmatismus würde sämtliche normativen Bestände der Erkenntnistheorie in der Folge von Aristoteles, Descartes und Kant abschaffen wollen. Um die Grundlagen des Pragmatismus zu verstehen, empfahl James seinen Hörern die Aufsatzsammlung seines in Duktus und Auftreten weitaus zurückhaltenderen jüngeren Kollegen John Dewey. Diese trug den Titel "?Essays in logical Theory?". Die Essays bildeten den Ausgangspunkt für das, was der mittlerweile international bekannte Dewey 1938 in "?Logic. The Theory of Inquiry?" zu einer Forschungstheorie ausprägte, die Dewey als "?Experimentalismus?" bezeichnete. Dewey orientierte sich an der Physik und nahm das Experiment wortwörtlich: als erfahrungsbasierte und operationale Umwandlung von Nichtwissen zu Wissen, inspiriert durch die instrumentellen Verfahrensweisen des naturwissenschaftlichen Experiments. Nichtwissen, also Unsicherheit und Krisensituationen, ist demzufolge nicht Problem, sondern Anstoß für problemlösendes Handeln. Deweys These, so der Ausgangspunkt der vorliegenden Unternehmung, muss eine Soziologie tangieren, die sich jenseits ihrer Funktion als Krisenwissenschaft der Moderne auch als Verwalterin gesellschaftlicher Selbstreflexion mit problemlösendem Anspruch versteht. Sie stellt eine Soziologie, die sich als "?Erfahrungswissenschaft?" versteht, vor die Herausforderung, sich auf Zustände des Nichtwissens zurückzubesinnen, von denen ausgehend neue Erkenntnisse erst exploriert werden können. Die Konsequenzen dieser These für die Soziologie können jedoch nur dann erfasst werden, wenn das Experiment nicht nur als zu beobachtende Sozialfigur, sondern zugleich als Mittel zur Generierung auch der eigenen Wissensproduktion definiert wird. Neben den daraus abzuleitenden transdisziplinären Gewinnen eines solchermaßen soziologisierten Experimentalismus wird damit auch das Desiderat nach einer Wissenschaftstheorie der Soziologie, oder allgemeiner, einer "?Wissenschaftssoziologie der Soziologie?" aufgegriffen. Damit nehme ich zugleich Bezug auf ein klassisches soziologisches Problem, das seit der Entstehungsphase des Faches einer gründlichen Auseinandersetzung harrt.
Problemstellung
Der Begriff des Experiments verweist im Englischen, aber auch im Deutschen semantisch auf die Verbindung von "?Erfahrung?" und "?operationalem Handeln?" in Form des Prüfens, Ausprobierens, Testens. Im Französischen gibt es sogar nur einen Begriff: "?Faire une expérience?" bedeutet zugleich "?ein Experiment durchführen?" sowie "?eine Erfahrung machen?". Diese Doppelseitigkeit von Tun und Widerfahren eröffnet einen kritischen Blick auf eine Soziologie, die der deutsche Disziplinengründer Max Weber einst als "?Erfahrungswissenschaft?" definiert hat. Im Experiment, so hatte Webers und Deweys Zeitgenosse der Quantenphysiker Werner Heisenberg gezeigt, konstituiert die Beobachtung und die an sie gekoppelten Untersuchungsinstrumente den Untersuchungsgegenstand und das aus ihm hervortretende Forschungsergebnis mit. Dewey griff Heisenbergs These von der Unschärferelation auf, um die praktische Fundierung und den Beitrag der Erfahrung für Erkenntnis zu plausibilisieren. Demgegenüber stellte sich Webers Erfahrungsbegriff seltsam blass und vereinseitigt dar: Seine Soziologie als "?Wissenschaft von der Erfahrung?" blieb dem kantischen Ideal einer praxisabstinenten, exogenen Beobachterposition verpflichtet. Dies trug dem Fach - und das bis in die Gegenwart - einen Theorie/Empirie-Bias ein, von dem sich vor allem die deutschsprachige Soziologie nie richtig erholt hat. Wo sie überhaupt Erfahrungswissenschaft war, so beschränkte sich die Soziologie darauf, Akteurserfahrungen zu untersuchen, ohne den Erfahrungsbegriff auch auf das eigene Forschungshandeln zu beziehen. "?Erfahrung?" blieb damit nicht nur als diffuser, sondern vor allem als methodologisch ungesättigter Begriff folgenlos für die soziologische Forschungspraxis. Dies entspricht umgekehrt dem Selbstverständnis "?Krisenwissenschaft?" zu sein - Krisen sind Probleme "?da draußen?" im Sinne von "?matter of facts?", deren soziologischen Konstitutionsaspekte keinerlei Reflexion bedürfen. Daraus resultieren drei sozialtheoretische und disziplinenpolitische Problemkomplexe:
Ausgerechnet das Fach, das sich auf die Fahnen geschrieben hat "?Erfahrungswissenschaft?" zu sein, verfügt erstens über keinen erkenntnisleitenden Erfahrungsbegriff. Dies betrifft sowohl die Ebene der phänomenalen Beschreibung (Erfahrung als Beobachtungskategorie), als auch die Ebene der Gegenstandskonstitution (Beitrag von Erfahrung zu soziologischer Erkenntnis). Die Abwesenheit eines erkenntnisleitenden Erfahrungsbegriffes wird zweitens in die Theorie/Empirie-Dichotomie verlängert und dort verschärft. Die vielfältigen historischen und rezenten Anstrengungen diese Dichotomie aufzulösen, werden drittens, zumindest im deutschen Sprachraum, immer noch weitgehend von der Theorie her reflektiert (zum Beispiel durch die Aufnahme "?praxistheoretischer?" Konzepte in den soziologischen Kanon). Dieser Zugriff wiederholt freilich nur das Problem, indem er das erkenntnistheoretische Hindernis nicht aufhebt, sondern verschiebt: Praxistheorien, die als bloße Theorien über Beobachtung von Gesellschaft fungieren, verweigern der empirischen Erkenntnis qua Deutungsverfahren das Zugeständnis epistemischen Mitspracherechts in der Theoriebildung. Dies führt im Ergebnis zu einer methodologisch und forschungspraktisch ungesättigten Theorieentwicklung, deren fehlende gesellschaftliche Relevanz durch regelmäßig wiederkehrende "?Krisendebatten?" beklagt wird. Auf der Theorieseite folgen diese dem Prinzip, Wissenschaftlichkeit über eine vermeintlich wertneutrale Position zu performieren, indem sie in größtmöglicher Abständigkeit vom empirischen Geschehen avancierte Gesellschaftskritik übt - böse Zungen sprechen von grassierender "?Feuilletonsoziologie?" ohne wissenschaftlichen Nährwert.
Die aktuellen innerfachlichen Zerwürfnisse können unterdessen nicht verhehlen, dass die Soziologie schon lange keine privilegierte Beobachterin von Gesellschaftsbeobachtern mehr ist. Diese haben sich in einem derartigen Ausmaß vervielfältigt, digitalisiert, globalisiert und transdiszipliniert, dass das Spezifikum soziologischen Wissens zunehmend undurchsichtig geworden zu sein scheint. Andererseits ist soziologisches Wissen in nahezu sämtliche gesellschaftliche Alltagsbereiche hineindiffundiert, ohne das sich ihre EntwicklerInnen darüber immer im Klaren sind. Und so wie Soziologinnen und Soziologen qua Beobachtung Erfahrungen mit Gesellschaft machen, macht Gesellschaft Erfahrungen mit soziologischen Beobachtungen. Diese mit dem Erfahrungsbegriff einhergehende Kontinuierung von Erkenntnistheorie, Sozialtheorie und Gesellschaftstheorie gilt es nunmehr von den Prämissen zu befreien, die das Fach als Krisenwissenschaft gekennzeichnet haben und den Erkenntnisbeitrag einer Soziologie als Erfahrungswissenschaft zu klären. Denn nur als Erfahrungswissenschaft wird sie ihre gesellschaftspolitische Relevanz neben den Natur- und Wirtschaftswissenschaften auf Dauer halten können. Empirisches Erfahrungswissen ist das Wissen, das die Soziologie zu der bedeutenden Brückendisziplin gemacht hat, als die sie heute in vielfältigen gesellschaftlichen Problemfeldern konsultiert und gebraucht wird. Höchste Zeit also, diese Aufgabe nunmehr in eine veritable Erfahrungswissenschaft zu übersetzen.
Der hier präsentierte soziologische Experimentalismus erhebt den Anspruch, Rückkopplungseffekte soziologischer Erkenntnisverfahren auf die Konstitution der durch sie generierten Untersuchungsgegenstände sichtbar zu machen, sowie umgekehrt die Wirkung spezifischer gesellschaftlicher und soziokultureller Problembezüge auf die Formatierung soziologischer Problemlösungsstrategien. Deweys Experimentalismus besagt, dass die Qualität von Erfahrungen dann erkenntnisstiftend wird, wenn Erfahrungsdifferenzen erzeugt werden - wie im wissenschaftlichen Experiment. Diese These hat weitreichende Konsequenzen für soziologische Erkenntnis-, Sozial und Gesellschaftstheorien. Forschungspraktisch ist sie deshalb von Bedeutung, weil Erfahrungsdifferenzen in einer von Wissenschaft und Technik durchdrungenen globalisierten Welt zugleich gemeinschaftsstiftend wie exkludierend wirken. Sie erzeugen neue soziale Kollektive, aber auch neue Kriege und Konflikte, an denen menschliche und nichtmenschliche Akteure beteiligt sind. Wie kann eine zeitgemäße Soziologie diese Erfahrungsdifferenzen adäquat erfassen?? Welchen Beitrag kann sie zur Behebung von Problemen leisten, die durch diese Erfahrungsdifferenzen ausgelöst wurden?? Will sie sich als Beobachterin von Beobachtern mit der Einspeisung von Reflexivität in die Gesellschaft zufrieden geben, oder verfolgt sie, wie dies zurzeit mit besonderer Intensität in den internationalen Science and Technology Studies umgesetzt wird, einen dezidiert transdisziplinären und interventionistischen Forschungsansatz?? Kurz: Will sie Krisen- oder Erfahrungswissenschaft sein??
Die Frage, wie solche experimentellen "?contexts of discovery?" (Peirce) transdisziplinär, das heißt zugleich und innerhalb und außerhalb von Akademia generiert und organisiert werden können, wurde bereits vor über hundert Jahren durch die US-amerikanischen Pragmatisten zur Kernfrage menschlicher Weltaneignung erklärt. Es scheint kein Zufall, dass die Renaissance dieser Philosophie in den Sozial- und Geisteswissenschaften parallel zum Aufschwung des kulturalisierten Experimentalismus stattgefunden hat. Die neue Aufmerksamkeit für das Erbe des US-amerikanischen Philosophen John Dewey hat dazu entscheidend beigetragen.
Experimentalismus gestern und heute
John Dewey wurde nach Charles Sanders Peirce, William James, und seit der Gründung des Chicago Club of Philosophy Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit George Herbert Mead und Jane Addams nicht nur zur bedeutendsten Figur der US-amerikanischen pragmatistischen Bewegung. Deweys Werk bildete darüber hinaus die unhintergehbare Referenzgröße für die im Entstehen begriffenene Soziologie als Disziplin in den USA. Albion W. Small, C. Wright Mills, Robert E. Park, W.?I. Thomas und Charles Cooley bezeugten mehrfach den Einfluss Deweys auf ihr Werk und auf die Ausbildung ihres soziologischen Professionsethos. Bedenkt man den ideellen und finanziellen Einfluss der US-amerikanischen Soziologie auf die Konsolidierungsphase der europäischen, mithin auch der deutschsprachigen Soziologie zwischen den beiden Weltkriegen und danach, kann es nur verwundern, dass Deweys Werk bislang kaum Eingang in den hiesigen Kanon der soziologischen Klassiker gefunden hat.
In den letzten Jahren fand sein Denken - nach einer langen Rezeptionspause zwischen den 1950er und den 1990er Jahren - durch die Umbruchbewegungen in den internationalen Sozialwissenschaften, die mit den Figuren des ›?cultural turn?‹, des ›?practice turn?‹ und schließlich des ›?pragmatic turn?‹ verbunden sind, ein zunehmend einschlägiges Echo. Dewey wird als Ideengeber des demokratischen Experimentalismus, der allgemeinen und der politischen Soziologie, der Kunst- und Kultursoziologie, und des wissenschafts- und sozialtheoretischen Konstruktivismus wieder- und teils neu entdeckt. Wenn aber der Pragmatismus zu James' Lebzeiten ein "?neuer Name für einige alte Denkweisen?" war, so lässt sich dieses Bonmot mit Bezug auf Deweys Experimentalismus heute umkehren: Es handelt sich, wie das vorliegende Buch zu zeigen beabsichtigt, um "?einen alten Namen für einige neue Denkweisen?". Diese "?neuen Denkweisen?" werden in Form von Testdurchläufen vorgestellt, deren Rekurs auf einen dezidiert soziologischen Experimentalismus durch einen eingangs entwickelten theoretischen Apparat bestimmt wird. Dieser Experimentalismus optiert ganz im Sinne Deweys für den Aufbau einer Soziologie als Erfahrungswissenschaft.
In seinem Buch "?Die Suche nach Gewißheit?" hat Dewey die Geschichte der philosophischen Erkenntnistheorie als eine Geschichte der Negation von Erfahrung und Praxis beschrieben. Doch mit den Erkenntnisformen der Naturwissenschaften und ihrer bahnbrechenden gesellschaftlichen Transformationskraft konnte diese Negation nicht mehr aufrecht erhalten werden. Erkenntnisformen, die ihre Ursache in einer letztlich allein auf geistigen und kognitiven Prozessen gründeten, hatten sich faktisch erledigt, so Dewey. In den Schriften Newtons und Eddingtons bis zu seinem Zeitgenossen Heisenberg erkannte er einen Auflösungsprozess empirieferner Erkenntnistheorien und die Evidenz des "?experimentellen Empirismus?" - ein, wie er zugab, "?redundanter Ausdruck?", und doch notwendig, um die von den Wissenschaftlern und Erfindern des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts realisierte Verflechtung von empirischer Erfahrung und Erkenntnis zu verdeutlichen. Deweys Auseinandersetzung mit John Stuart Mills empirischer Logik war von einem an Darwins Evolutionstheorie genährten Zweifel an einer apriorischen Auffassung der Erkenntnis durchzogen, die aus seiner Sicht vielmehr durch Komplexität, Pluralität, Nichtursprünglichkeit und eine an der Praxis prozessierenden Erfahrung zu empirischer Evidenz kommt. In der Einleitung zu den von James gelobten "?Essays in Logical Theory?" definierte Dewey das Experiment mit den Worten: "?Denken endet im Experiment und ein Experiment ist eine wirkliche Änderung einer physisch vorgängigen Situation in denjenigen Details oder Hinsichten, die nach Denken verlangen, um irgendein Übel zu beseitigen.?"
Einleitung: Experimentalismus - ein alter Name für einige neue Denkweisen Der Experimentalismus ist alt und erfindet sich immer wieder neu. Zwischen wissenschaftlicher Neugier und Objektivitätsstreben, der kulturellen Faszination für abweichende Lebensformen und politischer Krisenrhetorik steht er für vielfältige Konjunkturen. Bereits 1927 hatte der Philosoph John Dewey den Begriff des "?demokratischen Experimentalismus?" geprägt. Für ihn beruhte Erkenntnis auf Erfahrungen, die aus Krisenmomenten hervorgehen. Dieses Buch fragt, welche Schlüsse aus Deweys Sozialphilosophie für die Gegenwart gezogen werden können. Es zeigt, wie ein soziologischer Experimentalismus den Weg von einer Krisen- zu einer Erfahrungswissenschaft bereitet, die Ungewissheit als notwendigen Ausgangspunkt jeder forschenden Praxis versteht. Ende der 1950er Jahre tauchte das Experiment in besonders erhöhter Frequenz in Politik und Medien auf. "?Keine Experimente?!?" rief Konrad Adenauer 1957 einer verunsicherten westdeutschen Bevölkerung zu. Das ungewollte Experiment wurde mit der Wahl der SPD identifiziert, deren Ostpolitik in der Phase des Kalten Krieges aus Sicht der Christdemokraten zu einer politischen Destabilisierung der Bundesrepublik führen würde. Der Imperativ machte das Experiment zum politischen Gegner von normativen Setzungen, die Gewissheit und Stabilität versprachen. Nach einer Phase der relativen Rezession schossen die Koeffizienten Ende der 1980er Jahre erneut in die Höhe und bleiben seit den 1990er Jahren unverändert hoch. Mit dem Fall der Berliner Mauer wurde zweiunddreißig Jahre später das "?realsozialistische Experiment?" ein für allemal für gescheitert erklärt und neue Unsicherheiten in den Dienst des Experiments gestellt. Der Super-GAU, die Reaktorkatastrophe des Kernkraftwerkes im sowjetischen Tschernobyl 1986 lenkte die Aufmerksamkeit auf die lebensbedrohlichen Konsequenzen des wissenschaftlichen Fortschritts und damit auf Experimentalanordnungen ganz anderer Qualität. Ihre unerwünschten Nebenfolgen warfen ein alarmierendes Licht auf die Grenzen des Wissens und die unvorhersehbaren Effekte des Nichtwissens, das jedem Experiment innewohnt. Weitere Technik- und Umweltkatastrophen machten Schlagzeilen, auf die, wie zuletzt im Fall des Reaktorunfalls im japanischen Fukushima 2011, auch eine kurzfristige Neuorientierung politischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Programmatiken erfolgte. Ergänzend zu diesen an Technikkatastrophen orientierten Debatten über den Laborcharakter der Industriegesellschaften wurden die Verwerfungen des Experiments in Kontext der Kolonialgeschichte offenkundig. So bemerken Andreas Eckert und Albert Wirz: "?Schließlich dienten überseeische Beziehungen auch als Laboratorien der Moderne, in denen sich Missionare, Lehrer und Ärzte frei von Eingrenzungen der europäischen Gesellschaftsordnung ›?experimentell?‹ zu betätigen vermochten, wobei die Ergebnisse dieser Experimente häufig wiederum ganz konkrete Effekte für die Metropole haben konnten.?" Im Gegensatz zu seiner vergleichsweise fatalen Geschichte fällt heute eine durchgängig positive Deutung des Experiments in Kunst und Kultur auf. Kaum ein Medienbeitrag, der nicht den experimentellen Charakter künstlerischer Produktionsformen lobend hervorhebt; kaum eine künstlerische Selbstdarstellung, die nicht ihre unabgeschlossene, abenteuerliche, riskierte Handlungsorientierung betont, da nur diese, so die unterschwellige These, schließlich Neues zu erfinden vermag. Kritiker einer "?versteinerten?" Bürokratie- und Dienstleistungsgesellschaft heben ihre Praktiken der symbolischen Grenzüberschreitung hervor, die, wie Pierre Bourdieu das einst genannt hat, als "?Institutionalisierung der Anomie?" längst als traditionsreicher Traditionsbruch etabliert ist. Der kulturalisierte Experimentalismus erinnert damit zugleich an die Ausgangsthese des Kulturbegriffes selbst: Kultur als vom Menschen gelenkte Umwelteinwirkung, als eine Praxis also, die jedes forschende Tun grundsätzlich einbezieht. Und je nachdem, wie sicher sich Politik oder Wirtschaft im Sattel fühlen, lässt man sich auch dort auf experimentelle Aushandlungsformen politischer Willensbildung ein. Dies betrifft insbesondere das Feld der partizipativen Demokratiebewegungen, der sogenannten Bürgerwissenschaften ("?citizen science?") und solcher Organisationsformen, die eine Verbesserung zivilgesellschaftlicher Kooperationen und öffentlicher Mitbestimmung anstreben. Analog zu diesen Entwicklungen schien es naheliegend, wie es Wolfgang Krohn und Johannes Weyer in ihrem gleichnamigen Aufsatz von 1989 getan haben, anschließend an Ulrich Becks Proklamation der "?Risikogesellschaft?" (1986) die "?Gesellschaft als Labor?" zu bezeichnen. Die soziologische Reflexion der bedrohlichen Seiten des Experiments stand zu Beginn der 1960er und erst recht in den 1980er Jahren noch für die zeitdiagnostische Entfremdungsthese zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Das Experiment wurde an eine Soziologie als Krisenwissenschaft gekoppelt, welche die Aporien eines übersteigerten Technikoptimismus kritisch begleitete. Erst seit den 1990er Jahren wird diese Laborsituation auch in den Sozialwissenschaften gleichsam kulturalisiert, indem sie nicht nur die gefährdenden, sondern auch die produktiven Aspekte des Experimentierens zum Zwecke der Stärkung gesellschaftspolitischer Akteurskompetenzen reflektieren. Die Wiederentdeckung mündiger, streitbarer und kompetenter Akteure leitete den Beginn der Umstellung der Soziologie von der Krisen- zu einer Erfahrungswissenschaft ein, um die es in dem vorliegenden Buch geht. Krisenwissenschaften, die sich als "?kritische Wissenschaften?" verstehen, beharren auf einer epistemischen Außenposition, die das Beobachten von Gesellschaft von vermeintlich neutralem Boden aus unternimmt. Dies war lange Zeit die Rolle der Soziologie. Doch im Zeitalter von Klimawandel und Biodiversitätsverlust, von Digitalisierung und Globalisierung, andauernden Bürgerkriegen und Finanzkrisen haben NaturwissenschaftlerInnen, IngenieurInnen, PolitikwissenschaftlerInnen und ÖkonomInnen der Soziologie den Rang als erste Krisenwissenschaft der Moderne abgelaufen. Auf die Nebenränge der Kulturkritik geschoben, schmollt das Fach und sinniert in eigenen Krisendebatten über gesellschaftliche Relevanz und Funktion. Doch wenn es stimmt, dass wir in einem fortdauernden "?Realexperiment?" leben, stellt sich die Frage, was in dieser Situation das Alleinstellungsmerkmal des Faches ausmacht. Die kulturkritische Pose allein genügt nicht, um die epistemischen Beiträge des Experiments und seine produktiven Irritationseffekte langfristig sicher zu stellen. Niemand wusste dies besser als William James. In seiner berühmten Vorlesung von 1906 hatte James den Pragmatismus "?einen neuen Namen für einige alte Denkweisen?" genannt. Mit dieser - für James untypisch bescheiden anmutenden - Definition wollte der populäre Protagonist der pragmatistischen Bewegung die Befürchtungen seiner Kritiker dämpfen, der Pragmatismus würde sämtliche normativen Bestände der Erkenntnistheorie in der Folge von Aristoteles, Descartes und Kant abschaffen wollen. Um die Grundlagen des Pragmatismus zu verstehen, empfahl James seinen Hörern die Aufsatzsammlung seines in Duktus und Auftreten weitaus zurückhaltenderen jüngeren Kollegen John Dewey. Diese trug den Titel "?Essays in logical Theory?". Die Essays bildeten den Ausgangspunkt für das, was der mittlerweile international bekannte Dewey 1938 in "?Logic. The Theory of Inquiry?" zu einer Forschungstheorie ausprägte, die Dewey als "?Experimentalismus?" bezeichnete. Dewey orientierte sich an der Physik und nahm das Experiment wortwörtlich: als erfahrungsbasierte und operationale Umwandlung von Nichtwissen zu Wissen, inspiriert durch die instrumentellen Verfahrensweisen des naturwissenschaftlichen Experiments. Nichtwissen, also Unsicherheit und Krisensituationen, ist demzufolge nicht Problem, sondern Anstoß für problemlösendes Handeln. Deweys These, so der Ausgangspunkt der vorliegenden Unternehmung, muss eine Soziologie tangieren, die sich jenseits ihrer Funktion als Krisenwissenschaft der Moderne auch als Verwalterin gesellschaftlicher Selbstreflexion mit problemlösendem Anspruch versteht. Sie stellt eine Soziologie, die sich als "?Erfahrungswissenschaft?" versteht, vor die Herausforderung, sich auf Zustände des Nichtwissens zurückzubesinnen, von denen ausgehend neue Erkenntnisse erst exploriert werden können. Die Konsequenzen dieser These für die Soziologie können jedoch nur dann erfasst werden, wenn das Experiment nicht nur als zu beobachtende Sozialfigur, sondern zugleich als Mittel zur Generierung auch der eigenen Wissensproduktion definiert wird. Neben den daraus abzuleitenden transdisziplinären Gewinnen eines solchermaßen soziologisierten Experimentalismus wird damit auch das Desiderat nach einer Wissenschaftstheorie der Soziologie, oder allgemeiner, einer "?Wissenschaftssoziologie der Soziologie?" aufgegriffen. Damit nehme ich zugleich Bezug auf ein klassisches soziologisches Problem, das seit der Entstehungsphase des Faches einer gründlichen Auseinandersetzung harrt. Problemstellung Der Begriff des Experiments verweist im Englischen, aber auch im Deutschen semantisch auf die Verbindung von "?Erfahrung?" und "?operationalem Handeln?" in Form des Prüfens, Ausprobierens, Testens. Im Französischen gibt es sogar nur einen Begriff: "?Faire une expérience?" bedeutet zugleich "?ein Experiment durchführen?" sowie "?eine Erfahrung machen?". Diese Doppelseitigkeit von Tun und Widerfahren eröffnet einen kritischen Blick auf eine Soziologie, die der deutsche Disziplinengründer Max Weber einst als "?Erfahrungswissenschaft?" definiert hat. Im Experiment, so hatte Webers und Deweys Zeitgenosse der Quantenphysiker Werner Heisenberg gezeigt, konstituiert die Beobachtung und die an sie gekoppelten Untersuchungsinstrumente den Untersuchungsgegenstand und das aus ihm hervortretende Forschungsergebnis mit. Dewey griff Heisenbergs These von der Unschärferelation auf, um die praktische Fundierung und den Beitrag der Erfahrung für Erkenntnis zu plausibilisieren. Demgegenüber stellte sich Webers Erfahrungsbegriff seltsam blass und vereinseitigt dar: Seine Soziologie als "?Wissenschaft von der Erfahrung?" blieb dem kantischen Ideal einer praxisabstinenten, exogenen Beobachterposition verpflichtet. Dies trug dem Fach - und das bis in die Gegenwart - einen Theorie/Empirie-Bias ein, von dem sich vor allem die deutschsprachige Soziologie nie richtig erholt hat. Wo sie überhaupt Erfahrungswissenschaft war, so beschränkte sich die Soziologie darauf, Akteurserfahrungen zu untersuchen, ohne den Erfahrungsbegriff auch auf das eigene Forschungshandeln zu beziehen. "?Erfahrung?" blieb damit nicht nur als diffuser, sondern vor allem als methodologisch ungesättigter Begriff folgenlos für die soziologische Forschungspraxis. Dies entspricht umgekehrt dem Selbstverständnis "?Krisenwissenschaft?" zu sein - Krisen sind Probleme "?da draußen?" im Sinne von "?matter of facts?", deren soziologischen Konstitutionsaspekte keinerlei Reflexion bedürfen. Daraus resultieren drei sozialtheoretische und disziplinenpolitische Problemkomplexe: Ausgerechnet das Fach, das sich auf die Fahnen geschrieben hat "?Erfahrungswissenschaft?" zu sein, verfügt erstens über keinen erkenntnisleitenden Erfahrungsbegriff. Dies betrifft sowohl die Ebene der phänomenalen Beschreibung (Erfahrung als Beobachtungskategorie), als auch die Ebene der Gegenstandskonstitution (Beitrag von Erfahrung zu soziologischer Erkenntnis). Die Abwesenheit eines erkenntnisleitenden Erfahrungsbegriffes wird zweitens in die Theorie/Empirie-Dichotomie verlängert und dort verschärft. Die vielfältigen historischen und rezenten Anstrengungen diese Dichotomie aufzulösen, werden drittens, zumindest im deutschen Sprachraum, immer noch weitgehend von der Theorie her reflektiert (zum Beispiel durch die Aufnahme "?praxistheoretischer?" Konzepte in den soziologischen Kanon). Dieser Zugriff wiederholt freilich nur das Problem, indem er das erkenntnistheoretische Hindernis nicht aufhebt, sondern verschiebt: Praxistheorien, die als bloße Theorien über Beobachtung von Gesellschaft fungieren, verweigern der empirischen Erkenntnis qua Deutungsverfahren das Zugeständnis epistemischen Mitspracherechts in der Theoriebildung. Dies führt im Ergebnis zu einer methodologisch und forschungspraktisch ungesättigten Theorieentwicklung, deren fehlende gesellschaftliche Relevanz durch regelmäßig wiederkehrende "?Krisendebatten?" beklagt wird. Auf der Theorieseite folgen diese dem Prinzip, Wissenschaftlichkeit über eine vermeintlich wertneutrale Position zu performieren, indem sie in größtmöglicher Abständigkeit vom empirischen Geschehen avancierte Gesellschaftskritik übt - böse Zungen sprechen von grassierender "?Feuilletonsoziologie?" ohne wissenschaftlichen Nährwert. Die aktuellen innerfachlichen Zerwürfnisse können unterdessen nicht verhehlen, dass die Soziologie schon lange keine privilegierte Beobachterin von Gesellschaftsbeobachtern mehr ist. Diese haben sich in einem derartigen Ausmaß vervielfältigt, digitalisiert, globalisiert und transdiszipliniert, dass das Spezifikum soziologischen Wissens zunehmend undurchsichtig geworden zu sein scheint. Andererseits ist soziologisches Wissen in nahezu sämtliche gesellschaftliche Alltagsbereiche hineindiffundiert, ohne das sich ihre EntwicklerInnen darüber immer im Klaren sind. Und so wie Soziologinnen und Soziologen qua Beobachtung Erfahrungen mit Gesellschaft machen, macht Gesellschaft Erfahrungen mit soziologischen Beobachtungen. Diese mit dem Erfahrungsbegriff einhergehende Kontinuierung von Erkenntnistheorie, Sozialtheorie und Gesellschaftstheorie gilt es nunmehr von den Prämissen zu befreien, die das Fach als Krisenwissenschaft gekennzeichnet haben und den Erkenntnisbeitrag einer Soziologie als Erfahrungswissenschaft zu klären. Denn nur als Erfahrungswissenschaft wird sie ihre gesellschaftspolitische Relevanz neben den Natur- und Wirtschaftswissenschaften auf Dauer halten können. Empirisches Erfahrungswissen ist das Wissen, das die Soziologie zu der bedeutenden Brückendisziplin gemacht hat, als die sie heute in vielfältigen gesellschaftlichen Problemfeldern konsultiert und gebraucht wird. Höchste Zeit also, diese Aufgabe nunmehr in eine veritable Erfahrungswissenschaft zu übersetzen. Der hier präsentierte soziologische Experimentalismus erhebt den Anspruch, Rückkopplungseffekte soziologischer Erkenntnisverfahren auf die Konstitution der durch sie generierten Untersuchungsgegenstände sichtbar zu machen, sowie umgekehrt die Wirkung spezifischer gesellschaftlicher und soziokultureller Problembezüge auf die Formatierung soziologischer Problemlösungsstrategien. Deweys Experimentalismus besagt, dass die Qualität von Erfahrungen dann erkenntnisstiftend wird, wenn Erfahrungsdifferenzen erzeugt werden - wie im wissenschaftlichen Experiment. Diese These hat weitreichende Konsequenzen für soziologische Erkenntnis-, Sozial und Gesellschaftstheorien. Forschungspraktisch ist sie deshalb von Bedeutung, weil Erfahrungsdifferenzen in einer von Wissenschaft und Technik durchdrungenen globalisierten Welt zugleich gemeinschaftsstiftend wie exkludierend wirken. Sie erzeugen neue soziale Kollektive, aber auch neue Kriege und Konflikte, an denen menschliche und nichtmenschliche Akteure beteiligt sind. Wie kann eine zeitgemäße Soziologie diese Erfahrungsdifferenzen adäquat erfassen?? Welchen Beitrag kann sie zur Behebung von Problemen leisten, die durch diese Erfahrungsdifferenzen ausgelöst wurden?? Will sie sich als Beobachterin von Beobachtern mit der Einspeisung von Reflexivität in die Gesellschaft zufrieden geben, oder verfolgt sie, wie dies zurzeit mit besonderer Intensität in den internationalen Science and Technology Studies umgesetzt wird, einen dezidiert transdisziplinären und interventionistischen Forschungsansatz?? Kurz: Will sie Krisen- oder Erfahrungswissenschaft sein?? Die Frage, wie solche experimentellen "?contexts of discovery?" (Peirce) transdisziplinär, das heißt zugleich und innerhalb und außerhalb von Akademia generiert und organisiert werden können, wurde bereits vor über hundert Jahren durch die US-amerikanischen Pragmatisten zur Kernfrage menschlicher Weltaneignung erklärt. Es scheint kein Zufall, dass die Renaissance dieser Philosophie in den Sozial- und Geisteswissenschaften parallel zum Aufschwung des kulturalisierten Experimentalismus stattgefunden hat. Die neue Aufmerksamkeit für das Erbe des US-amerikanischen Philosophen John Dewey hat dazu entscheidend beigetragen. Experimentalismus gestern und heute John Dewey wurde nach Charles Sanders Peirce, William James, und seit der Gründung des Chicago Club of Philosophy Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit George Herbert Mead und Jane Addams nicht nur zur bedeutendsten Figur der US-amerikanischen pragmatistischen Bewegung. Deweys Werk bildete darüber hinaus die unhintergehbare Referenzgröße für die im Entstehen begriffenene Soziologie als Disziplin in den USA. Albion W. Small, C. Wright Mills, Robert E. Park, W.?I. Thomas und Charles Cooley bezeugten mehrfach den Einfluss Deweys auf ihr Werk und auf die Ausbildung ihres soziologischen Professionsethos. Bedenkt man den ideellen und finanziellen Einfluss der US-amerikanischen Soziologie auf die Konsolidierungsphase der europäischen, mithin auch der deutschsprachigen Soziologie zwischen den beiden Weltkriegen und danach, kann es nur verwundern, dass Deweys Werk bislang kaum Eingang in den hiesigen Kanon der soziologischen Klassiker gefunden hat. In den letzten Jahren fand sein Denken - nach einer langen Rezeptionspause zwischen den 1950er und den 1990er Jahren - durch die Umbruchbewegungen in den internationalen Sozialwissenschaften, die mit den Figuren des ›?cultural turn?‹, des ›?practice turn?‹ und schließlich des ›?pragmatic turn?‹ verbunden sind, ein zunehmend einschlägiges Echo. Dewey wird als Ideengeber des demokratischen Experimentalismus, der allgemeinen und der politischen Soziologie, der Kunst- und Kultursoziologie, und des wissenschafts- und sozialtheoretischen Konstruktivismus wieder- und teils neu entdeckt. Wenn aber der Pragmatismus zu James' Lebzeiten ein "?neuer Name für einige alte Denkweisen?" war, so lässt sich dieses Bonmot mit Bezug auf Deweys Experimentalismus heute umkehren: Es handelt sich, wie das vorliegende Buch zu zeigen beabsichtigt, um "?einen alten Namen für einige neue Denkweisen?". Diese "?neuen Denkweisen?" werden in Form von Testdurchläufen vorgestellt, deren Rekurs auf einen dezidiert soziologischen Experimentalismus durch einen eingangs entwickelten theoretischen Apparat bestimmt wird. Dieser Experimentalismus optiert ganz im Sinne Deweys für den Aufbau einer Soziologie als Erfahrungswissenschaft. In seinem Buch "?Die Suche nach Gewißheit?" hat Dewey die Geschichte der philosophischen Erkenntnistheorie als eine Geschichte der Negation von Erfahrung und Praxis beschrieben. Doch mit den Erkenntnisformen der Naturwissenschaften und ihrer bahnbrechenden gesellschaftlichen Transformationskraft konnte diese Negation nicht mehr aufrecht erhalten werden. Erkenntnisformen, die ihre Ursache in einer letztlich allein auf geistigen und kognitiven Prozessen gründeten, hatten sich faktisch erledigt, so Dewey. In den Schriften Newtons und Eddingtons bis zu seinem Zeitgenossen Heisenberg erkannte er einen Auflösungsprozess empirieferner Erkenntnistheorien und die Evidenz des "?experimentellen Empirismus?" - ein, wie er zugab, "?redundanter Ausdruck?", und doch notwendig, um die von den Wissenschaftlern und Erfindern des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts realisierte Verflechtung von empirischer Erfahrung und Erkenntnis zu verdeutlichen. Deweys Auseinandersetzung mit John Stuart Mills empirischer Logik war von einem an Darwins Evolutionstheorie genährten Zweifel an einer apriorischen Auffassung der Erkenntnis durchzogen, die aus seiner Sicht vielmehr durch Komplexität, Pluralität, Nichtursprünglichkeit und eine an der Praxis prozessierenden Erfahrung zu empirischer Evidenz kommt. In der Einleitung zu den von James gelobten "?Essays in Logical Theory?" definierte Dewey das Experiment mit den Worten: "?Denken endet im Experiment und ein Experiment ist eine wirkliche Änderung einer physisch vorgängigen Situation in denjenigen Details oder Hinsichten, die nach Denken verlangen, um irgendein Übel zu beseitigen.?"
| Erscheinungsdatum | 06.09.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 146 x 219 mm |
| Gewicht | 690 g |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Allgemeines / Lexika |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Allgemeines / Lexika | |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Allgemeine Soziologie | |
| Schlagworte | Dewey • Einführung • Erfahrung • Experimentalismus • gesellschaftliche Transformation • Gesellschaftstheorie • Grundlagen Soziologie • Krise • Kultursoziologie • Pragmatismus • Praxistheorie • Sozialanthropologie • Soziologische Theorie • Wissenschaftstheorie |
| ISBN-10 | 3-593-50936-9 / 3593509369 |
| ISBN-13 | 978-3-593-50936-5 / 9783593509365 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich