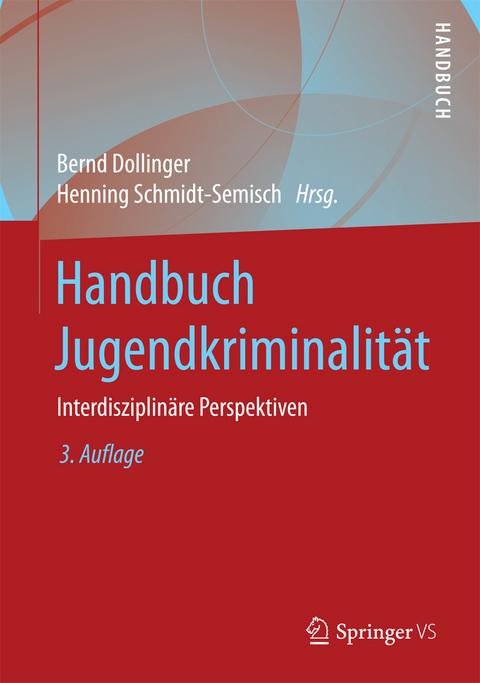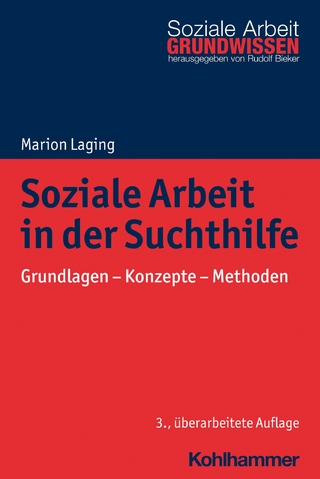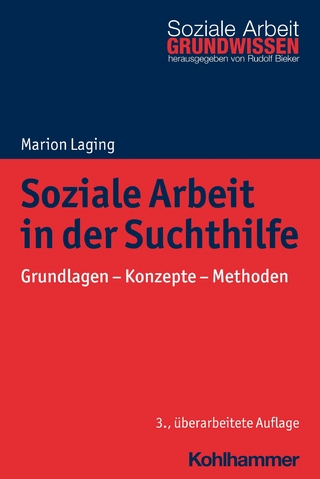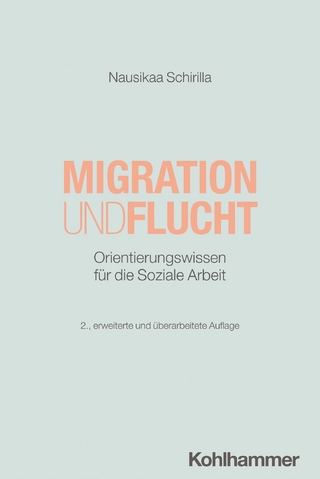Handbuch Jugendkriminalität (eBook)
XI, 806 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-531-19953-5 (ISBN)
Die Lebensphase 'Jugend' wird häufig mit Defiziten, Störungen und riskanten Verhaltensweisen assoziiert. Besondere mediale und politische Aufmerksamkeit erhalten Jugendliche dann, wenn sie mit strafrechtsrelevantem Verhalten in Erscheinung treten. In diesen publizistisch-politischen Kontexten stoßen kriminologische und sozialpädagogische Befunde und Erkenntnisse häufig auf wenig Interesse. Vor diesem Hintergrund thematisiert das Handbuch zentrale Felder der aktuellen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit jugendlicher Kriminalität. Die aktuelle Auflage wurde hierzu grundlegend neu bearbeitet und umfasst auch jüngere rechtliche Reformen u.a. zum Jugendarrest. Das Handbuch wurde insgesamt thematisch erweitert und berücksichtigt auch internationale Bezüge sowie unterschiedliche theoretische und fachliche Ansatzpunkte. Das Buch schließt deutlicher als bisher an die zunehmende Spezialisierung der Praxis und der Forschung an.
Dr. Bernd Dollinger ist Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Siegen.
Dr. Henning Schmidt-Semisch ist Professor am Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen.
Dr. Bernd Dollinger ist Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Siegen.Dr. Henning Schmidt-Semisch ist Professor am Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen.
Vorwort 5
Inhalt 7
A Einführung 12
1 Sozialpädagogik und Kriminologie im Dialog. Einführende Perspektiven zum Ereignis „Jugendkriminalität“ 13
1 Kriminalitätswissen und die Ambivalenz massenmedialer Aufmerksamkeit 14
2 Kooperationsprobleme 16
3 Die Ausrichtung des Handbuchs 20
Literatur 22
2Jugend als gesellschaftliche Institution und Lebensphase 27
1 Einleitung 27
2 Institutionalisierung von Jugend 29
3 Jugenden im Plural 33
4 Strukturwandel der Jugendphase 34
5 Jugend als soziales Problem 37
6 Fazit 39
Literatur 40
3Einstellungen der Bevölkerung gegenüber jugendlichen Straftätern Eine empirische Analyse ihrer Erscheinungsformen und Determinanten 44
1 Einleitung 44
2 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 46
3 Verbreitung und Struktur von Sanktionseinstellungen 47
3.1 Ergebnisse der städtischen Befragung 47
3.2 Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der Befunde im bundesweiten Vergleich 51
4 Soziale Determinanten der Strafeinstellungen 55
4.1 Widersprüchliche Befunde bisheriger Forschung 55
4.2 Der Einfluss sozialer Merkmale und psychosozialer Befindlichkeiten auf das Sanktionsverlangen 60
5 Schlussbemerkungen 67
Anhang: Skalierung der Strafschwere 69
Literatur 71
4Jugendkriminalität in den Medien: Opfer, Dämonen und die Mediatisierung der Gewalt 76
Zusammenfassung 76
Kinder der Finsternis: Wie Medien zuspitzen 77
Wie wirklich ist die Medienwirklichkeit ? 78
Öffentlich-rechtliche Boulevardmagazine stellen Kriminalität besonders intensiv dar 81
Berichterstattung über Jugendkriminalität: Vorwürfe an die Medien 82
Tätervideos – erst im Internet, dann im Fernsehen 84
Die Mediatisierung von Jugendgewalt 85
Die Wucht der Bilder ist stärker als die Statistik 86
Das Fernsehen zeigt vor allem tödliche und sexuelle Gewalt 88
„Mord ist einfach ein Thema für alle“ 88
Die Medien als Pranger 90
Das ideale Opfer 90
„Deutscher Täter, deutsches Opfer ist am besten“ 91
Fazit: Das Fernsehen berichtet nüchterner, als gelegentlich vermutet wird 92
Literatur 93
B Aktuelle Entwicklungen und internationale Beispiele 95
5Internationale Tendenzen des Umgangs mit Jugendkriminalität 96
1 Historische Entwicklung eines Sonderstrafrechts für Minderjährige 96
2 Die neue Unübersichtlichkeit – Trends der Jugendkriminalpolitik in Europa 97
3 Die Revitalisierung des Erziehungsgedankens in den USA: Aktuelle Reformen und der Bericht des National Research Council „Reforming Juvenile Justice: A Developmental Approach“ 99
4 Jugendstrafrechtssysteme im Vergleich und die Frage der Altersgrenzen 102
4.1 Altersgrenzen strafrechtlicher Verantwortlichkeit: Strafmündigkeit 105
4.2 Die Einbeziehung Heranwachsender in das Jugendstrafrecht – Überblick 112
4.3 Neue Erkenntnisse der Neurowissenschaften zur Reifeentwicklung: Argumente für ein Jungtäterrecht bis zum Alter von 25 Jahren 113
5 Entwicklungstendenzen bei der Sanktionierung jugendlicher Straftäter – zwischen „punitive turn“, stabiler und milderer Kriminalitätskontrolle 115
6 Ausblick 118
Literatur 120
6 Zum Umgang mit Jugendkriminalität in der Schweiz 126
Einleitung 126
Das Schweizerische Jugendstrafrecht 127
Grundprinzip des Erziehungsgedankens 128
Behördenorganisation 129
Sanktionen 129
Soziale Arbeit im Feld der Jugendstrafrechtspflege 132
Sozialarbeitende in Jugendanwaltschaften/-gerichten 132
Vollzug der Maßnahmen durch Sozialarbeitende in Jugendjustizbehörden 133
Akteure der Kinder- und Jugendhilfe 134
Maßnahmenzentren 135
Jugendkriminalität in der Schweiz im Hell- und Dunkelfeld 135
Diskussion 140
Literatur 142
7 Jugendkriminalität und der „punitive turn“ im U. S.-amerikanischen Jugendkriminalrecht 144
1 Einleitung 144
2 Entwicklung der Jugendkriminalität 145
2.1 Entwicklung im Hellfeld 145
2.2 Entwicklung im Dunkelfeld 148
3 „Punitive turn“ in der Behandlung junger Straftäter 149
3.1 Mangelnder Erfolg der Jugendgerichte 150
3.2 Synergetische Kampagne von Kriminologen, Medien, Politik 151
3.3 Wandel zur Punitivität 154
4 Punitive Verschärfung des Jugendkriminalrechts 155
4.1 Legislative Maßnahmen 156
4.2 Folgen der punitiven Reform 158
4.3 Erfolg der punitiven Verschärfungen ? 160
5 Zusammenfassung und Ausblick 161
Literatur 162
8 Von Straferwartungen zum „richtigen“ Strafenbei jugendlichen/heranwachsenden Straftätern 166
I Zur Diskrepanz von Straferwartungen und jugendstrafjustiziellen Strafen 166
II Zur Kriminalitätsentwicklung, Sanktionspraxis, Rückfallquoten 171
1 Kriminalitätsentwicklung 172
2 Sanktionspraxis 177
3 Rückfallquoten 180
III Zu den rechtlichen Vorgaben für eine „richtige“ Sanktionierung 181
1 Die Zielvorgabe 181
2 Prinzip der Subsidiarität 182
IV Zur Diversion 183
V Zur Behandlung der Heranwachsenden 184
VI Zur Anordnung bzw. Nichtanordnung der U-Haft 186
VII Zur Beschleunigung des Jugendstrafverfahrens 187
VIII Das Jugendstrafrecht braucht qualifiziertes Personal 188
Literatur 189
9Neurowissenschaftliche Befunde, ihre Wirkung und Bedeutung für ein Verständnis der Jugendkriminalität 190
Die Ausgangslage 190
Die Konjunktur der Neuro- und Biowissenschaften 191
Die neurobiologische und genetische Basis von Verhalten und Verhaltensstörungen 194
Das Problem des Determinismus zweiter Ordnung 196
Rückkopplungen zwischen sozialen und neurochemischen Prozessen 198
Das Robinsonmodell oder Interaktion als Grundkategorie 199
Literatur 201
10What works ? Who cares ? Evidenzorientierte Kriminalprävention und die Realität der Jugendkriminalpolitik 203
1 Einführung 203
1.1 Grundlegende Begriffe 203
1.2 Kausalität und Experiment 204
2 „Evidence-based Criminal Policy“ auf Grundlage experimenteller Forschung: Konzept und Kritik 205
2.1 Vorteile randomisierter Kontrollgruppenstudien 205
2.2 Experiment und soziale Wirklichkeit 205
2.3 Ergebnisse von Meta-Analysen im Jugendbereich 207
2.4 Vorannahmen experimenteller Forschung 209
2.5 Rechtliche und ethische Probleme 209
3 „Evidence-based practice“ in der US-amerikanischen Jugendkriminalpolitik ? 210
Das Panacea-Phänomen 210
Das „Junk science“-Phänomen 211
Der Woozle-Effekt 211
Boot Camps und evidenzorientierte Politik 212
Evidenzorientierung der Evidenzorientierung ? 213
Primum non nocere ? 214
Scarlet „M“ 214
Freiheitsentziehende im Vergleich zu ambulanten Sanktionen 215
4 Evidenzorientierung in Deutschland ? 216
Strafrecht und Empirie 216
Forderungen nach EBCP in Deutschland 216
Beispiele aus Deutschland 217
5 Standardisierte Risikoanalysen und Behandlungsprogramme als evidenzbasiertes Erfolgsprodukt 218
Behandlungsoptimismus bei Anwendung der RNR-Prinzipien 218
Erweiterung des Blicks 219
Literatur 219
C Theoretische Ansatzpunkte 223
11Theoretische Ansatzpunkte für die Analyse der Jugendkriminalität 224
1 Jugendkriminalität im Hell- und Dunkelfeld 224
2 Ansätze zur Analyse der Jugendkriminalität 227
2.1 Ansätze zur Beschreibung der Jugendkriminalität 227
2.2 Ansätze zur Erklärung der Jugendkriminalität 230
2.3 Gesellschaftliche Reaktionen auf Jugendkriminalität 238
3 Offene Fragen in der Analyse der Jugendkriminalität 239
Literatur 240
12Kriminalität und Kriminalitätskontrolle als Erzählungen: Positionen narrativer Kriminologien 245
1 Einleitung 245
2 Klärungen 246
2.1 Vielfältige Narrationen 246
2.2 Narration und „Wahrheit“ 246
3 Kernpunkte 248
3.1 Die strittige Frage nach Handlungsmacht 248
3.2 Kernpunkte von Narrationen 251
4 Beispiele 254
5 Fazit 257
Literatur 259
D Jugendkriminalitätin besonderen Konstellationen 263
13Jugenddelinquenz im Lebensverlauf 264
1 Der Lebenslaufansatz in den Sozialwissenschaften 265
2 Die „Age-graded Theory of Informal Social Control“ von Sampson und Laub 266
3 Weitere Ansätze der kriminologischen Lebenslaufforschung 267
4 Zur Lebenslaufforschung über Jugenddelinquenz in Deutschland 273
5 Die Bremer Lebensverlaufsstudie von Haupt-und Sonderschülern 275
6 Zur künftigen Relevanz der kriminologischen Lebensverlaufsforschung 278
Literatur 279
14Jugendkriminalität, soziale Benachteiligungen und Belastungen 283
1 Einleitung 283
2 Einblicke in den kriminologischen, sozialpolitischen und sozialarbeiterischen Diskurs 284
3 Unbestreitbare Fakten, Kontroversen und die Logik des Verdachts 287
4 Männliche Jugendliche als bedrohliche Außenseiter 290
5 Exkurs: Notwendige Klärungen 292
6 Werden die Armen und Benachteiligten tatsächlich häufiger straffällig ? 293
Literatur 295
15Jugendkriminalität in sozialen Kontexten.Zur Rolle von Wohngebieten und Schulen bei der Verstärkungvon abweichendem Verhalten Jugendlicher 299
Theoretische Erklärungsansätze 301
Empirische Erkenntnisse 304
U. S. – amerikanische Forschung 304
Europäische Forschung 305
Wechselwirkungen zwischen Jugendlichen und sozialräumlichen Kontexten 307
Familiäre Faktoren 308
Gleichaltrige 308
Geschlecht 309
Zusammenfassung 310
Literatur 311
16Jugenddelinquenz im interethnischen Vergleich 319
1 Einleitung 319
2 Delinquenz einheimischer und Jugendlicher mit Migrationshintergrund 321
2.1 Delinquenz im Hellfeld 321
2.2 Delinquenz im Dunkelfeld 324
3 Theoretische Ansätze 327
4 Resümee und Ausblick 332
Literatur 333
17Jugendliche Intensiv- und Mehrfachtäter 339
1 Einleitung 339
2 Zu den Begriffen „kriminelle Karriere“ und „Intensivtäter“ 340
3 Kriminologische und kriminalpolitische Relevanz wiederholter Straffälligkeit 342
4 Umgang mit jungen Intensivtätern aus polizeilicher Perspektive 344
4.1 „Klassische“ Intensivtäterkonzepte der Polizei 345
4.2 Neues Modell „Kurve kriegen“ 350
5 Fazit 353
Literatur 354
18Jugendkriminalität und Männlichkeit 359
Dimensionen der Kategorie Geschlecht – der Fall Männlichkeit 361
Die Strukturkategorie Geschlecht, hegemoniale Männlichkeit und männliche Herrschaft 362
Männlichkeit als soziale Konstruktion 365
Geschlecht als Diskurseffekt – Männlichkeit als performativer Akt 367
Geschlecht als Konfliktkategorie – Männlichkeit als Konfliktdynamik 368
Ausblick 370
Literatur 371
19Jugendkriminalität bei Mädchen 377
Einleitung 377
1 Geschlechtsbezogene Differenzen in der Delinquenzbelastung und Deliktstruktur 378
2 Erklärungsansätze und Befunde zum Verhältnis von Geschlecht, Delinquenz und Kriminalität bei Mädchen in der Adoleszenz 379
3 Ausblick 387
Literatur 389
E Professionalität und Kooperationenzwischen Sozialer Arbeit und Justiz 393
20Jugendgericht und Jugendstaatsanwaltschaft 394
I Entstehung und Entwicklung der Jugendgerichte und der Jugendstaatsanwaltschaften 394
II Die Stellung von Jugendrichter und Jugendstaatsanwalt im Verfahren 396
1 Jugendrichter 396
2 Jugendstaatsanwalt 396
III Das persönliche Anforderungsprofil 397
IV Empirische Befunde zur Qualifikation der Jugendjustizjuristen 399
1 Ausgangslage 399
2 Studien zu Rekrutierung, Spezialisierung sowie Aus- und Fortbildung der Jugendjustizjuristen 400
3 Die Studie von Streng zum Vergleich von Jugendstrafrechtlern mit anderen Justizjuristen 1979 – 1980 404
4 Resümee 406
V Schluss 407
Literatur 407
21Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren – Jugend(gerichts)hilfe 411
1 Grundlagen 411
2 JGH-Praxis im Wandel 417
3 Fazit und Ausblick 421
Literatur 423
22Soziale Arbeit und Polizei bei der Bearbeitung von Jugendkriminalität – Kooperation trotz Unterschiedlichkeit 427
1 Zum Verhältnis von Polizei und Sozialer Arbeit – Grundlegungen 428
1.1 Zentrale Merkmale von Polizeiarbeit 428
1.2 Zentrale Merkmale von Sozialer Arbeit 429
2 Jugendhilfe und „polizeiliche Jugendarbeit“ – Gemeinsamkeiten und Unterschiede 432
2.1 Jugendhilfe – Strukturen und Funktionen in Grundzügen 432
2.2 „Polizeiliche Jugendarbeit“ – Strukturen und Funktionen in Grundzügen 433
3 Zusammenwirken von Polizei und Jugendhilfe – Ansätze 434
4 Fazit und Ausblick 438
Literatur 439
23Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende im Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle 443
Rechtliche Grundlagen 444
Aufgaben und Funktionen 445
Organisation 448
Spezialisierte Jugendbewährungshilfe 449
Effizienz 452
Perspektiven und Probleme 455
Literatur 458
24Ambulante sozialpädagogische Angebote als Alternativen zum Freiheitsentzug 461
I Die Idee 461
II Die Gesetzgebung 465
III Die Praxis 467
IV Perspektiven 470
Literatur 472
25Untersuchungshaft und U-Haftvermeidung bei jungen Tatverdächtigen: Problemfelder und Entwicklungsbedarfe 477
1 Einleitung 477
2 Rechtliche Voraussetzungen der Verhängung von Untersuchungshaft bei Jugendlichen 477
3 Neuere statistische Daten zur Entwicklung der U-Haft bei jungen Leuten 478
4 Erkenntnisse zu den besonderen Belastungen des Vollzugs für Jugendliche 481
5 Durchführung und Alltag des U-Haftvollzugs 484
5.1 Die Organisations- und Belegungsstruktur der Jugenduntersuchungshaftanstalten 484
5.2 Unterbringung in Wohngruppen 485
5.3 Persönlichkeitserforschung nach Aufnahme in die Untersuchungshafteinrichtung 485
5.4 Erzieherische Gestaltung des Vollzugs der Untersuchungshaft 486
5.5 Subkulturelle Strukturen 488
6 Haftdauer 490
7 Möglichkeiten der Vermeidung der Untersuchungshaft nach §§ 71, 72 JGG 490
8 Kenntnisse und Einstellungen der Jugendrichter 492
9 Beteiligung der Jugendgerichtshilfe an der Haftentscheidung 494
10 Betreuung der Häftlinge durch die JGH und Aktivitäten zur U-Haftverkürzung 495
11 Zusammenfassung 496
Literatur 497
26Neuere Interventionsformen im Jugendstrafrecht 501
1 Diversion 501
1.1 Voraussetzungen und Ziel 501
1.2 Neue Rückfallstatistiken 504
1.3 Sanktionsbezogene Ergebnisse 505
2 Wirklichkeit jugendstrafrechtlicher Entscheidungen 507
2.1 Informelle Erledigungen 508
2.2 Formelle Sanktionen 508
3 Kritik an der Entwicklung der Reaktions- und Sanktionierungspraxis im Jugendstrafrecht 510
Literatur 513
F Handlungsmaximen 515
27Geltungsbereich und Sanktionenkatalog des JGG 516
I Geltungsbereich 516
1 Jugendliche 517
2 Heranwachsende 518
II Sanktionenkatalog 521
1 Der Sanktionenkatalog im Überblick 521
2 Verwirklichte rechtspolitische Bestrebungen zur Erweiterung des Sanktionenkatalogs 522
3 Weitere Reformvorhaben 527
III Schlussbemerkung 528
Literatur 528
28Der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht: Historische Entwicklungen 532
1 Einleitung 532
2 Staatliches Strafen in Zeiten ohne spezifische Jugendphase und Separierung zum Zwecke der Erziehung 533
3 Grundlagen erster Entwicklungen zur erzieherischen Sonderbehandlung junger Menschen im Strafrecht 535
3.1 Ökonomische, technische und demographische Entwicklungen und kriminalpolitische Folgen 535
3.2 Entwicklungen der theologischen und philosophischen Straflegitimationen 536
3.3 Pädagogisches Jahrhundert und Entwicklung des Erziehungsbegriffs 539
3.4 Entstehung der Jugendphase und ihrer Institutionen 542
4 Separation junger Menschen im Strafvollzug 543
5 Einzug des Erziehungsgedankens in das Strafrecht 544
5.1 Jugendgerichtsbewegung 544
5.2 Erstes Jugendgericht und erstes Jugendgefängnis 546
5.3 Vom Jugendgerichtsgesetz bis zur Jugendstrafrechtsreform von unten 547
5.4 Aktueller Stand und Reformdebatte 549
6 Schluss 551
Literatur 552
29„Prävention für alle und von Anfang an“Eine diskurstheoretische Betrachtung aktueller Präventionsdebattenim Rahmen allgemeiner gesellschaftspolitischer Entwicklungen 558
1 Einleitung 558
2 Die Ausweitung präventiver Aktivitäten in Zeiten gesellschaftlicher Transformationen 561
2.1 Von den sozialpolitischen Großprojekten der 1970er und 1980er zum Dreiklang aus Beschleunigung, Kooperation und Prävention ab den 2000er Jahren5 562
2.2 Von der politischen und ökonomischen Nützlichkeit präventiven Redens im Themenfeld der Jugendkriminalpolitik 568
2.3 Die Sicherheitsgesellschaft und der aktivierende Sozialstaat 570
3 Konsequenzen für die Präventionspraxis 573
4 Fazit – Wie kann mit Prävention „umgegangen“ werden ? 574
Literatur und Quellen 576
30Sozialpädagogische Diagnostik im Jugendstrafvollzug 587
1 Erziehung und Jugendstrafrecht 587
2 Ziele und Ansatzpunkte Sozialpädagogischer Diagnosen 589
3 Falldiagnose Anas 592
4 Zusammenfassung 597
Literatur 598
31Wiedergutmachung statt Strafe ? Restorative Justice und der Täter-Opfer-Ausgleich 599
Restorative Justice – Wiedergutmachung statt Strafe ? 601
Restorative Justice – Verfahren und Bedeutung 603
TOA in der Bundesrepublik – Entwicklung und Daten 605
Die Praxis des TOA – Grenzen und Spannungsfelder 607
Fazit 610
Literatur 611
32„Just Communities“Demokratische Partizipation im Jugendstrafvollzug 614
1 Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung 615
2 Die Beziehung von Moral und Delinquenz 617
3 Just Community: Pädagogische Programmatik und historische Anknüpfungspunkte 618
4 „Just Communities“ im Strafvollzug der USA 620
5 „Die demokratische Gemeinschaft“ – ein Modellversuch 622
6 Aktuelle Ergebnisse, Diskussion und Ausblick 624
Literatur 628
33Kritik konfrontativer Pädagogik/des AAT und die lösungsorientierte Alternative 631
Worum geht es ? 631
Was ist an konfrontativer Pädagogik/dem AAT aus vorliegender Perspektive anerkennenswert ? 632
Konfrontative Pädagogik/AAT: Problemorientiert 633
Grundsätzliche Kritik: der Problemtalk als Problem 635
Neurobiologische und kommunikative Musterbildungen 636
Lösungsorientierung als Alternative 637
Der Einzelne ist auf gerechte gesellschaftliche Verhältnisse angewiesen 640
Fazit 640
Literatur 641
34 Warum ein Anti-Aggressivitäts-Training als Maßnahme konfrontativer Pädagogik auch lösungsorientiert ist. Eine Replik auf Frank Eger 644
1 Einleitendes 644
2 Teilnahme an einem Sozialen Trainingskurs als jugendrichterliche Weisung 645
3 Das Missverständnis um den Zwangskontext 646
4 Problemorientierte Musterbildungen vs. Entlarven kollektiver Sinnmuster 648
5 Spezialprävention und Lösungsorientierung 650
6 Gewalthandeln und Habituskonzept in einer lösungsorientierten Idee 654
7 Sanktionspraxis, punitive Tendenzen und konfrontative Pädagogik 656
8 Fazit 658
Literatur 659
H Inhaftierung undgeschlossene Unterbringung 662
35Jugendarrest 663
1 Einleitung 663
2 Anordnungsvarianten des Jugendarrests 664
2.1 Urteilsarrest 664
2.2 „Nichtbefolgungsarrest“ 669
2.3 Bemessung der Dauer des Jugendarrests 671
2.4 Zusammenfassung 671
3 Quantitative Relevanz 672
4 Vollstreckung 673
5 Vollzug 674
5.1 Zielsetzung 674
5.2 Arrestvollzugsgesetze der Länder 674
5.3 Jugendarrestvollzug 675
6 Kritik und aktuelle Debatten 676
7 Zusammenfassung/Fazit 679
Literatur 679
36Recht und Rechtswirklichkeit im Jugendstrafvollzug 683
1 Einleitung 683
2 Einführung zu Recht und Jugendstrafvollzug 685
3 Rolle des Vollzugs und der Gefangenen in den Gesetzen 687
3.1 Vollzugsziel und Erziehungsauftrag 687
3.2 Mitwirkungsgrundsatz und „Chancenvollzug“ 691
3.3 Disziplinierung 694
4 Probleme des Gefangenenrechtsschutzes 695
5 Orientierung des Vollzugs am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ? 699
Literatur 700
37 Jugendstrafvollzug: Maßnahmen der Wiedereingliederung und Übergangsmanagement aus kriminal-und sozialpolitischer Sicht 704
Vollzugsziele: (Individuelle) Resozialisierung und/oder (soziale) Reintegration ? 705
Befähigungsmaßnahmen: (Be-)Handlungsbedarf und Wirkungsgrenzen 709
Eingliederungsmaßnahmen: Übergangsmanagement und Wirkungshoffnungen 713
Fazit: Verknüpfungen in Praxis und Wissenschaft 718
Literatur 719
38Strafhaft als biographischer Einschnitt. Befunde zum Jugendstrafvollzug aus der Perspektive seiner Insassen 722
1 Adoleszenz- und Autonomiekonflikte in der autoritären Institution 725
2 Zum Verhältnis von biographischer Diskontinuität und rigider Struktur 728
Autoritäts- und Autonomiekonflikte 729
Die Inhaftierung als Strukturgeber und die Erfahrung des Strukturbruchs 730
Die Bedeutung biographischer Diskontinuität 731
3 Erziehung unter Restriktion – Entwicklung unter Kontrolle ? 733
Literatur 734
39Geschlossene Unterbringung in der Kinder- und Jugendhilfe Darstellung, Kritik, politischer Zusammenhang 738
1 Gesetzlicher und empirischer Rahmen der Geschlossenen Unterbringung 738
Was ist eine Geschlossene Unterbringung und wie kann sie vom Jugend(straf)vollzug abgegrenzt werden ? 738
Rechtliche Grundlagen der Geschlossenen Unterbringung 740
Umfang und Praxis der Geschlossenen Unterbringung 741
2 Ablehnende Haltungen 744
Historische Kritik an der Heimunterbringung und der Geschlossenen Unterbringung 744
Neue Entwicklungen: Zunehmende Rigidität in der Heimerziehung 747
3 Befürwortende Haltungen 748
Haltung 1: Pragmatismus skeptischer Befürworter 748
Haltung 2: Einbettung der Geschlossenen Unterbringung in den Katalog der Jugendhilfe 748
4 Politik und Geschlossene Unterbringung 750
Punitivität und Jugendhilfe 750
Ursachen für die Befürwortung der Geschlossenen Unterbringung 751
Aktivierender Staat 753
„Life-Coaching“ als Auftrag Sozialer Arbeit im aktivierenden Staat 753
Jugendhilfe zwischen Life-Coaching und Risikomanagement 755
Literatur 757
40 Von punitiven Tendenzen, knappen Behandlungsressourcen und der Schwierigkeit, dem Einzelnen gerecht zu werden. Neuere Forschungsbefunde zum Jugendstrafvollzug 760
1 Kriminalpolitische Entwicklungen 760
2 Gewalt und Disziplinierung 765
3 Bildung und soziale (Wieder-)Eingliederung 768
4 Ausblick 773
Literatur 774
41Gegen die Logik der Inhaftierung – die Forderungen des AJK aus heutiger Sicht 780
Abschlusskommentar 791
Literatur 792
Autorinnen und Autoren 795
| Erscheint lt. Verlag | 21.8.2017 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XI, 806 S. 25 Abb., 12 Abb. in Farbe. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Sozialpädagogik |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Inhaftierung • Jugendstrafrecht • Konzepte • Kriminalpolitik • Punitivität • Soziale Arbeit • Strafverschärfungen • Theorien |
| ISBN-10 | 3-531-19953-6 / 3531199536 |
| ISBN-13 | 978-3-531-19953-5 / 9783531199535 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich