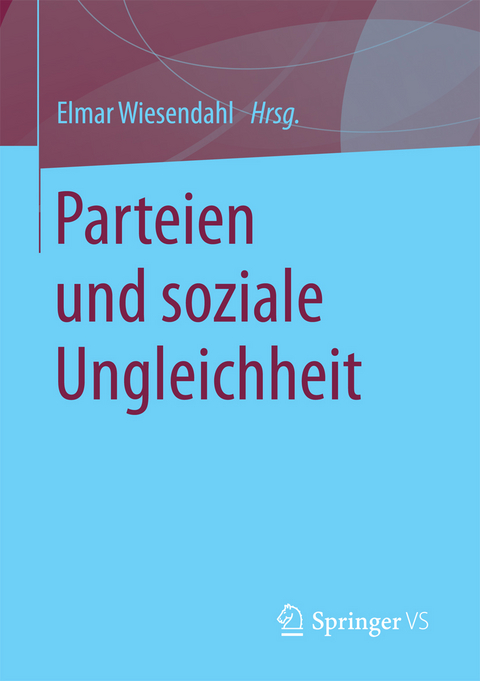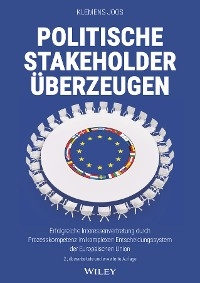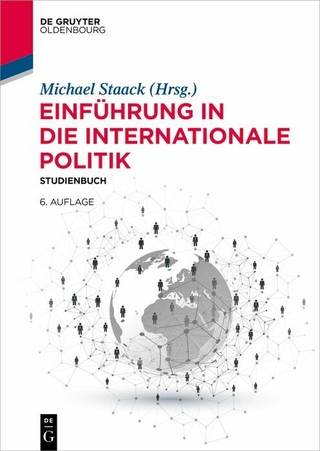Parteien und soziale Ungleichheit (eBook)
VI, 442 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-10390-3 (ISBN)
Prof. Dr. Elmar Wiesendahl lehrte Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und gehört zum Team der Agentur für politische Strategie (APOS) in Hamburg.
Prof. Dr. Elmar Wiesendahl lehrte Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und gehört zum Team der Agentur für politische Strategie (APOS) in Hamburg.
Inhalt 5
IGrundlagen 7
1 Das Verhältnis von Parteien und sozialer Ungleichheit 8
1 Einleitung 8
2 Die Wechselbeziehung zwischen gesellschaftlicher Ungleichheit und Parteien 8
3 Die Interessenrepräsentationsfunktion von politischen Parteien 11
4 Die Repräsentationsbeziehung zwischen Parteien und den von ihnen repräsentierten Gruppen 12
4.1 Repräsentation zwischen Parteien und Anhängern als Differenzbeziehung 13
4.2 Parteiengeprägte Repräsentationsbeziehung zur Anhänger- und Wählerschaft 14
5 Interessenrepräsentation und das demokratische Gleichheitsversprechen 18
6 Soziale und substanzielle Interessenrepräsentation durch Parteien 19
7 Der Wandel der gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse 21
7.1 Wirtschaftsboom und Nivellierung sozialer Ungleichheit 22
7.2 Aufstieg neuer Mittelschichten 24
7.3 Epochenwende und die Wiederkehr sozialer Ungleichheiten 25
8 Party Change und der Wandel der Interessenrepräsentation durch Parteien 28
8.1 Interessenrepräsentationslogik von Massenparteien 28
8.2 Interessenrepräsentationslogik von Volksparteien 29
8.3 Interessenrepräsentationslogik von Catch-All-Parteien 30
9 Das Sozialprofil politischer Parteien im Wandel sozialer Ungleichheit 33
10 Das Untersuchungsspektrum von Parteien und sozialer Ungleichheit 34
Literatur 38
2 Gesellschaftlicher Strukturwandel und soziale Verankerung der Parteien 44
1 Das Cleavage-Modell als umfassender Interpretationsansatz der Entwicklung von Parteidemokratien 44
2 Die Perspektive des gesellschaftlichen Wandels und seiner politischen Repräsentanz 52
3 Parteien und ihre Eliten: Die akteursorientierte Perspektive 56
4 Sozioökonomischer Wandel und Handlungsspielräume politischer Eliten 62
Literatur 64
II Angleichung und sozialer Repräsentationsverlust der Parteien und ihrer Repräsentanten 67
3 Vom Ende, und wie es dazu kam. Die SPD als Volkspartei 68
1 Einleitung 68
2 Der SPD gelingt der Spagat 71
3 Der Massenexodus der Wähler 73
4 Vermittelschichtung einer Arbeiterpartei 75
5 Zyklische Erneuerungsversuche 79
6 Volksparteilicher Sinnbedarf 84
7 Krachendes Weder-noch: die SPD, das Unten und die Mitte 85
Literatur 89
4 Die CDU. Repräsentationsgarantien und -defizite einer Volkspartei 92
1 Verzerrte Repräsentativität: Parteiorganisation und Repräsentationsdefizite 92
2 Eine parteiorganisatorische Betrachtung der Ressourcen- und Cleavage-Theorie 94
3 Daten und empirisches Vorgehen 97
4 Resultate: Soziale und innerparteiliche Konfliktlinien und ressourcenstarke Gruppen 99
5 Schluss: Möglichkeiten und Grenzen von institutioneller Einbindung 118
Literatur 120
5 Die CSU. Von der bayerischen Landvolkpartei zur bayerischen Querschnittspartei 125
1 Einleitung 125
2 CSU als empirisches Relativ 126
2.1 Ökonomische und konfessionelle Rahmenbedingungen 127
2.2 Konservative Traditionslinien des bayerischen Parteiensystems nach dem zweiten Weltkrieg 127
2.3 Parteigründungsphase der CSU 128
2.4 Parteisystemische Dominanz und ökonomische Modernisierung 129
2.5 Honoratiorenpartei – Mitgliederpartei 132
3 Parteien als Idealtypen 133
3.1 Parteientypologien in der Parteienforschung 133
3.2 Konstruktionen von Parteientypen 134
3.3 Idealtypen der „katholischen Landvolkpartei“ und der „Querschnittspartei“ 135
5 Fazit 141
4 Von der „katholischen Landvolkpartei“ hin zur „bayerischen Querschnittspartei 136
4.1 Mitgliederentwicklungen 136
4.2 Bedeutung der konfessionellen Bindung 139
4.3 Urbanität im Zuge des ökonomischen Wandels? 140
4.4 Programmatisch Öffnung 140
Literatur 143
6 Die Grünen. Vom Bürgerschreck zur bürgerlichen Partei 146
1 Einleitung: Grüne Parteien und soziale Ungleichheit 146
2 Gründung als Außenseiter mit eigenem Repräsentationsverständnis 148
2.1 Wertewandel und postmaterialistische Einstellungen 148
2.2 Organisation ohne Repräsentation 150
3 Alle Wege führen zur Mitgliederpartei 151
4 Geschlecht und Alter im Längsschnittvergleich 155
4.1 Hoher und steigender Frauenanteil 155
4.2 Alternde Partei und konvergierende Altersgruppen 157
5 Bildung, Beruf, Konfession und Migrationshintergrund im Querschnittsvergleich 161
5 Fazit 166
Literatur 167
7 Die FDP. Von der honorigen Bürgerpartei zur Partei der Besserverdiener 170
1 Verengung 173
2 Funktions- und Korrektivpartei 175
3 Soziale Aufsteiger und Individualisierung 178
4 Erweiterung 181
5 Absturz 185
6 Fazit 188
Literatur 190
8 Die Linke. Von der Regionalpartei Ost zur Partei dessozialen Souterrains? 192
1 Einleitung 192
2 Repräsentationsanspruch der Linken 194
3 Organisationale Grundlagen der Repräsentation bei der Linken 196
4 Datenbasis und methodisches Vorgehen 199
5 Repräsentationswirklichkeit der Linken 200
5.1 Repräsentation von Ost- und Westdeutschen 200
5.2 Repräsentation von Frauen und Männern 203
5.3 Repräsentation von Altersgruppen 206
5.4 Repräsentation von Bildungsgruppen 208
5.5 Repräsentation von Berufsgruppen 211
5.6 Repräsentation von Gewerkschaftern 214
6 Fazit 217
Literatur 219
9 Je kleiner, desto feiner… Mitgliederschwund und sozialer Repräsentationsverlust der Parteien 223
1 Parteimitgliedschaften und soziale Ungleichheiten 223
2 Angleichung und Abgrenzung – das Sozialprofil der Mitglieder 225
3 Auf der Suche nach Erklärungen – der Schwund der Mitgliedschaften 230
3.1 Daten und Befunde zu den rückläufigen Mitgliederzahlen 230
3.2 Erklärungsansätze der Parteienforschung für den Niedergang der Mitgliedschaften 231
3.3 Soziale Ungleichheit als Ursache des Mitgliederschwunds 233
4 Modernisierung oder Niedergang? Parteien und Mitglieder im Wandel 235
5 Bilanz und Ausblick 237
Literatur 238
10 Soziale Ungleichheit und das Wahlbeteiligungsgefälle 242
1 Einleitung: Die Wahl als niedrigschwelliges Mittel politischer Partizipation? 242
2 Soziale Ungleichheit und Wahlbeteiligung: Eine (soziologische) Begriffsbestimmung 244
3 Soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Teilhabe 245
4 Soziale Ungleichheit, Wahlen und Wahlbeteiligung 246
5 Wahlbeteiligung und Motive der Nicht-Wahl: Diskussion empirischer Analysen 248
6 Soziale Ungleichheit und die Partizipation an Wahlen: Ein Ausblick 252
Literatur 254
11 Soziale Herkunftslinien von Abgeordneten im Wandel 257
1 Einleitung 257
2 Repräsentationstheoretischer Stellenwert sozialer Merkmale von Abgeordneten 260
3 Soziale Herkunftslinien der Parlamentsvertreter von Parteien 264
4 Parteien und ihre Rekrutierung verantwortlich für Repräsentationsungleichgewichte? 273
5 Fazit und Ausblick 276
Literatur 278
12Politische Eliten und soziale Ungleichheit 284
1 Einleitung 284
2 Elitenrekrutierung und soziale Ungleichheit in Deutschland, den USA und Europa 285
3 Die Einstellung der politischen Elite Deutschlands zu Steuern, Staatsverschuldung und Finanzkrise 288
4 Wie geht es weiter mit der politischen Elite? 294
Literatur 296
III Interessenrepräsentation sozialer Ungleichheit durch Parteien 297
13Parteien und die Altenrepublik Deutschland 298
1 Einleitung 298
2 Senioreninteressen als Seismograph in der alternden Gesellschaft 300
3 Konflikt der Zukunft? Parteienwettbewerb in der alternden Gesellschaft 303
3.1 Lebenszyklus, Kohorten und Perioden als Faktoren im Parteienwettbewerb 304
3.2 Alt und Jung – eine Scheidelinie im Wettbewerb der Parteien? 305
4 Die Alterung der Parteiorganisationen 310
4.1 Die alternden Parteiorganisationen in Zahlen 310
4.2 Innenansichten gealterter Volksparteien 313
4.2.1 Unterrepräsentanz von Alt und Jung in Parteien und Parlamenten 314
4.2.2 Die Macht der vielen Älteren 316
4.3 Eine Jugendquote als Instrument für altersspezifische Chancengleichheit? 317
5 Schlussbetrachtung 319
Literatur 320
14 Die Parteien und die Repräsentation der Ostdeutschen 325
1 Einleitung: Gibt es „den Osten“, und was ist charakteristisch für ihn? 325
2 Theorie und Vorgehensweise 328
3 Die Ostdeutschen in den Parteien: ein Blick auf die Mitglieder 330
4 „Standing for other“: personelle Repräsentation der Ostdeutschen in Führungsgremien 333
5 „Substantive acting for“: Ostdeutschland in den Parteiprogrammen 341
5.1 Wiedervereinigungsprozess und gleichwertige Lebensverhältnisse 343
5.2 Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 346
6 Fazit 347
Literatur und Quellen 349
15 Die Repräsentation von Armut durch politische Parteien. Voraussetzungen, ein theoretisches Analysemodell und empirische Untersuchungen im Lichte des Bundestagswahlkampfs 2013 352
1 Einleitung 352
2 Parteien und Repräsentation 355
3 Sozialpolitische und sozialstrukturelle Aspekte von Armutspolitik im Parteienwettbewerb 360
4 Ein armutspolitisches Konfliktmodell als Analysematrix 363
5 Armutspolitik in Deutschland: Einführung in die empirische Analyse 365
6 Empirische Deutungsmusteranalyse des Bundestagswahlkampfes 2013 367
6.1 Einführung 367
6.2 Die Armutspolitik der CDU/CSU 368
6.3 Die Armutspolitik der SPD 370
6.4 Die Armutspolitik von Bündnis 90/Die Grünen 371
6.5 Die Armutspolitik der Partei Die Linke 374
6.6 Die Armutspolitik der FDP 375
6.7 Armutspolitische Verortung der einzelnen Parteien in die entsprechende Matrix 377
7 Fazit und Ausblick 378
Literatur 379
16 Parteien und die politische Exklusion des Prekariats. Der Disparität?smodus der Issuefähigkeit? 383
1 Einleitung 383
2 Disparitätstheorien 385
3 Die ungleich verteilte Issuefähigkeit von Interessen 390
4 Was tun gegen mangelnde Issuefähigkeit? 397
Literatur 402
17 Parteien in gehobener Gesellschaft oder die halbierte Demokratie 405
1 Einleitung 405
2 Mittelschichtendominanz und soziale Schließung der Parteien 406
2.1 Die Bedeutung der Mittelschichtverankerung der Parteien 408
2.2 Die Ausgrenzung unterer Gesellschaftsschichten 410
3 Mittelschichtparteien als Aufstiegskanal für die politische Managerklasse 412
4 Elektorale Berufspolitikerparteien und die Vermarktlichung der Wählerbeziehung 414
5 Parteien in der Repräsentationskrise 417
5.1 Die Selektivität der Repräsentationsbeziehung 417
5.2 Ausmaß und Hintergründe selektiver Interessenrepräsentation 420
6 Auf den Weg in die halbierte Demokratie 424
Literatur 428
Autorenverzeichnis 432
| Erscheint lt. Verlag | 15.12.2016 |
|---|---|
| Zusatzinfo | VI, 442 S. 30 Abb., 9 Abb. in Farbe. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Vergleichende Politikwissenschaften |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | German Politics • Repräsentation • Selektivität • Sozialprofil • Strukturwandel • Verankerung |
| ISBN-10 | 3-658-10390-6 / 3658103906 |
| ISBN-13 | 978-3-658-10390-3 / 9783658103903 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich