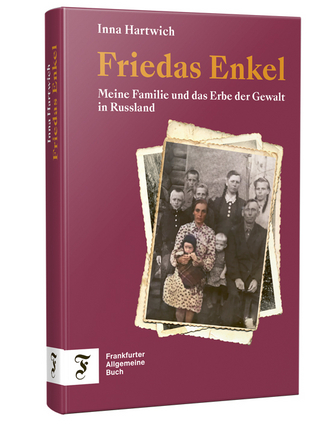Damals nach dem Krieg
DVA (Verlag)
978-3-421-04342-9 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen, Neuauflage unbestimmt
- Artikel merken
Schwarzmarkt, Besatzung, Trümmerfrauen. Betrachtet man die Jahre unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs, so vermitteln sie Chaos und Elend, und gleichzeitig hat man den Eindruck: So offen waren Deutschlands Gegenwart und Zukunft nie. „Damals nach dem Krieg“ nimmt diese ersten Jahre vor der Gründung der Bundesrepublik und der DDR in den Blick.
Hätte sie auf ihrem Heimweg von einer Vorstellung im Deutschen Theater nicht die Ruine des Reichstags entdeckt, so eine Berlinerin im Sommer 1946, sie hätte sich in den Trümmern ihrer Heimatstadt, wo weder Straßen noch Gebäude erkennbar waren, hoffnungslos verirrt. Die Trümmerlandschaft ist das zentrale Merkmal dieser schwer fassbaren Zeit kurz nach Kriegsende. Sven Reichardt und Malte Zierenberg eröffnen dem Leser einen eindrucksvollen und lebendigen Blick auf die Alltagsgeschichte der Nachkriegszeit und lassen zahlreiche Zeitzeugen zu Wort kommen. Wie gestalteten sich die ersten Begegnungen zwischen der deutschen Bevölkerung und den Soldaten der alliierten Armeen? Wie sah der Alltag aus? Und wie ging man mit den »Schatten der Vergangenheit«, der deutschen Schuld, um? Die Menschen waren hin und her gerissen zwischen der »Bewältigung« des Vergangenen, einem alltäglichen »Weitermachen« und der Furcht, aber vielleicht auch der Hoffnung, die mit einer ungewissen Zukunft verbunden waren.
Sven Reichardt, geboren 1967, ist seit 2003 Juniorprofessor für Deutsche Zeitgeschichte in Konstanz. Er ist Mitherausgeber und Redakteur der Zeitschrift "Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus". Momentan ist er Gastprofessor an der Rutgers Univer
Vorwort
Dieses Buch trägt den Titel Damals nach dem Krieg. Es schildert das Leben der Deutschen in einer Zeit, die man auch als Zwischenzeit bezeichnen könnte. Denn nach dem Krieg bedeutet auch vor der Geschichte von Bundesrepublik und DDR. Die Jahre zwischen Kriegsende und dem Gründungsjahr 1949 sind in diesem Sinne oft als Übergangsphase, als ein chaotisches Dazwischen beschrieben worden. Irgendwie »weitermachen« und »durchwursteln« - diese Alltagsvokabeln gelten als Kennzeichen einer Zwischenzeit, in welcher der Krieg und seine Folgen immer noch, die Zukunft und ein Neuanfang hingegen nur schemenhaft sichtbar sind.
Sieht man genauer hin, dann lösen sich die scheinbar klaren Zäsuren auf, bleibt der Krieg auch über das Jahr 1949 hinaus das bestimmende historische Ereignis der jüngsten deutschen Geschichte. Sehr bald nach dem Ende des Krieges werden aber auch die ersten Entwicklungslinien der beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften erkennbar.
Das vorliegende Buch nimmt diesen doppelten Charakter der Zeit »damals nach dem Krieg« ernst. Indem es sowohl die wichtigen Stationen der deutschen Nachkriegsgeschichte darstellt als auch den vielen »kleinen« Geschichten der Jahre nach 1945 nachspürt, verknüpft es Alltags-, Politik- und Wirtschaftsgeschichte miteinander.
Autoren - und vor allem die von Überblicksdarstellungen - leben auch von den Büchern anderer Autoren. Glücklicherweise konnten wir auf eine breite Literatur zurückgreifen. Das Verzeichnis am Ende des Buches kann dabei nur einige Hinweise auf die aus unserer Sicht wichtigsten Publikationen geben.
New York und Berlin im November 2007 Sven Reichardt und Malte Zierenberg
Als der Krieg zu Ende war - Erste Begegnungen und Neuanfänge
Erst mussten die Waffen schweigen und die zum Teil bis zur letzten Patrone verbissenen Widerstand leistenden deutschen Soldaten entwaffnet werden. Erst dann waren erste Begegnungen zwischen den Siegern und den Verlierern des Zweiten Weltkriegs möglich, die Schritte auf dem Weg in einen immer noch prekären Frieden bedeuteten. Denn nur ohne eine Waffe in der Hand konnten sich Deutsche mit den alliierten Soldaten treffen, um sich mit Gesten und Zeichen zu verständigen, Sachen miteinander zu tauschen oder Geschenke entgegenzunehmen. Ein Bild von der Entwaffnung deutscher Wehrmachtsoldaten durch britische Truppen, wie sie die Abbildung zeigt, sagt vielerlei aus. Es steht für die Erfahrung der Niederlage der Deutschen, für das Gefühl, nicht in erster Linie von einem diktatorischen Regime befreit, sondern von den Alliierten besiegt worden zu sein. Für die meisten Deutschen war das Kriegsende eine niederschmetternde Erfahrung. Viel zu ergeben waren sie der nationalsozialistischen Führung in einen Krieg gefolgt, der Abermillionen Menschen das Leben kostete und durch nichts zu rechtfertigen war. Befreiung? Für manche ja, aber die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hatte entweder selber mitgespielt im braunen Morddrama oder aber zumindest »hingeschaut und weggesehen«, wie der Historiker Robert Gellately dieses Verhalten der Deutschen gegenüber den Verbrechen des Regimes benannt hat. Die Leere im Gesicht des Soldaten, die in der Abbildung zu erkennen ist, steht für die zwischen Erschöpfung, Resignation, Enttäuschung und möglicherweise auch Schuldbewusstsein schwankenden Empfindungen vieler Deutscher damals, als der Krieg zu Ende war.
Das Leben, das nun begann, war geprägt von Ungewissheit. Ungewissheit darüber, wie es jetzt weitergehen sollte. Wer wusste schon, was die nächsten vierundzwanzig Stunden bringen würden in einem Alltag, in dem alles immer wieder infrage gestellt wurde: die Ernährung, das Dach über dem Kopf - kurz: das Überleben. Doch andererseits kam dieser Fixierung auf einen schmalen Zukunftshorizont schon sehr bald auch eine entlastende Funktion zu. Denn wer sich immer nur mit dem Morgen beschäftigen konnte, der musste sich anscheinend nicht so sehr um das Gestern kümmern. Zum Symbol der Zeit wurden jetzt jene »Trümmerfrauen«, die in den Straßen der zerstörten Städte den Schutt beseitigten. Wegfegen, weitermachen? Dass das nicht gelingen konnte, wissen wir heute. Im Nachhinein lässt sich das leicht sagen. Aber wie war die Situation damals nach dem Krieg - als die Waffen schwiegen, die Sieger die Besiegten entwaffneten und alles irgendwie auf »Null« gestellt zu sein schien? Davon handelt dieses Buch.
Die Nachkriegszeit als »offene« Geschichte
Für die meisten Zeitgenossen ist das Kriegsende die einschneidendste Erfahrung ihres Lebens - nach Jahren quälender Unruhe, nervenzerreißender Angst und Verwüstung ist der Wunsch nach Schlaf, ohne ständig durch heulende Sirenen aufgescheucht zu werden, im Augenblick das einzige Verlangen. Doch niemand kann lange ruhen, wenn der Magen knurrt, wenn hohlwangige Kinder mit dunklen Augenhöhlen einer Mutter, die allein verantwortlich ist, den Hunger unschuldiger Mäuler zu stillen, Angst einflößen. Irgendwo, vielleicht in der Gefangenschaft, vegetiert der Vater. Nachrichten sind lange schon abgerissen.
Fragen über Fragen drängen sich auf: Wie soll es jetzt bloß weitergehen? Wo bekomme ich Brot und die anderen Dinge des täglichen Bedarfs her? Wo werde ich wohnen und arbeiten? Was ist mit meiner Familie? Was passiert mit uns Deutschen? Wie werden die Sieger mit uns umgehen? Werden wir bestraft werden?
Der Krieg bleibt noch lange im Alltag präsent. Mit dem Kriegsende sind die Deutschen vor alte und neue Probleme gestellt.
Aufwachen in Berlin im Mai 1945: »Schlaftrunken fahre ich hoch. Was ist los? Fliegeralarm? Nein, der Wecker. Mühsam ordne ich meine Gedanken. Es gibt keinen Fliegeralarm mehr, der Krieg ist zu Ende. Aber warum klingelt der Wecker? Richtig, ich will mich ja ganz früh beim Kuhstall nach Milch anstellen. Mein kleiner Junge schläft noch, als ich mich leise aus der Wohnung schleiche. Morgen werde ich mich auch um Brot bemühen, kann dann aber gleichzeitig keine Milch heranschaffen. Die ganze Zeit in Sorge, ob der Junge wohl inzwischen wach geworden ist und vielleicht Angst hat, wenn er die Wohnung leer vorfindet. Zu viel haben die Kinder in den letzten Wochen verkraften müssen. Gottlob, er wird erst wach, als ich aufschließe. Nun beginnt unser gemeinsamer Tag. Es gibt weder Wasser, Gas noch Strom. Nach dem Frühstück Wasserholen. Es ist ein herrlicher Maitag, ich nehme den Kleinen mit. Die Kinder spielen. Gesprächsfetzen dringen an mein Ohr. Es ist immer dasselbe Thema: Über die letzten Kriegstage, wie es war, als die ersten Russen auftauchten, als es mit Vergewaltigungen und Plünderungen begann.« Die Frau, die das erzählt, heißt Elisabeth Jankowski, war damals fünfundzwanzig Jahre alt und schreibt dreißig Jahre nach Kriegsende ihre Eindrücke unter dem Titel nieder: »Tag aus dem Leben einer jungen Frau im Mai 1945«.
Elisabeth Jankowski hält ihre persönlichen Erinnerungen an das Kriegsende fest, doch ihre Erfahrungen sind in vielerlei Hinsicht typisch für die Allgemeinheit. Die Sorge um das tägliche Überleben ist allgegenwärtig - um Milch und Brot, die Angst um das Kind, um das Wohlergehen der Familie oder was davon nach Kriegsende noch übrig geblieben ist. Dann die ersten Begegnungen mit den Siegern: Worüber wird gesprochen, worüber geschwiegen, wie geht man mit Gewalt und wie mit den Besatzern um? Da ist oft von den »mongolischen« Sowjetsoldaten oder »Neger-Amis« die Rede.
Wie geht es jetzt weiter? Das ist überhaupt die drängendste Frage nach dem Krieg. Denn der Krieg ist zwar aus. Aber würde das Leben je wieder in einigermaßen »normalen« Bahnen verlaufen? In den Wochen und Monaten nach Kriegsende leben die meisten Deutschen in einem ständigen Ausnahmezustand. Nahrung, Obdach, Familie, ein geregelter und friedlicher Alltag - alles, was Sicherheit vermitteln kann, ist bedroht. Die Probleme nehmen kein Ende.
Als der Krieg im Mai 1945 zu Ende ist, beginnt die Besatzungszeit, und mit ihr ein Leben in den Trümmern jenes Weltkriegs, den die Deutschen angefangen haben. Die Trümmer - und mit ihnen auch ein Stück eigener Vergangenheit - muss man erst beiseiteräumen, ehe man mit dem Wiederaufbau beginnen kann.
Man kennt die Bilder: Frauen bei Aufräumarbeiten, die bald als »Trümmerfrauen« zu einer Chiffre unserer Erinnerung werden, zurückkehrende Kriegsgefangene, zerlumpt und abgemagert sowie erschütternde Aufnahmen aus den befreiten Konzentrationslagern. Und jeder von uns hat wohl schon einmal die Luftaufnahmen der zerstörten deutschen Städte betrachtet ebenso Fotos von Besatzungssoldaten, die eine Schachtel Zigaretten gegen eine Kamera eintauschen, die Ruine der Reichskanzlei in Berlin oder jenes Bild, auf dem Kinder und Alte sich um den Kadaver eines toten Pferdes scharen.
In der unmittelbaren Nachkriegszeit scheint alles nebeneinander stattzufinden: Das Elend und der Hunger stehen neben der Freude über das Kriegsende oder über ein unverhofftes Wiedersehen, der Tod neben dem Anfang eines neuen, noch unsicheren Lebens, die Idylle eines vergleichsweise friedlichen Tagesablaufs in den Trümmerlandschaften neben dem Chaos.
Ein roter Faden, ein wenig Ordnung sind in diesem Durcheinander schwer auszumachen. Doch der Blick zurück kann die Unordnung nicht ertragen. Es gibt eine Sehnsucht nach Ordnung, nach einem positiven Verlauf der Geschichte und einem »Happy End«. Wie wurden wir, was wir sind? Um darauf eine Antwort zu finden, rücken wir uns die Dinge häufig zurecht. Das Nebeneinander der vielen Bilder von Elend und Chaos verlangt nach einer Erzählung, die den Schrecken bannt, indem sie ihn zur Episode verkürzt. Der berühmteste Begriff für diesen erzählerischen Trick lautet »Stunde Null«.
Der Mythos von der »Stunde Null« beschreibt das Chaos der unmittelbaren Nachkriegszeit als schnell überwundenen Anfangspunkt. Von hier aus erscheint dann im Rückblick alles irgendwie logisch, ergibt sich das eine folgerichtig aus dem anderen. Die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik wird dadurch erkennbar und erklärbar, jene Zwischenphase der Ungewissheit und Unordnung hingegen ausgeblendet. Und deshalb folgen auf Kriegsende und Besatzung in vielen Darstellungen der Zeit nach 1945 schnell die ökonomischen und politischen Weichenstellungen: die Währungsreform 1948, die Gründungen von DDR und
Bundesrepublik 1949, das Wirtschaftswunder von Mitte der fünfziger bis Anfang der sechziger Jahre. Es ist durchaus berechtigt, die Nachkriegsjahre als Zeit einer schnell überwundenen Phase des Mangels und der politischen Unordnung anzusehen - auch wenn die Historiker das »Wunder« des raschen wirtschaftlichen Aufstiegs, im Westen deutlicher als im Osten, relativiert und auf die insgesamt doch recht günstigen Ausgangsbedingungen der deutschen Wirtschaft nach Kriegsende hingewiesen haben. Dennoch sind die Dynamik der Entwicklung und die Leistungen der Zeitgenossen beeindruckend. Doch Geschichte ist offen - ganz gleich, ob es um die Entscheidungen der Siegermächte am Konferenztisch in Potsdam oder um die »kleinen«, privaten Schicksalsfragen der Leute auf der Straße geht. Als der Krieg zu Ende ist, weiß niemand genau, wie es weitergehen wird.
Viele Kriegsenden
Als der Krieg zu Ende war - das sagt sich so leicht. Aber: Was hat das Kriegsende für die Zeitgenossen eigentlich bedeutet? Wie haben sie es erlebt? Haben sie es überhaupt als solches registriert? Und wenn ja, was haben sie darüber gedacht, und was haben sie empfunden? Schon die nächstliegende, ganz einfache Frage nach dem Zeitpunkt des Kriegsendes ist komplizierter, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Denn bereits hier gibt es nicht nur eine Antwort. Historiker haben lange dazu geneigt, vor allem in »großen« ereignisgeschichtlichen Zusammenhängen zu denken und den Krieg deshalb mit den Kapitulationserklärungen der Wehrmacht am 7. bzw. 9. Mai 1945 in Reims und Berlin-Karlshorst enden zu lassen. Mit der Unterschrift von Generalfeldmarschall Keitel auf der Kapitulationsurkunde war der Krieg offiziell vorbei. Neben dieser offiziellen Version vom Kriegsende steht jedoch eine Vielzahl »kleiner« oder privater, dabei aber keineswegs weniger wichtiger, persönlicher Kriegsenden.
Wann und wie der Einzelne das Kriegsende und die folgenden Tage und Wochen erlebt, mit welchen Ängsten oder auch Hoffnungen, das hängt ganz von der individuellen Situation ab. »Wir wuchsen auf zwischen Trümmern und Schutt, in unser'm Berlin war einfach alles kaputt«, reimt eine Zeitzeugin, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufwächst, »mit fast allen Nachbarn war man per>Du<, aus'm Fenster sah'n sie beim Spielen uns zu.« Diese Schilderung einer idyllischen Zeit, in der man unter Nachbarn solidarisch ist und Kinder fröhlich in den Ruinen spielen können, deckt sich nicht mit den Erlebnissen, von denen andere berichten. Am 7. Mai notiert eine junge Frau aus Berlin in ihr Tagebuch: »Weiter, der neue Tag. Es ist so sonderbar, ohne Zeitung, ohne Kalender, ohne Uhrzeit und Ultimo zu leben. Die zeitlose Zeit, die wie Wasser dahinrinnt.« Sie weiß nichts von der Kapitulation. Die »große Geschichte« spielt in diesen Tagen nur wenige Kilometer entfernt in Karlshorst. Aber das ist weit weg. Besucher, die mittags vorbeikommen, brauchen für die Strecke aus dem Berliner Westen zwei Stunden - sie gehen zu Fuß, der öffentliche Verkehr ist zusammengebrochen. Das Leben schrumpft auf enge Räume zusammen. Die Welt da draußen ist gefährlich, die Stadt über weite Strecken eine einzige Trümmerlandschaft.
Berlin stellt keinen Einzelfall dar. Den größten Schaden richten neben dem Straßen- und Häuserkampf der letzten Kriegstage die Bombardierungen an. Insgesamt sind am Ende 131 deutsche Städte von den Luftangriffen der Alliierten gezeichnet. Dabei trifft es die »Reichshauptstadt« besonders schwer. Immer wieder nehmen Bomber der britischen Royal und der US-Air Force Kurs auf die größte Stadt des Reichs. Aber auch Braunschweig, Ludwigshafen und Mannheim, Kiel, Frankfurt am Main und Köln sowie Hamburg und Münster sind regelmäßig Ziel der feindlichen Bomber. Einzelne Angriffe erlangen traurige Berühmtheit. Die Royal Air Force und die United States Army Air Forces fliegen in vier aufeinanderfolgenden Wellen vom 13. bis 15. Februar 1945 Luftangriffe auf Dresden. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar sterben schätzungsweise 35 000 Menschen, unter ihnen viele Flüchtlinge, die in der Elbmetropole Station auf ihrem Weg nach Westen machen. Die Stadt wird zum Ziel der größten und verheerendsten Angriffswelle alliierter Bomber im Zweiten Weltkrieg.
Ziel der alliierten Luftangriffe sind - neben der Zerstörung kriegswichtiger Infrastrukturen - auch die »Volksgenossen«, das heißt jene, die nach Vorstellung der Nationalsozialisten »deutschen oder artverwandten Blutes« sind. Ihr Kampfeswille soll gebrochen werden. Doch die Rechnung des so genannten »moral bombing«, das die Moral der Stadtbewohner schwächen soll, geht nicht auf. Über die Gründe für dieses Scheitern spekuliert eine Beobachterin, Ursula von Kardorff, damals Redakteurin der Deutschen Allgemeinen Zeitung, in ihrem Tagebuch: »Vier Nächte ungestört schlafen, das ist heute ein Geschenk. [...] Lieber nicht nachdenken, wie alles noch werden kann. [...] In unser Haus ging beim letzten Angriff eine Mine. Nun ist nichts mehr erhalten, auch die anderen sieben Wohnungen, in denen wir in Berlin gewohnt haben, stehen nicht mehr. Ich fühle eine wilde Vitalität, gemischt mit Trotz, in mir wachsen, das Gegenteil von Resignation. Ob es das ist, was die Engländer mit ihren Angriffen auf die Zivilbevölkerung erhoffen? Mürbe wird man dadurch nicht. Jedermann ist mit sich beschäftigt. Steht meine Wohnung noch? Wo bekomme ich Dachziegel, wo Fensterpappe? Wo ist der beste Bunker? Die Katastrophen, die Nazis wie Antinazis gleichermaßen treffen, schweißen das Volk zusammen. Dazu gibt es Sonderrationen nach jedem Angriff: Zigaretten, Bohnenkaffee, Fleisch.>Gib ihnen Brot, und sie hangen dir an.<«
Zu den am meisten zerstörten Großstädten gehören Dortmund, Duisburg, Kassel, Kiel, Ludwigshafen, Hamburg, Bochum, Braunschweig, Bremen und Hannover. Hier liegen die Wohnungsverluste zwischen 50 und 66 Prozent. Am stärksten trifft es die Domstadt Köln. Nach dem Ende des Luftkriegs sind dort 70 Prozent aller Wohnungen unbewohnbar oder gar vollends zerstört.
Insgesamt beläuft sich die Zahl der Wohnungsverluste allein in den Westzonen auf etwa 2,25 Millionen oder 20 bis 30 Prozent des gesamten Bestands. Nun leben viele Menschen in Kellern, Bunkern, Notunterkünften oder auf der Straße. In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) leben im Jahr 1946 durchschnittlich 4,2 Personen in einer Wohnung. Die Deutschen wohnen jetzt auf engem Raum. Im Westen liegt die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf im Jahr 1950 bei nur im Durchschnitt einigermaßen erträglichen 15 Quadratmetern. Und der Wohnungsmangel wird lange anhalten. Erst dreißig Jahre nach Kriegsende gibt es in der Bundesrepublik genauso viele Wohnungen wie Haushalte. Eine ganze Generationenspanne lang bleiben die eigenen vier Wände für manche ein Wunschtraum. In der DDR wird die Unterversorgung mit Wohnraum trotz einer rückläufigen Bevölkerungszahl eine dauerhafte Realität bleiben. Am Kriegsende haben viele Stadtbewohner, die ihre eigenen vier Wände, ihre Wohnungseinrichtungen und ihr persönliches Eigentum verloren haben, das für ein »normales« Leben notwendige Sicherheitsgefühl verloren.
Die Zerstörungen machen auch auf die »Katastrophentouristen« der Nachkriegszeit einen verstörenden Eindruck. Über das Bild, das sich ihm in Frankfurt am Main bietet, notiert der junge Schweizer Schriftsteller Max Frisch: »Die Ruinen stehen nicht, sie versinken in ihrem eigenen Schutt (...). So stapft man umher, die Hände in den Hosentaschen, weiß eigentlich nicht, wohin man schauen soll.«
| Erscheint lt. Verlag | 30.1.2008 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Hardcover Non-Fiction |
| Zusatzinfo | mit Abb. |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 135 x 215 mm |
| Gewicht | 495 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Schlagworte | Besatzungszonen • Nachkriegszeit • Nachkriegszeit (nach dem 2. Weltkrieg) |
| ISBN-10 | 3-421-04342-6 / 3421043426 |
| ISBN-13 | 978-3-421-04342-9 / 9783421043429 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich