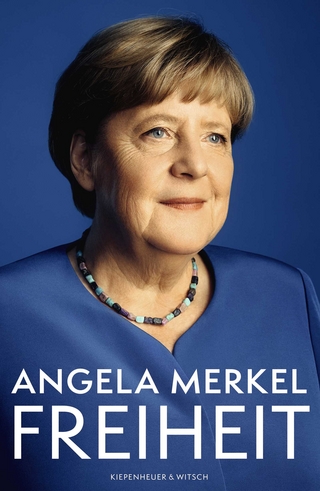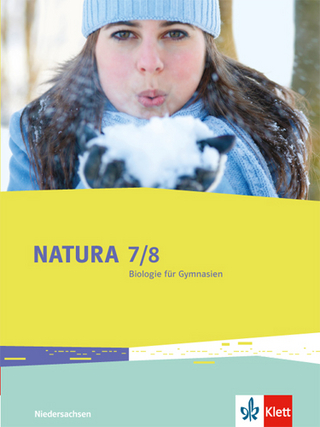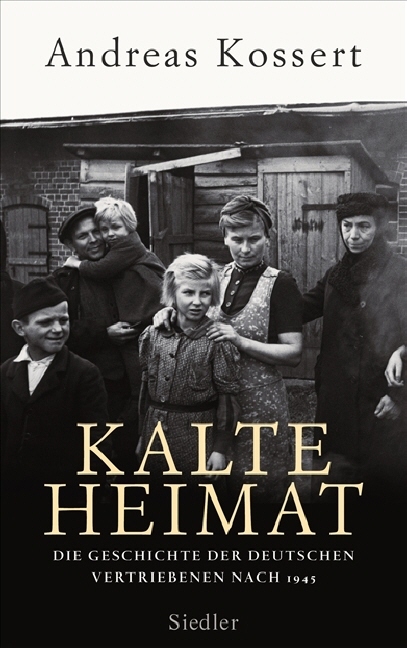
Kalte Heimat
Siedler, W J (Verlag)
978-3-88680-861-8 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Mit diesem Buch bricht Andreas Kossert ein Tabu: Er erschüttert den Mythos der rundum geglückten Integration der Vertriebenen nach 1945. Erstmals erhalten wir ein wirklichkeitsgetreues Bild von den schwierigen Lebensumständen der Menschen im 'Wirtschaftswunderland'.
Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen mehr als 14 Millionen Menschen aus den deutschen Ostgebieten, der überwiegende Teil in die westlichen Besatzungszonen. Diejenigen, die Flucht und Vertreibung überlebt hatten, fühlten sich von ihren deutschen Landsleuten aber nicht aufgenommen, sondern ausgegrenzt. Während die einen schon alles verloren hatten, sahen sich die anderen nun dem gewaltigen Zustrom der 'Fremden' ausgesetzt, der das soziale Gefüge Restdeutschlands auf den Kopf stellte. Vorurteile und der mit dem Lastenausgleich aufkommende Neid zogen einen tiefen Graben durch die deutsche Gesellschaft. Ohne die Vertriebenen, die mit Nichts begannen, hätte es jedoch ein 'Wirtschaftswunder ' nicht gegeben, sie waren ein wichtiger Motor der Modernisierung in der Bundesrepublik. So wurden sie zwar als Wähler heftig umworben und politisch von allen Seiten instrumentalisiert, zugleich aber mit ihren tiefen Traumatisierungen alleingelassen.
Andreas Kossert hat die schwierige Ankunftsgeschichte der Vertriebenen umfassend erforscht und beleuchtet erstmals diesen blinden Fleck im Bewusstsein der deutschen Nachkriegsgeschichte. In seinem Buch beschreibt er eindrucksvoll die Erfahrungen derjenigen, die durch den Krieg entwurzelt wurden und immense Verluste erlitten haben, und fragt nach den materiellen und seelischen Folgen für die Vertrieben und deren Nachkommen.
• Das letzte Tabu der Nachkriegsgeschichte.
• Fast jede deutsche Familie ist betroffen
Andreas Kossert, geboren 1970, studierte in Deutschland, Schottland und Polen Geschichte, Slawistik und Politik. Der promovierte Historiker arbeitet heute am Deutschen Historischen Institut in Warschau.
Am 29. Mai 1999 bekannte Bundesinnenminister Otto Schily auf einer Veranstaltung des Bundes der Vertriebenen (BdV): "Die politische Linke hat in der Vergangenheit, das l? sich leider nicht bestreiten, zeitweise ?ber die Vertreibungsverbrechen, ?ber das millionenfache Leid, das den Vertriebenen zugef?gt wurde, hinweggesehen, sei es aus Desinteresse, sei es aus ?gstlichkeit vor dem Vorwurf, als Revanchist gescholten zu werden, oder sei es in dem Irrglauben, durch Verschweigen und Verdr?en eher den Weg zu einem Ausgleich mit unseren Nachbarn im Osten zu erreichen. Dieses Verhalten war Ausdruck von Mutlosigkeit und Zaghaftigkeit." Das war eine sp? Einsicht. Viele der 14 Millionen Deutschen, die nach dem Krieg ihre Heimat verloren, hat sie nicht mehr erreicht. Damals kamen 2 Millionen Menschen bei Flucht und Vertreibung um, Deutschland verlor ein Viertel seines Territoriums. Abgesehen von der Vertreibung und Ermordung der europ?chen Juden hat nichts, was auf die NS-Wahnherrschaft zur?ckzuf?hren ist, der deutschen Gesellschaft so schwere Wunden geschlagen und das Land so versehrt. Doch die meisten Deutschen wollten das nicht sehen, nicht h?ren, nicht wissen. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Krieges hat G?nter Grass in der Novelle Im Krebsgang betroffen bekannt: "Niemals, sagt er, h?e man ?ber so viel Leid, nur weil die eigene Schuld ?berm?tig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten ?berlassen d?rfen. Dieses Vers?nis sei bodenlos." Da?mit dem Osten nicht nur die Vertriebenen, sondern alle Deutschen viel verloren hatten, dieses Bewu?sein schwand bald nach dem Krieg. Schon der materielle Wert der deutschen Ostgebiete l? sich kaum bemessen. Schlimmer jedoch wiegt der kulturelle Verlust. Es ist schwer, das Geschehen in angemessene Worte zu fassen und Pseudologiken, Abstraktionen sowie eine Rhetorik der Zwangsl?igkeit zu vermeiden. Die Geschichtsschreibung zur Vertreibung ist aus vielerlei Gr?nden besonders anf?ig f?r Rechthaberei, oberlehrerhaftes Moralisieren und politische Instrumentalisierung, denn alle sind Betroffene, jeder hat seine eigene Wahrheit. Obwohl ?erlich kein Unterschied mehr feststellbar ist, so Karl Schl?gel, besteht die mentale Kluft zwischen den Deutschen, die ihre Heimat verloren, und denen, die dieses Schicksal nicht erlitten haben, nach wie vor. In Millionen deutschen Wohnzimmern wurde nach dem Krieg geweint um den Verlust der Heimat. Man mu?diese Trauer und diesen Schmerz benennen, das geh?rt zur geistigen Hygiene, sagt R?diger Safranski: "Es gibt eine deutsche Neurose. Alles, was deutsches Schicksal ist, steht unter Verdacht, das sitzt tief. Deutsche Vergangenheit hat die Vergangenheit des deutschen Gro?erbrechens zu sein, basta." 14 Millionen Deutsche waren nach 1945 ohne Heimat. Im allgemeinen Chaos des Zusammenbruchs trafen sie in den Besatzungszonen ein, und die Beh?rden wu?en nicht, wie und wo sie diese Massen unterbringen und verwaltungsm?g einordnen sollten. Vor 1953 findet man f?r die Heimatlosen Bezeichnungen von gr??er Beliebigkeit. Man sprach von Aussiedlern und Vertriebenen, von Fl?chtlingen, Ostvertriebenen, Heimatvertriebenen, Ausgewiesenen und Heimatverwiesenen. 1947 setzte sich dann allm?ich "Vertriebene" - expellees - durch, auch weil die amerikanische Besatzungsmacht das anordnete. Der Begriff sollte zum Ausdruck bringen, da?die Vertreibung endg?ltig war und keine Hoffnung auf R?ckkehr bestand. Nach Gr?ndung der Bundesrepublik wurde "Vertriebener" aus semantischen Gr?nden dem Begriff "Fl?chtling" vorgezogen. Fl?chtling oder Vertriebener? Unterschiedliche Wahrnehmungen lassen erkennen, da?es eine gemeinsame Geschichte aller Vertriebenen nicht gibt; zu verschieden sind deren Schicksale und Erfahrungen. Hier sollen dennoch alle der Einfachheit halber als "Vertriebene" bezeichnet werden. Im Bundesvertriebenengesetz (BVFG) ist das Wort "Fl?chtling" f?r diejenigen reserviert, die aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) geflohen sind. Die Sowjetische Besatzungszone war bis 1949 Aufnahme- und Transitland f?r schier endlose Str?me von Fl?chtlingen und Vertriebenen. Insgesamt nahm sie 4,3 Millionen Menschen auf; in Mecklenburg stellten Vertriebene die H?te der Bev?lkerung. Trotzdem war das Thema Flucht und Vertreibung in der SBZ und sp?ren DDR tabu. Mit R?cksicht auf die Sowjetunion und die anderen "sozialistischen Bruderl?er" durfte ?ber Ausweisung und Vertreibung, gewaltsame ?ergriffe der "Freunde" auf die deutsche Bev?lkerung sowie Deportation und Zwangsarbeit nicht gesprochen werden. Das schlug sich im Sprachgebrauch nieder: Fl?chtlinge und Vertriebene wurden als "Umsiedler" bezeichnet, bis auch dieser Begriff sp?stens 1950 durch den "Neub?rger" ersetzt wurde. Die Vertriebenen wurden zwangsassimiliert, doch nach der Wiedervereinigung offenbarte sich, da?trotz der Unterdr?ckung durch das SED-Regime kulturelle Inseln und einzigartige Milieus erhalten geblieben waren. W?end in der DDR das totalit? Regime das Thema Flucht und Vertreibung unterdr?ckte, wurde es in der alten Bundesrepublik beinahe von selbst gemieden. Die Westdeutschen sahen sich in der unsicheren und chaotischen Lage der ersten Nachkriegszeit ?berrollt vom Strom der vertriebenen Deutschen aus dem Osten, denen es ganz ohne Zweifel noch elender ging als ihnen selbst. Und f?r viele Vertriebene, die auf Solidarit?oder einfach nur auf Mitgef?hl gehofft hatten, war der Empfang im Westen ein Schock. Auf die Vertreibung folgte nun die bittere Erfahrung von Ausgrenzung und Ablehnung als unerw?nschte Fremde. Mitleid m?sse man mit ihnen nicht haben, denn sie seien allesamt Nazis, war eine weitverbreitete Ansicht. Walter Dirks und Eugen Kogon warnten deshalb schon 1947: "Die Nation gilt als eine Einheit im Guten, im Stolz, im Gewinn, im Sieg - sie wird auch im B?sen beim Wort genommen, als eine Einheit behandelt auch in der Niederlage und in der Schande. Die armen Opfer in Schlesien und Ostpreu?n leiden stellvertretend f?r die wahren Schuldigen, und es ist ein Zufall, da?nicht wir es sind, du und ich, die stellvertretend leiden und sterben m?ssen." Im Zusammenbruch von 1945 zerfielen die Deutschen in "zwei Schicksalsgemeinschaften" - in die der Einheimischen und die der Vertriebenen -, und diese beiden Lager traten zueinander in "Opferkonkurrenz". Dieser Konkurrenzkampf trug "deutliche Z?ge eines Nationalit?nkampfes und eines Klassengegensatzes". Da?aus dem Osten vertriebene Deutsche im Westen als "Polacken" oder "dahergelaufenes Gesindel" beschimpft und gemieden wurden, zeigt, wie schnell jeder ein Fremder werden und von Diskriminierung bedroht sein kann. Die erlittenen Traumata w?end der Vertreibung, soziale Isolation und Deklassierung sowie das Ringen um eine Identit?zwischen Hier und Dort machte das Heimischwerden in der fremden Umgebung oft geradezu unm?glich. Die Betroffenen schwiegen oder ?ffneten sich allenfalls sp?und nur z?gernd ihren n?sten Angeh?rigen.
| Erscheint lt. Verlag | 20.5.2008 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 135 x 215 mm |
| Gewicht | 690 g |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Schlagworte | Bundesrepublik Deutschland (1949-1990); Politik/Zeitgeschichte • Nachkriegsjahre • Nachkriegsjahre, Nationalsozialismus, Vertreibung & Flucht • Nationalsozialismus • Vertreibung & Flucht • Vertreibung & Flucht • Vertriebene |
| ISBN-10 | 3-88680-861-0 / 3886808610 |
| ISBN-13 | 978-3-88680-861-8 / 9783886808618 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich