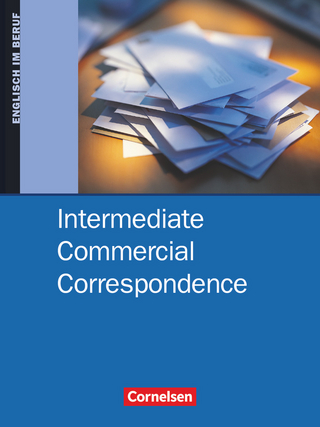Alptraum Sepsis
atp Verlag
978-3-943064-19-3 (ISBN)
Meist beginnt es mit einer harmlosen Infektion. Führt diese jedoch zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems, kann körpereigenes Gewebe geschädigt und angegriffen werden. Die Patienten werden ins künstliche Koma gelegt, wo die allermeisten von ihnen dramatische Alpträume haben, die in der Regel tiefgreifende Spuren hinterlassen.
Arne Trumann überlebte 2012 eine Sepsis im Alter von 44 Jahren. Seine Erfahrungen aus dieser Ausnahmezeit erzählt er in diesem Buch.
Verschiedene medizinische Expertenuntermauern dabei Trumanns Erlebnisse mit laienverständlichen Informationen und Erklärungen zu den medizinischen Vorgängen.
Geboren in Zeven, Norddeutschland 3 Kinder Kaufm. Angestellter in Industriebetrieb für Anlagentechnik Hobbypianist und Klavierstimmer Vorstandsmitglied der Dt. Sepsishilfe, Mitglied im Kuratorium der Dt. Sepsis-Stiftung
Wie fing es an?
Ich bin Arne Trumann, verheiratet und Vater von drei Kindern. Wir wohnen ländlich in einer kleinen Gemeinde zwischen Hamburg und Bremen. Ich bin allein verdienender kaufmännischer Angestellter, meine Frau ist als Hausfrau und Mutter bei den Kindern. Zum Zeitpunkt der Sepsis war ich 44 Jahre alt. Meine Töchter waren 16 und 9, mein Sohn 13 Jahre alt.
Ich wurde am Montag und Dienstag der ersten Februarwoche 2012 wegen eines grippalen Infektes von meinem Hausarzt krankgeschrieben und blieb zu Hause. Da ich mit 44 Jahren und in Verbindung mit regelmäßigem Sport eigentlich in einer guten körperlichen Verfassung war, traute ich mir am Mittwoch die Arbeit wieder zu. Nur ein paar Kilometer mit dem Auto und dann sitzende Tätigkeit im Büro – das sollte kein Problem sein. Ich fühlte mich zwar noch nicht richtig gesund, aber es gab viel zu tun. Den Rest der Woche arbeitete ich, doch ich war froh, als endlich Freitag war. Im Tagesverlauf fühlte ich mich immer unwohler und krank und ich sehnte das Wochenende herbei. Um 16.30 Uhr machte ich Feierabend. Da niemand zu Hause war, legte ich mich erstmal auf die Couch. Schlafen konnte ich nicht. Ich hatte irgendwie mit mir zu kämpfen. Mir war nicht übel, aber ich fühlte mich unendlich kraftlos. Selbst das Denken wurde schwierig. Es fiel mir immer schwerer, einen klaren Gedanken zu fassen. Nach etwa einer Stunde kam endlich meine Frau nach Hause und fragte mich, was denn los sei. „Mir geht es gar nicht gut“, erwiderte ich. Ich hatte keinen Hunger und fühlte mich sehr schlecht. Wir beschlossen, über den hausärztlichen Wochenend-Notdienst einen Arzt zu rufen, da ich nicht mehr in der Lage war, das Haus zu verlassen. Der Arzt befragte uns im Wohnzimmer. Ich konnte kaum noch klar denken. Meine Frau informierte den Arzt über den Verlauf der Woche. Währenddessen musste ich zur Toilette. Ich stand auf und musste mich sehr stark darauf konzentrieren, den Weg ins Bad zu finden. Jede Bewegung musste ich bewusst denken und ausführen. Ich war wie benebelt. Dieses Gefühl kannte ich überhaupt nicht. Ich konnte es für mich nicht einordnen und es machte mir Angst. Dinge, die sonst automatisch abliefen, funktionierten plötzlich nicht mehr. Der Arzt konnte keine klare Diagnose stellen und empfahl weitere Bettruhe.
Mittlerweile war es 20.15 Uhr und ich fühlte mich immer elender. Ich hatte noch nicht einmal Kraft, ins Bett zu gehen. Ich lag einfach nur noch da. Wir riefen über den Notruf 112 einen Krankenwagen, der mich liegend ins Krankenhaus bringen sollte. Dieser traf gegen 20.30 Uhr bei uns ein, gefolgt von einem Notarztwagen. Der Notarzt, so erfuhr ich später, war eigentlich Intensivmediziner und hatte nur zufällig Notdienst an diesem Abend. Er untersuchte mich gründlich, ermittelte Blutdruck und Pulsfrequenz und befragte auch meine Frau. Die an mich gerichteten Fragen konnte ich nur mühsam beantworten. Ich konnte einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen. So krank habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Durch seine Erfahrung lag der Notarzt mit seinem Verdacht auf einen septischen Schock richtig. Ich müsse jetzt schnellstmöglich auf eine Intensivstation gebracht werden. Wir dürften keine Zeit mehr verlieren.
Das nächstgelegene Krankenhaus mit einer entsprechenden Intensivstation war nicht leicht zu finden. Erst der fünfte Anruf, diesmal im Klinikum Bremen-Mitte, war erfolgreich: Hier waren gerade die Räumlichkeiten desinfiziert worden und nach der etwa 45-minütigen Fahrt dorthin, war man in der Lage, mich aufzunehmen. Während des Transports verschlechterte sich mein Zustand zusehends. Der Notarzt zog in Erwägung, mich zu intubieren und zu beatmen, da die Sättigungswerte des Blutes sehr schlecht wurden, konnte jedoch darauf verzichten. In Bremen angekommen, wurde ich in der Notaufnahme aus dem Rettungswagen ausgeladen. Daraufhin, so kann ich mich noch erinnern, fuhren wir durch die Gänge des Krankenhauses direkt auf die Intensivstation. Ich sehe noch die weißen Platten und Muster der Deckenverkleidung und die vielen Hinweisschilder in den Gängen über mir vorbeiziehen. Alles um mich herum war in Eile. Ich spürte, dass die Zeit drängte, konnte aber selbst nichts tun. Ich lag nur da und musste alles mit mir geschehen lassen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf der Trage auf der Intensivstation lag und eine Schwester mich nach meinen persönlichen Daten befragte: Name, Wohnort, Kinder, Name der Ehefrau usw. Diese Fragen konnte ich noch beantworten, doch meine Gedanken begannen sich immer weiter von der Realität zu entfernen. Dinge, die tatsächlich passierten und das, was mein Gehirn aus diesen Eindrücken machte, vermischten sich, so dass die beschriebene Szene mit der Schwester sich in meinem Kopf völlig anders abgespielt hat.
Nämlich so: Die Schwester soll mir eine neue Nadel für den Infusionsschlauch legen. Ein Kollege geht vorbei und ignoriert ihre Bitte, ihr zur Hand zu gehen. Ich habe das Gefühl, dieser Pfleger geht nicht, sondern schwebt kurz über dem Boden an uns vorbei. Die Schwester ist sauer, dass der Pfleger ihr nicht hilft, sondern einfach hinter einer Toilettentür verschwindet. In meiner Wahrnehmung holt die Schwester in ihrer Wut einen Einlauf und reicht ihn dem Pfleger mit der deutlichen Anweisung, sich diesen zuzuführen. Auf diese Weise hat sie sich meiner Empfindung nach den nötigen Respekt verschafft.
Einer meiner letzten Gedanken, bevor ich ins künstliche Koma versetzt wurde, war, dass ich hier in diesem Bett auf keinen Fall sterben würde. Ich würde unbedingt durchhalten. Ich würde aus diesem Krankenhaus wieder herauskommen. Aufgeben kam für mich nicht infrage.
Nun begann die Zeit im künstlichen Koma.
Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand voraussagen, wie lange das künstliche Koma dauern würde – und ob ich überhaupt jemals wieder daraus erwachen würde. Zu viele Unwägbarkeiten konnten im weiteren Verlauf der Sepsis eintreten. Alle Hoffnung lag darin, dass die therapeutischen Maßnahmen schnell greifen würden.
Meine Familie war in dieser Zeit unglaublichen seelischen Belastungen ausgesetzt, da der Ehemann und Familienvater von drei Kindern möglicherweise sterben würde. Diese unbestimmt lange Zeit darauf warten zu müssen, dass meine Werte einen Hoffnungsschimmer zulassen, wird von meinen Angehörigen als die schlimmste Zeit beschrieben.
Meine Träume im künstlichen Koma
Während der Zeit im künstlichen Koma habe ich viele verwirrende Träume durchlebt, die alle von einem sehr starken Gefühl der Bedrohung und des Ausgeliefertseins gekennzeichnet waren - einem kaum definierbaren Gefühl, dass etwas Schwerwiegendes passieren würde. Ich spürte, dass der Tod ganz in der Nähe war.
Meist träumte ich die Szenen so, dass ich in meinem Krankenbett lag. Ich war hilflos und gezwungen, das alles zu erleben, denn ich konnte nicht aufwachen, nicht wegsehen. In meinen Träumen konnte ich meinen Körper nicht fühlen, ihn nicht bewegen. Ich empfand eine nie zuvor gespürte Schwäche, die mich niederdrückte. Es gab keine Möglichkeit für mich, der Situation zu entfliehen. Ich musste alles erdulden. Alles schien in den Träumen unendlich lange Zeit anzudauern. Es war eine unerträgliche Qual.
„Dachboden und Jäger“
Ich liege in meinem Krankenhausbett. Es ist totenstill. Ich richte den Blick nach oben. Ich befinde mich offenbar auf einem Dachboden. Ich sehe Holzsparren, Dachlatten und Dachpfannen von unten. Schwarze Dachpfannen, mit Zement verstrichen und Dachhaken. Kein Fenster gibt den Blick nach draußen frei. Auch ist keine Tür zu sehen. Ich kann mich überhaupt nicht bemerkbar machen. Kann mich nicht bewegen, nicht rufen. Ich weiß nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Ich liege hier völlig allein und hilflos. Endlos lange, ohne dass sich auch nur irgendetwas tut. Es ist kalt in diesem Zimmer. Unter meiner Decke ist es auszuhalten, aber die Luft, die ich einatme, ist kühl und feucht. Dann bin ich plötzlich außerhalb dieses Hauses. Es steht an einer nicht ausgebauten kleinen Straße. Eine Art Feldweg. Hohe Tannenbäume stehen rechts an der Straße neben dem Haus. Die großen Zweige reichen weit über den Weg. Es ist nasskalt. Schneeregen fällt. Bei dem Haus parken mehrere große Geländewagen. Es sind Jäger. Sie versammeln sich zwischen den Autos und reden leise. Irgendwo wurde ein Reh angefahren höre ich, und sie suchen die Gegend danach ab. Jeder hat ein Gewehr über die Schulter gehängt. Die Läufe der Waffen zeigen nach oben. Ich bin wieder in dem Haus auf dem Dachboden. Ich höre Stimmen, kann aber nicht verstehen, was geredet wird. Es poltert und offenbar sind die Jäger jetzt in dem Raum unter mir. Ich habe keine Ahnung, was sie dort unten suchen, aber mir wird klar, dass sie mich nicht bemerken. Dann ist es wieder still. Aber sie sind noch da. Das spüre ich. Sie sind in dem Zimmer unter mir. Ganz leise, wie Jäger auf der Jagd sein müssen. Sollte sich jetzt ein Schuss lösen, würde ich in den Rücken getroffen werden. Blut würde aus meinem Bett auf den Boden tropfen. Und sie würden möglicherweise noch nicht einmal nach oben gehen. Ich würde einfach tot hier oben liegen bleiben. Mich überkommt blanke Angst und ein schreckliches Gefühl der Hilflosigkeit.
„Die Galeere“
Ich sitze auf einer harten Holzbank, die Handgelenke umfasst von Schellen mit dicken schweren Eisenketten. Ich muss mit beiden Armen ein Ruderpaddel einer Galeere bewegen, aber ich kann die Arme kaum heben. Vor und hinter mir sitzen viele andere Gefangene. Links und rechts der Sitzreihen ragen die langen Holzruder durch die Außenwand zum Wasser. Ich sitze in der rechten Reihe. Ich habe Angst. Ich bin gefesselt und werde dieses Schiff nicht lebend verlassen. Egal was passiert, ich bin angekettet und werde, falls das Schiff untergeht, mit in die Tiefe gezogen. Dieses Ruderdeck im Schiff ist zwei Stockwerke hoch. Im oberen Teil, mir gegenüber gibt es eine Empore mit Brüstung, auf der von Zeit zu Zeit ein uniformierter Kapitän seine Kommandos brüllt. Es ist dunkel. Plötzlich erscheint wieder der Kapitän auf der Brüstung und brüllt: „Männer, wir haben Befehl mit unserem Schiff ins östliche Mittelmeer zu fahren und eine Schlacht gegen den Feind zu kämpfen.“ Allen Gefangenen ist sofort klar, dass diese Schlacht nicht zu gewinnen ist. Der Weg dorthin ist der Weg in den sicheren Tod. Einige versuchen, sich die Fesseln mit den Ketten von den Armen zu reißen. Doch vergebens, sie müssen mitrudern. Ich spüre in mir, dass die Situation bedrohlich ist. Mein Leben ist bedroht. Ich möchte weg, kann mich aber nicht abwenden oder der Lage entziehen. Ich habe Angst.
„Der Sensenmann“
Es ist eine kalte, nebelfeuchte Nacht. Ich gehe in einer mittelalterlichen Stadt eine Gasse entlang. Sie führt leicht bergan, in einem leichten Bogen nach links. Nach rechts führt ein kleiner Seitengang. Die Häuser sind dunkel, die Fensterläden und Türen sind verschlossen. Über der Gasse hängt an der Hausecke eine Gaslaterne und gibt der Szene ein gespenstisches Dämmerlicht.
Es ist so ungemütlich, dass ich meine Hände tief in die Jackentaschen vergraben habe und meine Arme fest an den Körper gepresst sind.
An der Hausecke zu dem Seitengang wird im Lichtschein der Laterne ein Schatten erkennbar. Langsam kommt eine Gestalt auf mich zu. Sie trägt einen langen grauen Umhang. Vor dem Körper hält sie mit beiden Händen eine Sense. Unter der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze ist kein Antlitz zu erkennen, aber ich spüre einen bohrenden Blick aus dem schwarzen Nichts. Die Gestalt bleibt regungslos vor mir stehen und starrt mich wortlos an. Schließlich sage ich: "Was willst Du von mir? Such Dir jemand anderen. Mich kriegst Du nicht!" Einen langen Moment stehen wir uns gegenüber. Die Gestalt mustert mich. Dann dreht sie sich wortlos weg und verschwindet wieder so langsam, wie sie gekommen ist in der Dunkelheit der Seitengasse.
| Erscheinungsdatum | 10.12.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Krankheiten / Heilverfahren |
| Schlagworte | Alpträume • Amputation • Blutvergiftung • Erfahrungsbericht • Gesundheit • Künstliches Koma • Patient • Rehabilitation • Sepsis • Sepsis-Überlebender |
| ISBN-10 | 3-943064-19-0 / 3943064190 |
| ISBN-13 | 978-3-943064-19-3 / 9783943064193 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich