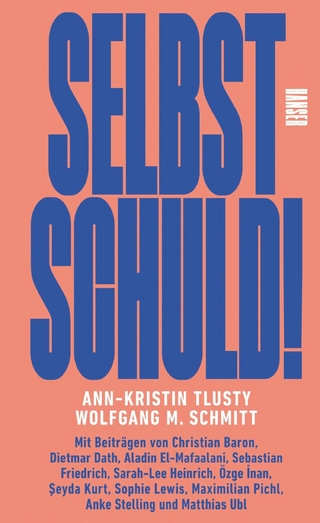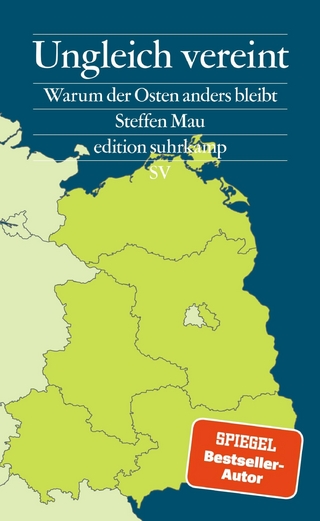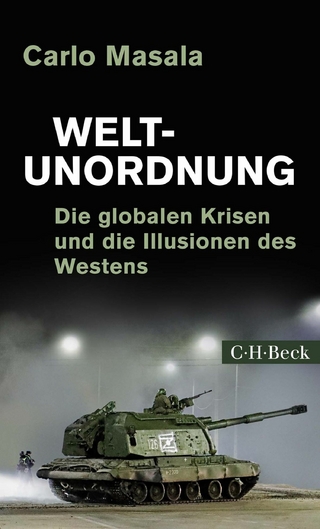Was will die AfD? (eBook)
188 Seiten
Pantheon Verlag
978-3-641-20716-8 (ISBN)
Aktueller denn je: Ein erschreckend weitsichtiges Buch über die zunehmende Radikalisierung der AfD und die Bedrohung für unsere Demokratie
»Hammer! 2017 schreibt Justus Bender, dass 2021 Olaf Scholz Kanzler ist - nicht genau dieses Bündnis, aber fast ganz genau. Und mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich das lese, weil das ist plötzlich alles denkbar.« Markus Lanz im Jahr 2025
Der unaufhaltsam scheinende Aufstieg der AfD verändert nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland - er droht das Land zu spalten, während die traditionellen Parteien immer verzweifelter nach einer Antwort suchen, um den Siegeszug zu stoppen.
Es gibt kaum einen Journalisten, der die AfD und ihr Umfeld so gut kennt wie Justus Bender. Seit ihren Anfängen im Jahr 2013 begleitet er den Aufstieg der Partei mit investigativen Recherchen und berichtet über ihre innerparteilichen Querelen und radikalen Tendenzen. Er führte Hunderte Interviews mit ranghohen Funktionären der AfD, er kennt alle relevanten Akteure aus zahllosen persönlichen Begegnungen.
In diesem, erstmals 2017 erschienen, Buch, das von seiner Aktualität nichts eingebüßt hat, zeichnet Justus Bender ein Porträt der AfD aus nächster Nähe: Er beschreibt das Spitzenpersonal und damit zugleich die wichtigsten Repräsentanten der verschiedenen Flügel und Strömungen - ihre Positionen, ihre Machtkämpfe. Vor allem aber untersucht er, mit welchen Mitteln diese Partei unser Land und unsere Demokratie verändert. Was will die AfD eigentlich? Und wie sähe Deutschland aus, wenn sie an der Macht wäre?
Justus Bender, geboren 1981, hat Philosophie in Frankfurt am Main studiert. Er war Autor der Wochenzeitung DIE ZEIT und Redakteur von ZEIT CAMPUS. Im Jahr 2010 arbeitete er mehrere Monate als Fellow des Arthur F. Burns-Programms für den Boston Globe in den USA. Bender schrieb für das ZEITmagazin, das Ressort CHANCEN der ZEIT, ZEIT CAMPUS und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Seit 2012 arbeitet er als Redakteur im Ressort Politik der FAZ. Justus Bender ist einer der profundesten Kenner der AfD. Er beobachtet die Partei seit ihren Anfängen als euroskeptische Kleinpartei und hat mit »Was will die AfD?« (Erstveröffentlichung 2017) das Standardwerk über deren Aufstieg und Ziele geschrieben. Ein Szenario zur Machtübernahme der AfD, das er in dem Buch entworfen hatte, sorgte vor der Bundestagswahl 2025 für Furore, weil es wichtige Entwicklungen exakt vorhergesagt hat. »Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland« wird im Herbst 2025 in einer aktualisierten und erweiterten Ausgabe erscheinen.
Ich denke viel über die AfD nach. Es ist mein Beruf. Ich lese abends Twitter-Nachrichten von AfD-Politikern, ich schaue mir Wahlkampfauftritte an, ich rufe manchmal AfD-Politiker an, nicht weil ich eine konkrete Frage habe, sondern einfach so, um über die Partei zu reden, um sie zu verstehen. So geht das seit Gründung der Partei, das ist eine lange Zeit, wenn man vor allem über ein Thema nachdenkt.
Mit den Jahren bekommt man ein Gefühl, welche Thesen über die AfD näher an der Wahrheit liegen als andere. Eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen sehe ich im Rückblick kritisch. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die AfD maßgeblich von evangelikalen Christen unterwandert wird. Es gibt sie, aber sie spielen machtpolitisch kaum eine Rolle. Ich glaube nicht, dass die NPD jemals eine nennenswerte Nähe zur AfD herstellen wird. Warum nicht? Weil die NPD meiner Meinung nach eine explizite Sehnsucht nach einer Diktatur hat. Die AfD hingegen will für die Befreiung von vermeintlichen Tyrannen wie der EZB, der Bundeskanzlerin und der »Lügenpresse« stehen. Dass die AfD für eine Befreiung stehen will, mag überraschen, aber es stimmt. Beide Parteien verfolgen in ihrem gegenwärtigen Entwicklungsstand gegensätzliche Ziele. Wäre man ganz böse und hypothetisch, man müsste sagen, die NPD wäre die Partei, die sich gründet, wenn Deutschland unter einer AfD-Herrschaft in eine Katastrophe geschlittert wäre, um zu sagen: Es ist nicht alles schlecht gewesen, damals, im autoritären AfD-Deutschland. Die AfD-Mitglieder heute wollen aber keine Katastrophe für Deutschland, sie glauben daran, die Deutschen von einer Unterjochung zu befreien. In dieser Logik waren die deutschen Faschisten mindestens so diktatorisch wie das in der AfD verhasste Direktorium der Europäischen Zentralbank oder Bundeskanzlerin Angela Merkel. AfD-Mitglieder können in ihrem Weltbild also die NPD aus voller Überzeugung ablehnen und trotzdem Rechtspopulisten sein, das ist kein Widerspruch. Sie begehen in ihrer Wahrnehmung auch keinen logischen Bruch, wenn sie sich aus voller Überzeugung als Antifaschisten bezeichnen. Es wird meiner Meinung nach niemals eine Kooperation zwischen der AfD und der NPD geben.
Ich glaube auch nicht, dass die Gleichzeitigkeit, mit der solche Bewegungen weltweit an Einfluss gewinnen, etwas mit der Globalisierung, sozialen Spannungen oder dem Kapitalismus zu tun haben. Mancher weiße Amerikaner, der Donald Trump im Jahr 2016 im Präsidentschaftswahlkampf unterstützt hat, mag frustriert sein, weil seine Fabrik nach China verlagert wurde und er nun arbeitslos ist. Es mag auch sein, dass gewisse Bevölkerungsschichten in Deutschland – trotz einer wirtschaftlich stabilen Gesamtlage – eine ökonomische Stagnation erleben seit einigen Jahren. Vielleicht haben manche Anhänger von Marine Le Pen ein Problem mit einer globalisierten Welt, weil Einwanderer auf dem Arbeitsmarkt oft mit den unteren Gesellschaftsschichten konkurrieren, also mit den Taxifahrern und Bauarbeitern, nicht mit den Chefärzten und Börsenmaklern. Mag sein. Ich kann mit der These, die Trumps, Le Pens, Kaszcynskis, Wilders und Petrys dieser Welt seien Vertreter von Globalisierungsverlierern, aber nichts anfangen, wenn ich einem AfD-Politiker wie Jörg Meuthen gegenübersitze und er mir erklärt, warum er Angst vor dem Islam hat, er, ein Wirtschaftsprofessor aus Baden-Württemberg. Oder Frauke Petry, eine promovierte Chemikerin, die mit Bestnoten in Großbritannien studiert hat. Meuthen und Petry sind keine Einzelfälle. Ich treffe auch in strukturschwachen Regionen von Ostdeutschland nicht überall frustrierte Hartz-IV-Empfänger bei der AfD. Etliche haben einen Beruf, durch den sie viel reisen konnten. Sie haben die Welt gesehen, mancher hat eine Ehefrau mit Migrationshintergrund – und es stört niemanden in der AfD. Sagen zumindest alle. Aber auch wenn das allen Intuitionen gegenüber einer rechtspopulistischen, einwanderungskritischen Partei widerspricht: Ich habe mittlerweile das Gefühl, es stört sie im Einzelfall wirklich nicht. Mit einer Angst vor der Globalisierung haben die Erfolge der AfD nichts zu tun. Ich würde den meisten AfD-Anhängern zutrauen, dass sie ökonomische Nachteile für die deutsche Volkswirtschaft in Kauf nehmen würden, um ihren Traum von einem souveränen Nationalstaat ohne supranationale Verbindlichkeiten und mit einem ethnisch und kulturell homogenen Volk zu verwirklichen. Wollte man die Motivation mancher AfD-Anhänger ökonomisch erklären, man müsste eher sagen, dass ein Mensch, der für sich wenig Perspektiven sieht, seinen Wert anders definiert. Als Mitglied eines großen, starken Volkes zum Beispiel. Oder als Vertreter eines überlegenen Kulturkreises. Er mag arbeitslos sein oder seine Träume im Leben nicht verwirklicht haben, aber immerhin ist er noch Deutscher. Mitglied eines großen Volkes also, einer der stärksten Volkswirtschaften des Planeten. Oder er ist Christ oder Abendländer. Sein Abendland hat vor 333 Jahren die Türken vor Wien geschlagen. Sein Abendland ist unbezwingbar und großartig, und er ist ein Teil davon. Er mag zwar selbst nur ein kleines Licht sein, aber sein Land baut die besten Autos der Welt und hat eine stolze Geschichte, deren nicht so stolze Phasen man doch nicht überbetonen solle. Mangelndes Vaterlandspathos in der Gesellschaft, der immer wiederkehrende Hinweis auf den Nationalsozialismus oder ein befürchtetes Nebeneinander verschiedener Kulturen in Deutschland würden einem solchen Menschen subjektiv einen Teil seines imaginierten Selbstwertgefühls nehmen. Wenn nicht einmal das Volk, dem er angehört, groß ist und stark, bliebe wenig übrig. Die psychologische Ursache solcher Haltungen mag also manchmal im Ökonomischen liegen. Das ändert aber nichts daran, dass die Haltung selbst das Gegenteil eines individuellen Besitzstandswahrertums ist. Wer in völkischem Pathos denkt und um die Großartigkeit seines Vaterlandes besorgt ist, der wird nicht durch Steuergeschenke oder staatliche Subventionen davon abgebracht werden. Ein verletztes Selbstwertgefühl lässt sich nicht mit Geld heilen. Eher schon mit einem Konkurrenzangebot, das einen Nationalstolz ermöglicht, ohne Minderheiten auszugrenzen.
Ich glaube auch nicht, dass die Partei im Kern eine libertäre Bewegung ist. Ich hatte das mal in einem Artikel geschrieben, irgendwann 2014. Der Begriff des Libertarismus beschreibt die Art und Weise, wie AfD-Anhänger gegen jede Form von Obrigkeit agieren: die Medien, die sogenannten Altparteien, die Verwaltung, die Kirchen. Darin gleichen sich Trump-Anhänger und Höcke-Sympathisanten. Aber der Begriff trifft es trotzdem nicht. Viele in der AfD wollen einen starken Staat, der ihre Interessen durchsetzt, eine autoritäre Volksherrschaft. Wer einen starken Staat will, ist sicher vieles, aber er ist kein Libertärer. Es gibt Libertäre in der AfD, aber sie sind eine Minderheit.
So geht das seit Jahren, ich verwerfe eine Theorie nach der anderen. Lange war ich ratlos. Seit einigen Monaten habe ich aber das Gefühl, dass es eine Antwort gibt. Das ist nach mehreren Jahren des Nachdenkens keine kleine Sache, jedenfalls für mich. Es ist eine Antwort, die das gesamte Phänomen der AfD in ihren Grundzügen erklären könnte. Eine Antwort, die das Selbstbild der AfD-Anhänger mit der Kritik ihrer Gegner versöhnen würde – und trotzdem oder gerade deshalb Kritik an der AfD ermöglicht. Eine Antwort, die zudem erklärt, warum auf der ganzen Welt eine besondere Sorte von Populisten derzeit an Bedeutung gewinnt. Und eine Antwort, deren Konsequenzen mich nicht weniger erschrecken, als es die manchmal zu hörende, naive These gewesen wäre, die AfD-Anhänger seien in Nadelstreifen gehüllte Nationalsozialisten, die durch eine Raum-Zeit-Anomalie in das 21. Jahrhundert teleportiert wurden, um das Werk eines »Vierten Reichs« zu vollenden.
Diese Antwort stammt nicht von mir. Ich habe sie zuerst in einem Artikel des New York Magazine gelesen, eine Zeitschrift, von der ich nicht ausgerechnet eine Erkenntnis über die AfD erwartet hätte. Der Artikel handelte auch nicht von der AfD, sondern von Donald Trump. Deutschland kam in ihm nicht vor. Geschrieben hatte ihn ein Autor namens Andrew Sullivan, und als ich die ersten Zeilen las, drehten sich alle Theorien in meinem Kopf einmal um ihre eigene Achse und setzten sich zu einem Gefüge zusammen, das zu passen schien wie die lange gesuchte Lösung für ein kompliziertes Rätsel. Sullivan brauchte dazu nur einen einzigen Namen zu erwähnen: Platon.
Platon ist einer der wichtigsten Philosophen der Menschheitsgeschichte. Er beschrieb die Grundsatzfragen seiner Disziplin in einer Genauigkeit, die es den Menschen in späteren Jahrtausenden unmöglich machte, sich nicht auf ihn zu beziehen. Die moderne Philosophie, sagen manche, bestehe eigentlich nur aus »Fußnoten zu Platon«. Im vierten Jahrhundert vor Christus verfasste Platon einen in zehn Bücher gegliederten Dialog: »Der Staat«. Es ist ein Text über das Ideal der Gerechtigkeit und über die Frage, in welcher Staatsform es wohl am ehesten verwirklicht werden würde. Denkt man im 21. Jahrhundert über die AfD nach, ist nur ein Kapitel darin von Bedeutung. Das Buch VIII, Abschnitt A, Kapitel 123, Untergliederung a. Diese Kapitelangaben stammen aus der manchmal etwas altertümlich klingenden Übersetzung aus dem Altgriechischen von Friedrich Schleiermacher aus den Jahren 1804 bis 1810. Der Titel des Abschnitts lautet: »Auflösung der Demokratie durch ihre Unersättlichkeit nach Freiheit«.
Es ist eine verstörende Lektüre. Nicht so sehr, weil Platon dort beschreibt, wie eine Demokratie scheitern kann. Sondern weil dieser Mann vor 2400 Jahren ein Szenario beschreibt, das schmerzhaft genau dem Zustand der Demokratie in der Bundesrepublik und der gesamten westlichen Hemisphäre entspricht. Das Buch ähnelt...
| Erscheint lt. Verlag | 27.2.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Alexander Gauland • Alice Weidel • Antisemitismus • Beatrix von Storch • Björn Höcke • Brandmauer • Bundestagswahl • Bundestagswahl 2025 • Caren Miosga • eBooks • Frauke Petry • Friedrich Merz • Markus Lanz • Rechtsextrem • Rechtsextremismus • Rechtspopulismus • Robin Alexander • Tino Chrupalla |
| ISBN-10 | 3-641-20716-9 / 3641207169 |
| ISBN-13 | 978-3-641-20716-8 / 9783641207168 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich