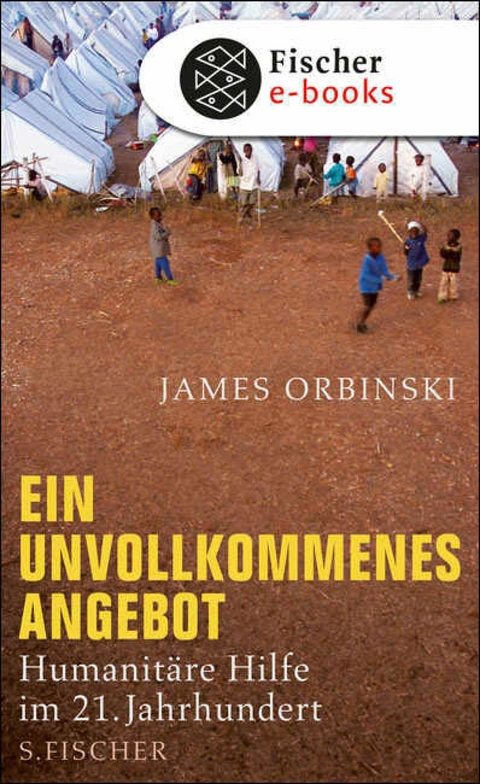Ein unvollkommenes Angebot (eBook)
416 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-400980-3 (ISBN)
Dr. James Orbinski ist Mitglied und ehemaliger Präsident der Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen). Als Präsident konnte er 1999 stellvertretend für die zahlreichen Ärztinnen und Ärzte, die in Krisengebieten den Opfern von Not und Gewalt helfen, den Friedensnobelpreis entgegennehmen. Er ist außerordentlicher Professor an der Universität von Toronto und engagiert sich bei mehreren Hilfsorganisationen, u.a. Dignitas International, die sich der Behandlung und Bekämpfung von Aids in der Dritten Welt widmet. James Orbinski lebt mit seiner Familie in Toronto.
Dr. James Orbinski ist Mitglied und ehemaliger Präsident der Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen). Als Präsident konnte er 1999 stellvertretend für die zahlreichen Ärztinnen und Ärzte, die in Krisengebieten den Opfern von Not und Gewalt helfen, den Friedensnobelpreis entgegennehmen. Er ist außerordentlicher Professor an der Universität von Toronto und engagiert sich bei mehreren Hilfsorganisationen, u.a. Dignitas International, die sich der Behandlung und Bekämpfung von Aids in der Dritten Welt widmet. James Orbinski lebt mit seiner Familie in Toronto. Irmengard Gabler war nach dem Studium der Anglistik und Romanistik in Eichstätt und London einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für romanische Literaturwissenschaft an der Universität Eichstätt tätig. Seit 1993 übersetzt sie Belletristik und Sachbücher aus dem Englischen, Französischen und Italienischen (u.a. Cristina Campo, Serena Vitale, Philippe Blasband, Christopher J. Sansom, John Dickie, Adam Higginbotham). Die Übersetzerin lebt in München.
Teil I
Geschichten sind alles, was bleibt
Ich war in Amsterdam und trank zusammen mit Austen Davis, dem eleganten Generaldirektor der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF), eine Tasse Kaffee. Es war im Jahr 2000, und ich war eben aus dem Sudan zurückgekehrt. Ich hatte mich mit dem Außenminister des Landes getroffen, um dagegen zu protestieren, dass Regierungstruppen die MSF-Ernährungszentren im Süden des Landes bombardierten. Austen und ich saßen in einem Straßencafé neben dem Haupteingang des Büros von MSF Holland. Es befindet sich in einem ehemaligen Gefängnisgebäude, dessen früherer Innenhof zu einem Aufenthaltsbereich mit Cafés, Zeitungsständen und zahlreichen Kunstinstallationen umgestaltet worden war. Man betritt ihn über einen neoklassizistischen Bogengang, in dem eine Gedenktafel mit einer gläsernen Träne an die Opfer des Holocaust erinnert. Über dem Haupteingang findet sich der Satz »Homo sapiens non urinat in ventum« in den Stein gemeißelt – Der vernunftbegabte Mensch pisst nicht in den Wind –, ein passendes Motto für unsere Organisation.
»Weinen und pissen. Mehr können wir nicht tun?«, fragte ich Austen.
»Mag sein. Aber wir können uns weigern, nur zu weinen. Ich sage, schreit so laut ihr könnt und pisst in den Wind, sooft ihr könnt. Wer weiß, vielleicht dreht er sich ja!«
Der Mann gefällt mir, dachte ich. Der Piss-Spruch befand sich ursprünglich an einer Zellenwand des ehemaligen Gefängnisses. Während der Umbauarbeiten hatte man ihn auf den Eingangsbogen übertragen.
Wir alle haben unsere Geschichten. Wir finden uns in ihnen, erfinden uns durch sie. Wenn wir aber die Geschichten sind, die wir erzählen, sollten wir sie sorgsam auswählen. Dieses Buch setzt sich aus einzelnen Geschichten zusammen. Ich stelle mir immer wieder die Frage: »Wie soll ich mich, wie sollen wir uns verhalten angesichts fremden Leids?« Die Frage beschäftigt mich schon mein ganzes Leben. Dieses Buch erzählt von der politischen Reise, die ich in den vergangenen zwanzig Jahren als Arzt im humanitären Einsatz, als Bürger und als Mensch unternommen habe. Ich wurde Zeuge von Hungersnöten, von Epidemien, von Krieg und Kriegsverbrechen, und von Völkermord. Und ich wurde Zeuge vom Scheitern der Politik und von der Schwierigkeit der Menschen in Krisensituationen, sich die eigene Menschlichkeit zu bewahren. Es ist keine aus der Distanz erzählte Geschichte. Ich will nicht den Eindruck erwecken, als stünde ich außerhalb der Ereignisse und Umstände, die ich beschreibe. Im Gegenteil, ich lebe mit ihnen, in ihnen, durch sie. Es sind persönliche Momente, die ich beschreibe, politische Momente und auch Momente, in denen es diese Unterscheidung nicht mehr gibt. Es ist auch keine sentimentale Geschichte, in der den Opfern mit gönnerhaftem Mitleid begegnet wird oder in der nur diejenigen der Hilfe für würdig erachtet werden, die niemandem Angst machen. Meine Sichtweise erfordert eine gewisse Bescheidenheit, ein Sich-Wiedererkennen im anderen. Es geht um die Gemeinsamkeit, die zwischen uns existieren kann, wenn wir es zulassen.
Es war mein erster humanitärer Einsatz. Und er hatte nicht das Geringste mit Medizin zu tun. Es war im Oktober 1992. Ich war von MSF als medizinischer Koordinator nach Baidoa in Somalia berufen worden, einer Stadt, die überall auf der Welt als »Stadt des Todes« bekannt geworden war. Auch hier hatte MSF Ernährungszentren, Kliniken und Krankenhäuser errichtet, um der hungernden Bevölkerung zu helfen, die in einem immer grausamer wütenden Bürgerkrieg gefangen war. Als die Vereinten Nationen und diverse nichtstaatliche Organisationen endlich ins Land strömten, waren bereits Hunderttausende gestorben. Ich landete in einem amerikanischen Transportflugzeug vom Typ Hercules C-130 auf dem Rollfeld vor der Stadt. Eine Stunde später erreichte ich ein Ernährungszentrum, wo mir der Anblick von etwa dreitausend Menschen, eine Insel des menschlichen Hungers in der Wüste, die Sprache verschlug.
Sie saßen ausgemergelt, in Reihen, auf dem harten Erdboden und warteten. Die meisten von ihnen waren stumm, die meisten zu Tode erschöpft. Der Wind wehte mir heiß ins Gesicht. Der feine Staub, den er mit sich führte, geriet unweigerlich in die Atemwege. Ich beobachtete eine Frau, die ein kleines Kind im Schoß hielt und mit einem Stöckchen Zeichen in den Staub ritzte. Nach einer Weile ließ sie den Stock fallen und stupste ihr Kind an. Das Kleine weinte nicht, wachte auch nicht auf. Vielleicht schlief es oder lag im Koma – ich vermochte es nicht zu sagen. Die Frau nahm das Stöckchen wieder auf und zeichnete weiter. Ich bekam weiche Knie und musste mich auf eine Kiste setzen.
In einer Ecke des Ernährungszentrums stand ein weißes Zelt, die Klinik. Daneben waren drei weitere Zelte errichtet worden, in denen man die Leichen aufeinandergeschichtet hatte, jeder Stapel mindestens einen Meter hoch. Aus dem Augenwinkel heraus nahm ich plötzlich eine Bewegung wahr und blickte instinktiv beiseite, wollte gar nicht wissen, was sie möglicherweise bedeutete. Schließlich wandte ich doch den Blick. Ich hatte mich nicht getäuscht. Eine der Leichen auf dem Stapel, ein Mann, hatte sich bewegt.
Ich sah seine Lider flattern. Der Wind fuhr ihm unter das lange Hemd und bauschte es über seinem Körper. Er lag zwischen den Toten, war selbst nur noch Haut und Knochen. Seine Hand griff nach etwas, erkundete tastend die Umgebung. Ohne nachzudenken, trug ich ihn ins Klinikzelt. Er wog weniger als fünfunddreißig Kilo; ich hielt seinen Arm, damit er nicht hinunterbaumelte.
Da in der Klinik kein Bett mehr frei war, legte ich ihn auf den Boden. Eine Krankenschwester breitete eine Decke über ihn. Sie war ärgerlich und erklärte unwirsch, man habe den Mann ins Leichenzelt geschafft, weil nicht genügend Pflegepersonal für die vielen Kranken zur Verfügung stehe und dieser Patient ohnehin sterben werde. Da überkam mich eine hilflose, verzweifelte Wut – seinetwegen, meinetwegen, weil ebenso gut ich an seiner Stelle hätte sein können, auf Gedeih und Verderb einer Fremden ausgeliefert, die mir, dem Sterbenden, die Würde nahm.
Er öffnete und schloss die Augen, und ein Zittern erfasste seinen Körper unter der Decke. Gleich darauf war er tot. Es war der geschändete Rest eines erfüllteren Lebens. Ich kannte nicht einmal seinen Namen, aber ich wusste, dass er jemandes Sohn gewesen war, jemandes Freund und möglicherweise jemandes Ehemann und jemandes Vater. Welche Entscheidungen führten noch im letzten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts zu Bürgerkrieg und Hungersnot, zu Situationen, in denen Hunderttausenden ein solches Leid widerfuhr wie diesem Mann?
Als ich mich bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bewarb, akzeptierte ich naiv den Mantel des unpolitischen Arztes. Ich war der festen Überzeugung, humanitäres Handeln – mit seinen Grundsätzen Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit – müsse über jede Politik erhaben sein, biete gewissermaßen eine Möglichkeit, ihrer unschönen Kehrseite aus dem Weg zu gehen. Doch schon bald wurde mir klar, dass eine humanitäre Gesinnung keineswegs von der Politik zu trennen, sondern im Gegenteil eng damit verwoben war, und dass, wer im humanitären Einsatz tätig war, unweigerlich jene politischen Entscheidungen in Frage stellen musste, die ohne weiteres den Tod von Menschen in Kauf nehmen.
In Somalia wurde ich während der anarchischen Zustände nach dem Ende des Kalten Kriegs Zeuge des Bürgerkriegs. Hier waren die Hilfspakete aus dem Ausland nicht nur ein Rettungsanker für die Leidenden. Für Warlords und Kriegsprofiteure waren sie die wertvollste Handelsware im Land. Hilfslieferungen wurden geplündert, Wucher und Erpressung zum Bestandteil ihrer Herausgabe. Humanitäre Helfer wurden entführt, verprügelt und manchmal sogar getötet. Doch selbst als unsere Niederlassungen von Warlords und Plünderern angegriffen wurden, setzten wir, wenn irgend möglich, unsere Arbeit fort. Stimmen wurden laut nach einem Einschreiten der Vereinten Nationen, damit die Ordnung im Land wiederhergestellt werde, und sei es nur, um humanitäre Initiativen am Laufen zu halten. Kurz nach meiner Ankunft erlebte Somalia eine von den USA geleitete und den Vereinten Nationen autorisierte militärische Intervention unter humanitärer Flagge. Bereits nach wenigen Monaten würden die Friedensstifter in einem unbeholfenen Versuch, Ordnung zu schaffen, selbst Gewalt anwenden. Sechs- bis zehntausend Somalier wurden damals von italienischen, belgischen, kanadischen und amerikanischen »Friedenstruppen« geschlagen, gefoltert und getötet. Soldaten der Vereinten Nationen bombardierten wissentlich Krankenhäuser, und die öffentliche Meinung in Somalia wandte sich gegen die Mission der Vereinten Nationen. Am 5. Oktober 1993 kamen in Mogadischu bei blutigen Auseinandersetzungen über tausend Somalier und achtzehn U.S. Ranger ums Leben. Das Foto, auf dem ein toter Ranger zu sehen ist, der nackt durch die Straßen der Hauptstadt geschleift wird, veränderte die Außenpolitik der einzigen noch verbliebenen Supermacht der Welt und somit auch die Politik der Vereinten Nationen. Das Schicksal Somalias war besiegelt. Die Menschen dort wurden wieder in die politische Anarchie zurückgestoßen, und Theorie und Praxis einer humanitären Gesinnung lagen in Trümmern. Und ich erfuhr, dass auch für den neutralen, unparteiischen humanitären Helfer die Politik wichtig ist.
In Somalia war vor allem mein theoretisches medizinisches Wissen gefragt, zumal es...
| Erscheint lt. Verlag | 18.1.2011 |
|---|---|
| Übersetzer | Irmengard Gabler |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Zeitgeschichte | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Afghanistan • AIDS • Ärzte ohne Grenzen • Baidoa • Bürgerkrieg • Ernährung • Hilfe • Hilfsorganisation • Hungersnot • Kalter Krieg • Krieg • NGO • Plünderung • Rotes Kreuz • Ruanda • Sachbuch • Somalia • UN |
| ISBN-10 | 3-10-400980-5 / 3104009805 |
| ISBN-13 | 978-3-10-400980-3 / 9783104009803 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 993 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich