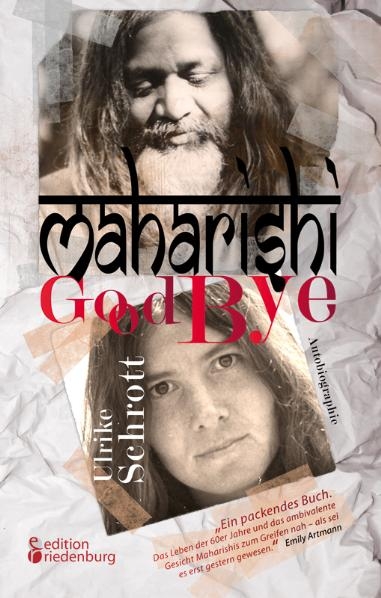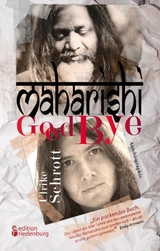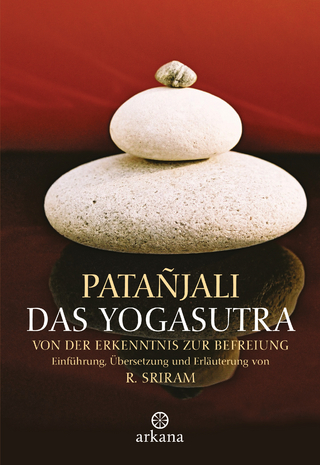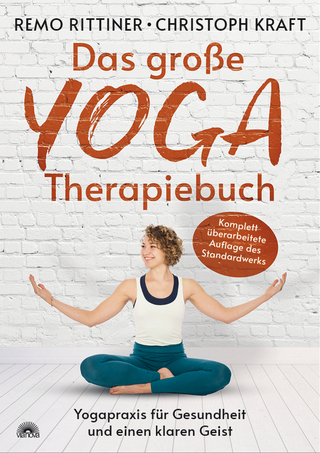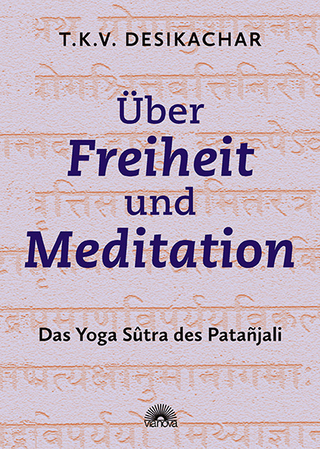Maharishi Good Bye
edition riedenburg (Verlag)
978-3-902647-34-4 (ISBN)
Ulrike Schrott wurde 1944 in Danzig geboren. Nach Sprachstudien in England und der Schweiz arbeitete sie als Entwicklungshelferin in Äthiopien. Anschließend begann sie zu meditieren, ließ sich im Ashram von Maharishi Mahesh Yogi zur Meditationslehrerin ausbilden und war längere Zeit in seiner Bewegung tätig. Später studierte und arbeitete sie am Orff-Institut der Universität Mozarteum Salzburg. In ihrer Autobiographie „Maharishi Good Bye“ hat Ulrike Schrott ihre Zeit als Anhängerin von Maharishi Mahesh Yogi verarbeitet.
Geleitwort von Gudrun Seidenauer. 6
Prolog. 9
Auf der Suche. 19
Im Ashram. 45
Abschied von Rishikesh. 77
Auf Mission. 105
An den Grenzen der Wahrnehmung. 133
Die Mondscheinprinzessin. 189
Zu neuen Ufern. 203
Anhang. 211
Nachwort und Danksagung. 215
„Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goethe, Faust I) Dies ist der Wunsch der jungen Frau, die eines Tages aufbricht, um nichts Geringeres als das in Erfahrung zu bringen. Am Anfang also war eine Sehnsucht, wie sie tiefer nicht vorstellbar ist. Nicht die Erkenntnis mit den Mitteln des abendländisch definierten Verstandes, der die Möglichkeiten allen Erkennens auf den engen Rahmen eines rationalistischen Weltbildes beschränkt, sollte es sein, sondern ein Erkennen, das die künstliche Trennung von Körper, Geist und Seele einerseits und diejenige von erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt andererseits überschreitet. Welterkenntnis wäre Selbsterkenntnis und vice versa. Und damit wäre es noch nicht zu Ende: Auch das erkennende Ich in seiner grausamen Beschränktheit auf genetische Ausstattung und biographische Fundamente würde sich in diesem unendlich verlockenden Strom des Erkennens auflösen und alle Zweifel über die Natur der Dinge und Wesen hinter sich lassen. Vielleicht ist es ja letztlich dasselbe, was all jene gewollt haben, die sich über die Verlockungen von Macht, Besitz und Geliebtwerden hinaus nach diesem Anderen, Unsagbaren sehnen (nicht wenige von ihnen sogar verzehren): Die Philosophen und Mystiker aller Religionen und Epochen, die nach dem suchten, was in der christlichen Mystik als „unio mystica“, im Zen-Buddhismus als „satori“, im Hinduismus als „moksha“ benannt wird: Der anhaltende Zustand der Erleuchtung. Dass gerade dieses unbändige Wollen sich als größtes Hindernis vor der Erfüllung erweisen wird, ist eines der Paradoxa dieses Weges. Wie Millionen von jungen Menschen ab Mitte der Sechzigerjahre hat die zwanzigjährige Ulrike genug von dem lauen, für Geist und Seele zerstörerisch scheinenden Leben, das ihre Elterngeneration für sie vorgesehen hat, lässt die deutsche Langeweile zwischen abgeschlossenem Wiederaufbau, unbewältigten Kriegstraumata und beginnender Saturiertheit hinter sich und bricht – nach einem intensiven Umweg als Entwicklungshelferin in Äthiopien – nach Rishikesh im Norden Indiens auf. Meditation, ein Meister mit fantastischem Ruf (die Beatles und andere Prominente werden seinen Namen mit in den Westen tragen), Mantras und Yoga, am allerwichtigsten aber wahrhaftige Hingabe, die die Antwort auf alle Fragen als Lohn verspricht, das ist der Weg, den sie zu gehen versucht und in aller Konsequenz verfolgt. Sie begegnet Menschen, die sie beeindrucken und die die nächsten Schritte befördern. Ulrike Schrott zeichnet in ihrem Buch die Geschichte ihrer Suche mit Sorgfalt und unnachahmlichem Humor nach, der aber keinen Zweifel an der Tiefe und Ernsthaftigkeit ihres Wegs offen lässt. Doch das zweifelnde, fragende, alles – auch den Meister – und vor allem sich selbst in Frage stellende Ich will nicht zur Ruhe kommen, und ich meine: glücklicherweise. Dennoch wird hier nicht Bilanz gezogen, sondern der Versuchung einer wütenden Abrechnung widerstanden. Nicht urteilen, sondern wahrnehmen und sich erinnern in aller Bewusstheit darüber, dass „jeder Mensch eine Geschichte erfindet, die er für sein Leben hält“ (Max Frisch), das ist der Tenor dieses Buchs, das, gerade weil es ohne alle Widersprüche einebnenden Urteile auskommt, dem eigenen Nachdenken und Erkennen einen weiten Raum eröffnet. Es wird erzählt, wunderbar lebendig, mit wachem Verstand und mit großer Einfühlung in die junge Frau (und in andere, mit denen sie ein Stück dieses Wegs teilte), die sowohl Euphorie als auch Verzweiflung mit bewundernswerter Hartnäckigkeit durchlebt und auch übersteht. So formt sich aus den Bruchstücken für die LeserInnen ein vielfältiges Bild des Zeitgeists der Sechziger und Siebziger Jahre, es formt sich auch das Bild eines Menschen, dessen Suchen, Finden, Verlieren und Neufinden (vielleicht sogar: sich neu erfinden) bei aller Einzigartigkeit etwas Exemplarisches bekommt, das berührt. Nicht wenige sind auf diesem Weg zugrunde gegangen, auch das ist etwas, das Ulrike Schrott nüchtern im Blickfeld behält und in ihrem Buch nachzeichnet. Auch die Entwicklung der Nachfolgeorganisation Maharishis wird kritisch beleuchtet. Scheitern aber, dies ist vielleicht eine der Schlussfolgerungen dieses Buchs, ist kein hinreichender Grund, einen großen Versuch, ein großes Wagnis zu diskreditieren. Was ist Scheitern überhaupt, was Gelingen? In Rainer Maria Rilkes „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ heißt es an einer Stelle: „Ist es möglich (…) dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen, und dass man die Jahrtausende vergehen hat lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ja, es ist möglich.“ Dieses Buch ist ein wunderbarer Versuch, gerade in aller Nüchternheit und großer, sich selbst wahrhaftig nicht schonender Offenheit, dieser Gefahr nicht zu erliegen. Gudrun Seidenauer
Prolog Ich schaute ihn an. Sein Blick war offen, ernst, zugewandt – ein ruhiges Schauen. Nur Kleinkinder hatten mich bisher so angeschaut und verunsichert. Viele Erwachsene sehen sich im Brennpunkt eines derartigen Kinderblickes gezwungen, Grimassen zu schneiden und unsinnige Laute von sich zu geben. Mit allen Mitteln versuchen sie, dem stillen Ernst ein Lachen abzuringen, das seine beunruhigende Tiefe verschleiert. Ich versank in Maharishis Blick wie ein Stein in einem tiefen Brunnen. Das war Anfang 1970 in Indien. Ich hatte mich mit ca. achtzig Suchenden aus aller Welt in seinem Ashram in Rishikesh eingefunden. Er lag nördlich der Stadt auf einem der letzten Abhänge des Himalayas. Wenn man aus der Lecture Hall trat, öffnete sich der Blick an einem Steilufer über dem flach dahinfließenden Wasser des Ganges, wanderte hinüber zur Stadt und weiter in das trockene Ocker der Ebene, die am Horizont verschwamm. Wir waren Eindringlinge, Unwissende aus dem oberflächlichen Westen. Unter den Kursteilnehmern war kein einziger Inder. Sadhus saßen auf der anderen Seite des Ganges am kieselsteinigen Ufer und meditierten so wie wir, oder meditierten wir so wie sie? Wir waren in ihren Augen wahrscheinlich ein Haufen verrückter Hippies, so wie sie damals zu Tausenden auf der Suche nach Erleuchtung nach Indien pilgerten. Ihre Religion, ihre Götterwelt, ihre Riten und Gebräuche waren für uns eine phantastisch bunte Märchenwelt, deren wahren Kern und deren Weisheit es zu entdecken galt. Sie sahen uns kritisch, erstaunt und gelassen zu, wenn wir zum Baden hinunter an ihren heiligen Fluss kamen. Unterhalb des Ashrams hatte die Strömung eine tiefe Mulde ausgeschwemmt, so dass wir tauchen und schwimmen konnten. Wir stürzten uns lachend und lärmend in die Flut. Wir nahmen kein rituelles Bad. Unser Zugeständnis an indische Wertvorstellungen bestand darin, dass Frauen nur züchtig in Punjabis gehüllt ins Wasser sprangen. Aus der Pilgerstadt dröhnten heilige Gesänge in fremden Skalen und Rhythmen herüber, unentzifferbares Gedudel in meinen westlichen Ohren. Ich wollte Maharishi so viel fragen, wollte ihm mein Herz ausschütten, wollte ihn die kryptischen Puzzlesteine, in die mein Leben zerfallen war, zusammenfügen lassen, wollte mich ihm öffnen – so glaubte ich jedenfalls – aber sein Blick wischte alles weg. “I have heard that you were in Ethiopia. Tell me about the country, how are the people there?” Ich war verwirrt, ich wollte nicht über Äthiopien sprechen, das Thema „Entwicklungshilfe“ hatte ich abgehakt – ich stotterte herum und kam mir ziemlich dumm vor. Dann war das Gespräch auch schon vorbei. Als ich im Gehen begriffen war, sagte Maharishi: “People say, it’s too dark in the lecturehall at night. Take care, that there is a candle at each seat tonight.” Ich tauchte noch einmal in seinen Blick, konnte aber nicht erkennen, ob er diese Anweisung ernst meinte. Er wandte sich schon dem Nächsten zu. Ich hatte für den Kurs bezahlt, 2.400 DM genau, inklusive Unterkunft, Verpflegung, Hin- und Rückreise. Das war damals viel Geld für mich. Ich war gekommen, um zu meditieren, um zu lernen. Wieso sollte ich mich um Kerzen kümmern? Ich gehörte nicht zum Personal. Damals war Maharishi für mich alt, alt an Jahren. Sein ergrauendes Haar fiel lang und leicht gewellt auf seine Schultern. Sein Vollbart war dunkel und wallte nur in der Mitte weiß von seinem Kinn. Er war wohl Anfang sechzig, vielleicht auch etwas jünger. Niemand wusste es so genau. Seine dunkle Haut war glatt und strahlte Wärme aus, die braunen Augen waren klar. Gerüchten zufolge stand in jedem seiner Pässe, die über die Jahrzehnte hinweg ausgestellt worden waren, ein anderes Geburtsdatum. Einmal besuchte Tatwalla Baba, ein Hindu-Heiliger, den Ashram. Bis auf einen Lendenschurz aus Sackleinen war er nackt. Seine Haut war glatt und spannte sich goldbraun über einen aufrechten, muskulösen Körper. Er ging leicht und federnd. Aschfarbene Dreadlocks schleiften einen halben Meter am Boden hinter ihm her, wenn er sie nicht wie einen Turban um den Kopf geschlungen hatte. Ein Kursteilnehmer fragte Tatwalla Baba nach seinem Alter. Maharishi, der Fragen und Antworten ins Hindi übersetzte, wehrte ab: “One does not ask a wave on the ocean, from where it comes.” Es hieß, Tatwalla Baba sei über vierhundert Jahre alt. Ich war fünfundzwanzig nach westlicher Zeitrechnung.
Bei den Abendlectures gingen dann Einzelne auf die Bühne und präsentierten ihren Vortrag. Manche glühend, überzeugend, andere sachlich, manche schüchtern, aber stolz. Unter ihnen war auch eine ältere Amerikanerin. Sie hätte eine in die Jahre gekommene First Lady sein können: gertenschlank, immer perfekt gekleidet und zurechtgemacht. Sie war, glaube ich, die Einzige, die während des ganzen Kurses nicht ein einziges Mal in bequemen Sandalen oder legerer Kleidung herumgelaufen war. Ich kannte sie nur gebügelt und frisch vom Friseur, mit gefärbtem und perfekt dauergewelltem Lockenkopf. In ihren mittelhohen Pumps ging sie zierlich auf die Bühne, setzte sich mit sittsam zusammengeschnürten Knien auf einen Stuhl, knickte die parallelen Unterschenkel mit kokett gestreckten Füßen schräg zur Seite und wandte den Kopf Maharishi zu: “It still has to be dressed up a little bit”, bemäntelte sie entschuldigend den Vortrag, den sie uns halten wollte. Maharishi lächelte: “But you are always perfectly dressed up!” Ein wohlwollendes Gelächter rollte durch die Halle. Die First Lady lächelte errötend, stolz und verschämt und begann: “Transcendental Meditation is not a normal meditation, but a very special meditation, which has been brought to us by Guru Dev, Maharishis Master, and you don’t have to sit in a lotus-position all the time, but you can sit as well in a comfortable chair in your living room or in your bed, or wherever you like, maybe at the ocean or even in the underground.” Sie hielt inne und warf Maharishi einen fragenden Blick zu. Er schaute erst sie, dann uns, dann wieder sie an und meinte: “The first sentence”, er schaute in die Runde und dann lachte er fast heraus, “was horrible!” Alle lachten, aber keiner lachte die First Lady aus, im Gegenteil, wir lagen ihr zu Füßen. Sie selber lachte auch, über sich und über die ganze Situation. Uns allen war mit diesem Lachen die Bürde von den Schultern genommen, einen perfekten Vortrag halten zu müssen. Wir waren alle keine tollen Redner, aber jetzt wussten wir, dass das nichts ausmachte. Nie wieder habe ich eine vom verbalen Wortlaut her so vernichtende Kritik gehört, die gleichzeitig einer Liebeserklärung gleichkam und fast wie eine Auszeichnung wirkte. Der Kurs klang langsam aus. Auch für diese Zeit hielt Maharishi noch Überraschungen für uns bereit. An einem Abend kam Tatwalla Baba und beantwortete Fragen: “Something good is going to happen, when the cloth and the silk are coming together”, sagte Maharishi und bezog sich auf sein eigenes seidenes Gewand und den Lendenschurz aus Sackleinen von Tatwalla Baba. Tatsächlich kamen sie Hand in Hand auf die Bühne. Maharishi war klein und fast niedlich im Verhältnis zum hochgewachsenen Tatwalla Baba. Er beantwortete alle Fragen, die Maharishi übersetzte. Ich kann mich an fast keine erinnern und weiß nur noch, dass mich der Einklang zwischen diesen beiden Heiligen, die äußerlich so verschieden waren, sehr beeindruckt hat, ähnlich wie viele Jahre später der Kontrast zwischen den beiden Therevada-Mönchen in unserer österreichischen Küche. Der eine studierte Religionswissenschaft und wohnte bei uns. Während des Semesters ließ er sich die Haare zu einer schwarz gelockten Mähne wachsen und kleidete sich ganz normal in Jeans und T-Shirts, oder Pullover. Wenn er nach Deutschland zu seinem Mönchsbruder fuhr, rasierte er sich eine Glatze und zog seine orangefarbenen Tücher an. Einmal kam sein Mönchsbruder unerwartet nach Salzburg. Da saßen sich die beiden an unserem Küchentisch gegenüber: Der Deutsche, wie immer mit Glatze und orangefarbenem Gewand, und der Student, mit Lockenpracht und in Jeans. Zu seiner Entschuldigung brachte er vor, dass er niemals wagen würde, so wie sein Mönchsbruder herumzulaufen, weil die Menschen es in unseren Breiten einfach nicht verstehen würden. Darauf antwortete der Mönchsbruder: „Und ich würde nicht wagen, so wie du herumzulaufen.“ Woraufhin beide in ein schallendes Gelächter ausbrachen. „Im Buddhismus ist jeder sein eigener Chef“, hatte der Student einmal zu mir gesagt. „Es gibt niemanden, der einem anderen etwas zu befehlen oder zu verbieten hat. Wenn jemand bestimmte Gebote nicht einhält, dann hat er das allein mit sich selber auszumachen.“ Ähnlich verschieden und doch im Einklang saßen Tatwalla Baba und Maharishi nebeneinander. „Was ist das Leben?“ fragte ein Amerikaner und Tatwalla Baba antwortete ohne zu zögern, laut und langgezogen: „O–h–m.“ Dann meditierten wir alle zusammen und es war eine der tiefsten Meditationen, die ich je erlebte. Jeder kennt die steigernde Wirkung vieler Menschen, die konzentriert lesen oder zuhören. Genauso vertiefte die gemeinsame Meditation das Meditationserlebnis – und dies umso mehr, wenn zwei geistige Atomreaktoren wie Maharishi und Tatwalla Baba ihre Energie in kleine Umspannwerke einspeisten. . Dann kam die Zeit des Abschiednehmens. Es war nicht so, dass der Kurs exakt am 30. April vorbei war, wie es bei westlichen Veranstaltungen üblich gewesen wäre. Jeder fuhr, wann es ihm beliebte. Die Küche kochte weiter, die Zimmer wurden nicht gleich für den nächsten Schub Suchender gebraucht. Wir lungerten im Ashram herum, ließen uns treiben und die Zeit ausklingen. Wie alle anderen, ging auch ich in dieser Zeit mit meiner Gita zu Maharishi, damit er mir eine Widmung hineinschriebe. “Are you already leaving?”, war seine erste Frage. Hätte ich gewusst, was ich heute weiß, hätte ich das als eindeutige Aufforderung verstanden, zu bleiben, hätte auf jeden Fall nachgefragt, ob ich bleiben solle oder bleiben dürfe. Es hätte mich ja nichts daran gehindert. Ich hatte keinen Job und auch sonst keinerlei Verpflichtungen. Auf meinem Konto war genügend Geld. Warum also blieb ich nicht? Ohne einen Moment zu zögern, beantwortete ich Maharishis Frage mit einem schlichten “Yes” und er fragte nicht weiter. Er nahm meine Gita, schlug sie auf und begann zu schreiben. Dann hielt er inne, dachte nach und fragte mich: “How do you spell your name?” Er wusste nicht, wie ich hieß, woher auch? Nur von dem einen Mal, als ich unter seiner direkten Obhut stand? Damals war mein Name völlig unwichtig gewesen. Ich verstand sehr wohl, dass er meinen Namen wissen wollte und zu höflich war, direkt nach ihm zu fragen. Er täuschte mir zuliebe vor, meinen Namen zu kennen und lediglich über die Schreibweise im Unklaren zu sein. Gerührt von seinem Feingefühl machte ich das Spiel mit und buchstabierte. Dann schrieb er weiter, schloss die Gita und gab sie mir lächelnd zurück. Ich dankte und verabschiedete mich. Draußen setzte ich mich auf die Stufen, die zu seinem Haus führten, und öffnete das Buch. Tränen schossen mir in die Augen. Ich schloss die Gita und konnte nicht aufhören zu weinen. Constanze kam, legte den Arm um mich und fragte, was los sei, aber ich konnte es nicht sagen. “Dear blessed Ulrike, enjoy the wisdom and radiate life for all to enjoy.” Niemand konnte ermessen, was diese Zeilen für mich bedeuteten. Meinen vollen Namen kannte ich nur im Zusammenhang mit bösen Taten. Rieckerchen, Hummelchen, Agathe, Thusnelda, Kalinchen Hopsassa und Gewitterziege waren nur einige der Namen, mit denen meine Mutter mich immer betitelt hatte. Sie rief mich nie bei meinem vollen Namen, schrieb auch alle Briefe an „mein Riekchen“ oder „mein Riekerchen“. Meinen vollen Namen bekam ich nur zu hören, wenn ich jemandem vorgestellt wurde: „Das ist unsere Tochter Ulrike.“ Dann klang es steif, fremd und offiziell. Oder wenn ich etwas ausgefressen hatte: „Ulriiiiike!“ Dann klang er bitterböse, empört und drohend, Unheil verheißend. Jetzt hatte mich jemand nicht nur mit diesem vollen Namen angesprochen, sondern er hatte ein wichtiges Wort hinzugefügt: “blessed” – “blessed Ulrike”. Ich war gesegnet. Es war anders als der Segen in der Kirche: „Der Herr segne Euch und behüte Euch, er lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig.“ Wer wusste jemals, ob er wirklich gesegnet war? Es war der fromme Wunsch irgendeines Pfarrers, und niemals wusste man, ob diesem Wunsch auf höherer Ebene auch entsprochen wurde. Ich jedenfalls hatte mich aus unerfindlichen Gründen von diesem Segen immer ausgenommen gefühlt. Aber jetzt war ich gesegnet. Ganz einfach gesegnet, ohne Wenn und Aber. Das allein hätte schon genügt, um mich im Innersten zu treffen. Aber dann stand da noch: “enjoy the wisdom” – freue dich der Weisheit, es stand nicht: Lerne die Weisheit, folge der Weisheit oder befolge die Weisheit. Nein, es stand: Genieße die Weisheit. – Ja, ich wollte sie genießen, aus ganzem Herzen. “And radiate life for all to enjoy.” Ja, ja ja ja! Ich wollte alle glücklich machen, ich wollte das Leben selbst in seiner Fülle ausstrahlen und alle glücklich machen, so wie ich selbst das Glück empfangen hatte. „Weil du so gut und so wert bist, geachtet vor meinen Augen, musst du auch herrlich sein, und ich habe dich lieb.“ – mein Konfirmationsspruch. „Weil du so gut und so wert bist.“ – nichts von Lebensfreude. „Gut“ und „wert“ waren moralische Kategorien. „Musst du auch herrlich sein“ – Jedes „Sein-Müssen“ ist eine Verpflichtung, die nicht besser, sondern eher schlimmer wird, wenn das geforderte So-Sein auch noch als „herrlich“ bezeichnet wird. Wie macht man das? „Und ich habe dich lieb“ – das kam wie ein Nachhall nach der Erfüllung der Pflicht. Dieser Spruch hatte mich mit Moral und unendlich hohem Anspruch überfordert.
| Sprache | deutsch |
|---|---|
| Maße | 140 x 220 mm |
| Gewicht | 316 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Essays / Feuilleton | |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Entspannung / Meditation / Yoga | |
| Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Esoterik / Spiritualität | |
| Schlagworte | Alltagsstress • Ashram Rishikesh Indien • Ayurveda • Beatles • Bewusstseinsänderung • Buddhismus • Christlicher Glaube • Entspannungsmeditation • Esoterik • Feng Shui • Gesund und krank durch Meditation • Langzeitmeditationen • Maharishi Mahesh Yogi • Meditation • meditation für anfänger • Meditationslehrer • Meditationstechniken • meditieren • Östliche Meditation • Psychiatrie • Ratgeber zur Meditation • Sechzigerjahre • Selbsterfahrung • Selbstmord • Spiritualität • Stressbewältigung durch Meditation • tägliche Meditation • Transzendentale Meditation TM • Wirkung von Meditation • Yoga |
| ISBN-10 | 3-902647-34-5 / 3902647345 |
| ISBN-13 | 978-3-902647-34-4 / 9783902647344 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich