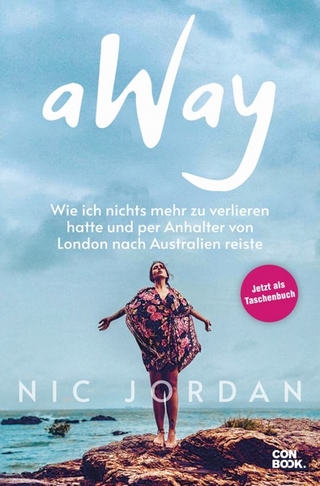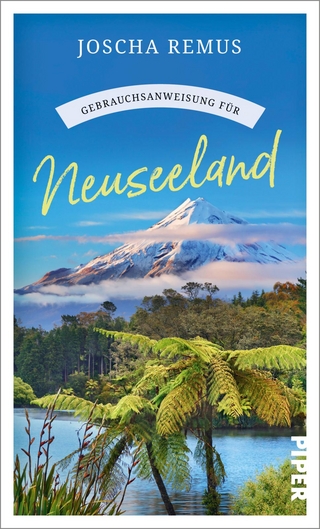Papua Neuguinea - Leben im Regenwald
Interconnections medien & reise e.K. (Verlag)
978-3-86040-138-5 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Ausgefallene Lebensgeschichte aus einem fernen Land von ganz unterschiedlicher Kultur.
Die Autorin begleitete ihren Mann mehrere Jahre bei seinem Einsatz auf einer Missionsstation im Urwald in den Siebziger Jahren. Sie ist jung, neugierig, hat bis dahin noch wenig erlebt. Papua Neuguina war einst deutsche Kolonie gewesen. Zur ideologischen Absicherung des kaiserlichen Herrschaftsanspruchs wurden - wie immer - Missionare ausgesandt, die den schönen Vorteil besaßen, billiger als das Militär zu sein und für eine "innere" Unterwerfung zu sorgen. So stammt auch der Ehemann der Autorin aus der Familie des damaligen "Pioniermissionars" in Neuguinea, Christian Keysser, manchmal auch als "Keyßer" zu finden.
Sie fand sich in der ungewohnten Umgebung bald zurecht, schloss Freundschaft mit den Frauen am Ort, begann, Pidgin-Englisch zu erlernen. Obwohl sie weder irgendwelche besonderen Kenntnisse geschweige denn eine entsprechende Ausbildung besaß, übernahm sie die Krankenstation und machte sich nützlich.
Sie schildert ihre Erlebnisse in einer Kultur zwischen Vergangenheit, archaischen Riten, und Moderne, die Konflikte und Veränderungen, die bei einem zweiten Einsatz in einer größeren Stadt zu beobachten sind. Korruption, Gewalt, Rodungen durch ausländische Konzerne und auch christliche Heuchelei.
Auch interessante Details aus der Keysser-Zeit kommen ans Licht, so z.B. ein misslungener "frommer Weibertausch".
Eine Art Lebenslauf Geboren wurde ich 1949 in Urspringen (Unterfranken) in der „Villa“, einer Polizei-Station, in der mein Vater Dienststellenleiter war. Ich wuchs auf in Erlenbach a. Main in einem christlich geprägten Elternhaus. Obgleich ich mit meiner Mutter am Mainufer Brennnesseln als Spinatersatz sammelte, hatte ich immer das Gefühl, es sei „alles da“. Was wirklich da war, war Wärme: Andersens Märchen, Peter Rossegger, Bratäpfel in der Weihnachtszeit am Kachelofen. Später stand ich oft frierend mit meinem Geigenkasten am Bahnhof. Ich besuchte das Deutsche Gymnasium in Aschaffenburg, das jetzt wohl als „Musischer Zweig“ bezeichnet wird. In dieser Zeit verschlang ich alles, was lesbar schien: Liebesromane aus der Leihbücherei, Jerry Cotton-Hefte, Pearl S. Buck („Die Frau des Missionars“), Thomas Mann – mir galt alles als Literatur. Meine Ausbildung als Religionslehrerin absolvierte ich am Katechetischen Seminar in Neuendettelsau. Dieser Ort wurde von Insidern auch als Pfarrfrauenfabrik bezeichnet, da neben etlichen Ausbildungsstätten für Frauen dort auch die Augustana Hochschule und das Missionsseminar waren. Bei der Anstellungsprüfung zur Religionslehrerin war ich bereits hochschwanger, weil ich mein erstes Kind in der Sicherheit Deutschlands zur Welt bringen wollte. Nach dem zweiten Aufenthalt in P.N.G. zeigte sich, dass mein Mann und ich unseren gemeinsamen Weg zu Ende gegangen waren. Mein beruflicher Weg führte mich nach Landsberg a. Lech, wo ich zehn Jahre als Sozialpädagogin in der Asylberatung arbeitete. Hier lernte ich meinen zweiten Mann kennen, der in der gleichen Einrichtung für die Regierung von Oberbayern arbeitete. 2003 brachen wir unsere Zelte in Landsberg ab, um uns meinen alten Eltern widmen zu können. Ich pflegte meinen demenzkranken Vater bis zu seinem Tod im August 2007. Zum Ausgleich schrieb ich in seinen letzten Monaten abends an meinem Manuskript.
Teil 1
Beginn der Regenzeit
Der Anfang
Über Adelaide nach Lae
Schiffsüberfahrt in den Südseetraum
Orientierungszeit auf der Küstenstation Biliau. Erste Eindrücke der fremden Kultur Initiationsfest für junge Männer
Meine Freundin Gananui und was bleibt
Ankunft auf der Außenstation Begesin. Beschreibung des Alltagslebens
Teil 2
Zeit, was ist das?
"Eine weiße Missis kann nähen"mit seinen sinnlichen Farben und Gerüchen" als Land im Umbruch.
Dabei thematisiert sie auch die Zerstörung einer Kultur durch den Raubbau an der Natur - und den Menschen.
Sie verrät nicht nur, warum Kaviere Heizungen benötigen (weg. Rostbildung an den Saiten), sondern auch
- warum so viele Leute von Husten geplagt sind
- was die Mutterbrust mit Ferkeln zu tun haben kann
- warum Hühnerfleisch stets so seltsam zäh daherkommt
- welcher der beste Gegenzauber bei Verhexung ist
- warum Frauen beim Schleppen von Lasten am besten geeignet sind
- was zu tun ist, wenn man jemanden nicht riechen kann
- wie sie sich den Titel einer Bauchversieglerin einhandelte
- wie "fliegende Lasttauben" - auch, wenn sie es nicht kann
Übernahme der Krankenversorgung. In weiße Haut spritzen - geht das?
Sanguma-Sinsing, Todeszauber-Tanzfest mit Folgen
Buschtrips - wie einfach ist doch das Stationsleben
Besuch einer Gottesanbeterin
Die kiaps kommen
Der Mund hat genug gesprochen
Besuche aus Deutschland
David mit Puma in Begesin
Sprache erfinden
Zauberei und Medizin
Malaria
Abschied von Begesin
Deutschland
Teil 3
Erneute Ausreise nach P.N.G.
Alltag im Lutheran Shipping Compound
Zeit des schweren Herzens für Janna
Ein anderes heißes Land
Amron, unsere Station
Waterhole
O Sinub ooo - wir hatten eine Insel in Papua Niugini
Alltag im Südseetraum
Amos geht ins Internat im Hochland
Onerunka und archaische Gefühle in Raipinka
Leitung des Lutheran Guest House in Madang
Eine andere Art, zu reisen
Reiseleitung bei deutschen Touristen durch Niugini
Begegnungen mit Menschen im heißen Land Niugini
Teil 4
Heimaturlaub in Deutschland
Heimatgefühle
Tschernobyl und das Leben geht weiter, auch in Niugini
Vorträge über Niugini auf der Kazakhstan
Zeit ohne Kinder
Veränderungen
Schatten über dem Paradies
Alles hat seine Zeit
Die Seele geht zu Fuß
Beginn der Regenzeit Während der Nacht hatte es unaufhörlich in Strömen geregnet. Am Abend war der Regen über den Urwald wie eine Wand herangerauscht. Erst waren die Vögel verstummt, die Natur war still geworden, wie tot, dann war nur ein leichtes Raunen zu vernehmen, ein Geräusch, wie im Windhauch aneinanderreibender Blätter. Je mehr sich der Regen näherte, desto mehr steigerte sich dieses Geräusch, immer unüberhörbarer werdend, bis es wie ein Wasserfall klang. Als der Regen das Haus erreicht hatte, trommelte er gleichförmig, laut und eintönig auf das Wellblechdach ein. Im Bett wirkte dieses gleichmäßige Prasseln irgendwann einschläfernd. Ich erwachte, wie eigentlich immer, vom Geschrei der Vögel. Die Einheimischen nannten sie garamut bilong tudak, Baumtrommeln der Dämmerung. Egal, ob Trockenzeit oder Regenzeit: kurz vor oder nach sechs Uhr ließen diese Vögel keinen Zweifel daran, dass die Nacht vorüber war. Jetzt ist sie da, die Regenzeit, dachte ich frohlockend beim Aufstehen. Sicher hatte schon diese eine Nacht genügt, die klaffenden Risse im Rasen um das Haus ein wenig zu schließen. Nur wenige Tage würden genügen, alles, was ringsum braun und verdorrt war, wieder ergrünen zu lassen. Ich ging in die Küche, um die Spritzen zum Auskochen aufzustellen. Vom Gang aus hörte ich meinen Sohn Amos in seinem Zimmer vor sich hinbrabbeln und singen. Stolz stellte ich den Topf mit den Spritzen auf meine neueste Errungenschaft: einen Gaskocher mit zwei Feuerstellen. Vorbei die Plackerei, als ich noch umständlich ein Feuer im Herd anzünden musste, um langsam das Wasser zu erhitzen. Welch eine Erleichterung gegenüber vorher! Während die Spritzen vor sich hinköchelten, holte ich mir aus dem Kerosin betriebenen Kühlschrank und dem Fliegengitter-Vorratsschrank mein Frühstück. Hätte es diesen Schrank nicht gegeben, so hätte man ihn erfinden müssen. Das Fliegengitter schützte die Lebensmittel vor Kakerlaken. Die Füße des Schranks ruhten zusätzlich in kerosingefüllten Dosen, so dass die Vorräte vor den allgegenwärtigen Ameisen sicher waren. Diese kamen in jeder Gestalt vor: im Haus waren es die ganz kleinen feinen – sie waren praktisch überall, so dass sogar im Wohnzimmer die Getränke jeweils in eine wassergefüllte Untertasse gestellt werden mussten. Draußen gab es eine weitere Vielfalt dieser lästigen Spezies. Da waren die mittelgroßen schwarzen Ameisen sowie die größeren schwarzen – begierig auf alles Vertilgbare. Am schlimmsten waren die kurakum, große rote, die sich vor allem an den Obstbäumen breitmachten und so richtig gemein und schmerzhaft zubeißen konnten. Am Vortag, dem letzen in der Trockenzeit, wie ich nun wusste, hatte ich Roggenbrot gebacken. Gut war es geworden, nach dem Rezept einer Freundin in meinem handgeschriebenen Kochbuch, „feuchtes Roggenbrot à la Anita“. Wir deutschen Frauen in Papua Neuguinea (P.N.G.) waren ständig dabei, Brotrezepte auszutauschen. Zum Roggenbrot gab es gesalzene Butter und Guavenmarmelade vom Baum vor dem Küchenfenster. Nachdem die Spritzen zwanzig Minuten gekocht hatten, ging ich ins Badezimmer. Amos war noch bei seinem Morgenritual, einem Vorsichhinträllern im Bett. Irgendwann würde er kommen, um kaikai, Essen zu verlangen. Dann würde er sich auf den Weg machen und die Veränderungen der Welt da draußen erkunden. Erst würde er ins Waschhaus gehen zu den Hausmädchen Yagamar und Sisies, die bereits geschäftig den Kerosinwasserkessel für die Wäsche anheizten. Wasser, wir hatten wieder kostbares Wasser! Und das mit Sicherheit noch für einige Monate. Hausmädchen und Außenarbeiter waren üblich auf einer Missionsstation wie Begesin. Für das Hausmädchen bedeutete das Angelerntsein in einem Missionshaushalt eine deutliche Steigerung des Brautpreises, der hauptsächlich in Schweinen entrichtet wurde. Für den wokboi, den Außenarbeiter, war draußen im Busch die Anstellung eine gute Möglichkeit, sich eben diesen Brautpreis zu verdienen, um eine Familie gründen zu können. Begesin war eine klassische Außenstation. Gute dreißig Flugminuten mit einer Cessna von der Hafenstadt Madang entfernt – man flog über unermessliche Flächen von Regenwald, dazwischen einige Buschdörfer – lag es mitten im Urwald. Eine Außenstation mit Missionarshaus, mehreren Schulhäusern, Buschhäusern für die Lehrer und den Pastor, und einem Stationsladen, umgeben von brandgerodeten Gärten. Und: Begesin war nicht irgendeine Missionsstation, Begesin war bekannt als Gebiet für Sanguma, Todeszauber. Wer immer in der Küstengegend um Madang und auch weiter weg einen Menschen zu Tode zaubern lassen wollte, der wandte sich an den Zauberer von Begesin. Im Badezimmer ließ ich meinen Blick erst einmal über den ganzen Raum schweifen, eine Art Automatismus, den ich mir angewöhnt hatte. Einmal war es vorgekommen, dass ich nachts auf dem Weg zur Toilette eine kleine, dunkle – und somit wahrscheinlich giftige – Schlange in der Dusche entdeckt hatte. Den Schein meiner Taschenlampe auf sie richtend, hatte ich nach meinem Mann Michael gerufe, der die Schlange durch Schläge mit einem Besenstiel auf den Fußboden nach draußen auf die Veranda vertrieb. Danach hatten wir über dem Abflussrohr der Dusche ein Gitter befestigt. Ich ließ die Eimerdusche am Seil herab, füllte sie mit Wasser, zog sie hoch und gab mich dem Genuss einer Dusche hin. Das hatte ich gelernt: mit einem einzigen Eimer Wasser kann man sich einseifen, abspülen und sogar die Haare waschen. Ab heute konnte ich mit dem Wasser wieder viel freizügiger umgehen, denn heute Abend oder auch einige Abende später würde es mit Gewissheit erneut gießen. „O wie schön“, dachte ich, „Regenzeit“. Die Wassertanks am Haus werden sich füllen, ich muss nicht mehr so mit Wasser geizen. Letztes Jahr hatte ich gegen Ende der Trockenzeit sogar die Wäsche im Fluss Ujapan zusammen mit den einheimischen Frauen gewaschen. Tagsüber hatten wir uns zum Wäschewaschen getroffen, gegen Dämmerung zum Baden – etwas Ritualhaftes, was ich zu Beginn der Regenperiode fast vermisst hatte. Um etwa zehn Uhr hatten sich etliche Patienten versammelt, die von mir behandelt werden wollten. Geduldig saßen sie als Gruppe im Schatten eines riesigen Nadelbaums. Sie klatschten, erzählten Geschichten und kauten Betelnuss ohne Ende. Dabei wurden immer Betelnüsse und daka, so etwas wie Weidenfrüchte sowie kambang, eine Art weißes Kalkpulver, miteinander gekaut und untereinander ausgetauscht. Zu meinem Leidwesen wurde der beim Kauen entstehende rote, dünnflüssige Brei einfach in den Rasen gespieen. Ich ging mit meinen ausgekochten Spritzen außen am Haus entlang zur dispensary, dem Zimmer am Ende des Hauses, das wir als Krankenstation eingerichtet hatten. Im Vorbeigehen hielt ich kurz bei Michael an, der dabei war, mit den wokbois das Gras um das Haus zu mähen. Sie arbeiteten mit Sensen und lachten gerade heftig über irgendeinen Scherz. Ein Blick bestätigte mein vorabendliches Empfinden. Die Luft über den Rasenflächen um das Haus waberte wie in Nebelschleiern. Die Sonne war bereits gierig dabei, die niedergegangenen Regenmassen aufzusaugen, wobei mit jedem Regentag die Luftfeuchtigkeit steigen würde. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, dass unter den Wartenden auch Orkap, der große Zauberer von Begesin, war. Immer wieder mal pflegte dieser listige Typ bei mir aufzukreuzen. Nach meinem Verständnis verband uns eine gute Feindschaft; wir gingen bewusst höflich und respektvoll miteinander um. „Moning, Mama!“, rief er verhalten grinsend zu mir herüber. Klar, ich hatte ein Kind, war also Mama und als solche – obwohl erst vierundzwanzigjährig – Respektsperson. Aber für ihn, den Hüter dunkler Geheimnisse? Uns verband das Wissen, dass Kranke sich an ihn genauso wie an mich um Hilfe wandten, vielleicht als Doppelkonsultation, oder auch abwechselnd. Was wollte dieser Mann? Das habe ich nie so recht herausbekommen. Immer, wenn ich ihn sah, stieg ein beklemmendes Gefühl in mir hoch, eine Ahnung, als Weiße die Einheimischen nie wirklich verstehen zu können. Ich hatte ihn genau beobachtet, wie er als Zauberer ein Sanguma-Singsing, ein Todeszauber-Tanzfest, anleitete. Das rhythmische Stampfen, die Gesänge, Gerüche und die Beklommenheit, trug ich noch tief in mir. Bevor ich den ersten Kranken hereinrief, musste ich mich innerlich schütteln, um die klammen Erinnerungen abzustreifen. Wie immer hatte ich viel Penicillin in Öl zu spritzen. In den 1970er Jahren wurde damit vor allem in den Tropen noch ziemlich unreflektiert und freizügig umgegangen. Ein paar Fälle von Malaria, bei denen es galt, die richtige Dosis Chloroquin zu verabreichen und noch einige Wundbehandlungen – das Übliche. Dann, als Letzter, kam Meister Orkap herein, mein guter Feind. Ich wollte mir meine Unsicherheit nicht anmerken lassen; irgendein dunkles Gefühl bedeutete mir, dass man diesem Mann gegenüber keine Schwäche zeigen sollte. „Was ist dein Problem?“ fragte ich in Pidgin. Wie stets war er im Lendenschurz gekommen, ein mittelgroßer, muskulöser – und irgendwie furchtgebietender – Mann, aber das gestattete ich mir nur im Geheimen zu empfinden. Ein laplap, ein um die Hüften geschlungenes halblanges Tuch, war zu dieser Zeit die übliche Bekleidung für Frauen und Männer. Orkap hatte ich immer nur im Lendenschurz gesehen. Er zeigte mir ein schönes, taubeneigroßes buk am Hinterteil, eine Eiterbeule, die in den Tropen häufig vorkommt und lachte kehlig. „Mi no inap long sindaun gut na mi kam“, meinte er, „ich kann nicht gut sitzen, deshalb bin ich gekommen“. Ein Ansatz von Verstehen stieg in mir auf. Natürlich, mit so etwas „Normalem“ konnte man sich gut in die Reihen der Kranken setzen und dabei seine ganz eigenen Auskundschaftungen anstellen! Er war auf eine Penicillininjektion aus, das war mir klar, aus welchem Grund auch immer. Aber, feixte ich innerlich, die war nicht nötig. Also schmierte ich schwarze Zugsalbe auf sein buk, legte Gaze darüber und verklebte das Ganze mit Pflaster. „Em tasol? nogat sut?, das ist alles? keine Spritze?“, fragte der Meister etwas enttäuscht. Ich erklärte ihm, das müssten wir nur ein paar Tage wiederholen, dann sei er die Eiterbeule los und könne wieder sitzen. Wir trennten uns als die altbekannten Freundfeinde, die wir waren. Es war kurz nach zwölf Uhr. Ich dehnte mich in der Krankenstation, und marschierte dann mit meinem Topf voller Spritzen zur Küche zum Mittagessenkochen. Spaghetti mit Tomatensauce waren geplant, die sogar Amos mögen würde. Dieses Kind verbuschte zusehends. Allzu häufig war es in letzter Zeit vorgekommen, dass ich ihn zum Essen rief und er antwortete: „Mag nicht euer deutsches Essen, bleib bei Yagamar und Sisies!“ Trockener Reis mit Dosenfisch, über dem Feuer geröstete Maiskolben und Brotfrucht oder gebackene kaukau, Süßkartoffeln, waren ihm lieber. Ich schritt die Stufen hinunter und hielt Ausschau nach Amos beim Waschhaus – sicher war der kleine Racker dabei, mit den Mädchen heftig in Pidgin oder in der Begesinsprache, die sie ihm beibrachten, zu palavern. „Mama, yu wet!, warte“, hörte ich von hinten rufen. Eine Gruppe Menschen mit einer Tragbahre näherte sich. Zwei Männer und zwei Frauen trugen eine aus Bambusrohren und Flechtmaterial gefertigte Tragbahre auf mich zu. Im Näherkommen erkannte ich eine Frau und ein an ihren Bauch gelehntes Baby auf der Trage. Sie setzten sichtlich erschöpft die Trage vor mir auf dem Rasen ab. Gestern Mittag waren sie aufgebrochen und bis zum Einbruch der Dunkelheit gegangen. Sie hatten in einer Buschhütte in einem Garten übernachtet, und vom Morgengrauen bis jetzt bis Begesin gebraucht. Jetzt waren sie da. „Pikinini asde indai pinis, das Kind ist gestern gestorben.“ Krankheit, Zauber? Sie wussten es nicht. Aber die Nachgeburt war noch nicht gekommen, und das war doch nicht in Ordnung, oder? Ich schaute die erschöpft-graue Frau auf der Bahre an. Schwarze können bei Krankheit so grau aussehen! Ein trockenes Husten ließ ihren Körper erschauern. Das an ihren Bauch gelehnte Neugeborene bewegte sich dabei. Ein Schluchzen stieg in mir auf, es sah so lebendig aus. „Das lebt doch!“ rief ich – und legte meine Hand auf kalte, tote Haut. Jetzt konnte ich meinen Tränen nicht mehr Einhalt gebieten. Es sei auf dem Weg gestorben, sagten sie mir, ratlos-verständnisvoll angesichts meiner Trauer. Gestern hatte sie es gestillt, aber sie konnte ihm keine Kraft dabei geben. Mein Hirn war wie verbarrikadiert; kein Gedanke, der mir sagte, was als nächstes zu tun sei. Darauf mussten sie mich, die wie eine Träumende dastand, erst bringen. Die Nachgeburt war noch nicht herausgekommen, ich würde doch wissen, was da zu tun sei? In mir war nur Leere. Ich schlug das Tuch zurück, mit dem die Frau zugedeckt war, und sah schockiert die ganze Nabelschnur entlang bis an die Scheide Ameisen, kleine schwarze wuselnde Ameisen. Mein erster Gedanke – endlich überhaupt einer – war: zum Glück keine von den großen, roten! Noch immer krochen meine Gedanken im Zeitlupentempo, ich fühlte tiefe Ratlosigkeit. Schließlich war ich keine gelernte Krankenschwester. Langsam tauchte eine Lösungsmöglichkeit in mir auf. „Ich muss Euch bitten, noch bis zwei Uhr nachmittags zu warten. Erst dann kann ich über Funk jemanden im Missionshospital in Yagaum erreichen und fragen, was in diesem schwierigen Fall zu tun ist. Es tut mir Leid, aber so etwas habe ich noch nie erlebt.“ Ohne Nachfragen, ohne Zögern drehte sich die Gruppe um und zog in Richtung Baumschatten. Diese fatalistische Haltung habe ich häufig bei Einheimischen wahrgenommen. Em i olesem yet, so ist das eben. Ich brachte der Gruppe einen Krug mit Zitronenwasser, dazu Brot, Butter und Marmelade. Das wurde gelassen akzeptiert – sie wären auch ohne ausgekommen. Die Mittagszeit erschien mir endlos, trotz Mittagessens und der Zeit, um Amos zum Mittagsschlaf zu bringen. Die bange Ungewissheit machte mich bleiern und unfrei. Michael hütete sich, in mich zu dringen, ein Blick hatte ihm genügt, zu erkennen, dass ich „besetzt“ war. Nach dem Mittagessen hatte sich Amos auf meinem Schoß zurechtgekuschelt, und wir hatten das von der Oma aus Deutschland gesandte Bilderwörterbuch zusammen angeschaut. Zu jedem Buchstaben gab es einige Wörter mit Abbildungen. Bei „P“ wie Papagei waren wir heute angelangt. Auf einem Baum waren drei Papageien abgebildet. „Schau, Mama“, rief Amos begeistert. „Das issa Papagei, das issa Mamagei und das issa Amosgei!“ Wenn das nicht Sinn ergab. Pünktlich um zwei Uhr saß ich am Funkgerät und kam auch gleich als erste dran. Meine Gesprächspartnerin war zum Glück Fiona, eine australische Krankenschwester, eine echte Profifrau. Bei ihr hatte ich zwei Wochen in Yagaum gelebt und gelernt, nachdem unser doktaboi, der Krankenpfleger, davongelaufen war, weil ihn die Begesins nicht genügend mit Naturalien entlohnt hatten. Von Fiona hatte ich gelernt, Wunden zu versorgen, Injektionen zu geben, Leprakranke zu behandeln und Entbindungen durchzuführen. Sie hatte mir gezeigt, wie bei Schwangeren der Bauch abzutasten ist, um die Lage des Ungeborenen zu erkennen. Sogar einen Schmetterlingsverband hatte sie mich gelehrt, durch den ich Schnittwunden zusammenziehen konnte, um eine bessere Wundheilung zu gewährleisten. Denn „wir können jetzt nicht auch noch mit Wundennähen anfangen“. Sie war so alt wie ich und ihre Reife faszinierte mich. Geduldig hörte sie sich die Schilderung des Falles an. Nach geraumer Zeit hörte ich das gewohnte „I suggest you.“. Ich sollte also durch intensive Massage des Unterleibs versuchen, künstliche Wehen zu erzeugen, dabei in der Folge vermehrt vorsichtig an der Nabelschnur ziehen, um so die Nachgeburt zu lösen. „Versuche das ungefähr eine Stunde lang. Wenn du nichts erreichst, musst du ein ‚emergency-balus‘ bestellen.“ Das war so typisch für unsere Umgangssprache in Neu-Guinea: Emergency, also Notfall auf Englisch, balus, also Taube und zugleich Flugzeug in Pidgin. Ich landete leider beim Notfall-Flugzeug. Mehr als eine Stunde bemühte ich mich, künstliche Wehen bei der armen Frau, die keinen Ton von sich gab, hervorzurufen. Zum Schluss war ich schweißgebadet. Nichts, ich erreichte nichts, die Nachgeburt bewegte sich keinen Deut. Obwohl ich mit meiner ganzen Körperkraft arbeitete, war ich doch gleichzeitig ängstlich, der Frau wehzutun. Etwa um halb vier Uhr nachmittags wankte ich mit zitternden Beinen zum Funkgerät. „Foxtrott-Sierra“, (code für Begesin), „ruft Delta-Mike“, (code für MAF, die Mission Aviation Fellowship). Ich fühlte mich zutiefst ausgelaugt, wie eine Versagerin, hinzu kam diese unendliche Trauer über ein so junges Leben, das einfach erloschen war. Fiona informierte mich später, dass die Nachgeburt bei der Frau herausoperiert werden musste. Sie war an der Gebärmutterwand angewachsen gewesen. Aber da war ich schon bei anderen Problemen. Als ich am Abend beim Bügeln in der Küche stand, tauchte vage ein Gedanke in mir auf, schemenhaft zunächst, an den ich mich vorsichtig herantastete. Kurz nach sechs Uhr abends, die Vögel hatten gerade mit ihrem Ruf die kurze Abenddämmerung verkündet, wurde gewöhnlich von Michael der Generator angeworfen. Die ganze Station, also unser Haus, die Häuser der Lehrer und des Pastors, die Schulhäuser – alles wurde in helles Licht getaucht. Allerdings nur, wenn der Generator gerade intakt war, was allzu häufig nicht der Fall war. Kerzenlichtromantik? Dafür hatte ich zu dieser Zeit keinen Sinn und gerade war ich dabei, den Stromreichtum zu nützen. Wieder drängte es aus meinem Hinterkopf nach vorne, ich zog mich ein wenig zurück, um mich im nächsten Moment dem Gedanken wieder anzunähern. Es half nichts, ich musste mich ihm stellen. „Macht irgendetwas, das ich heute getan habe, etwas in der Welt besser?“ Da war sie, die uralte Frage der Menschen. Müsste ich nicht glücklich sein, diesen schwierigen Tag so gemeistert zu haben? Ich hatte mit meinem Ruf nach einem Notfall-Flugzeug die richtige Entscheidung getroffen, das war unbestreitbar. Aber, hatte ich damit irgendetwas in dieser Welt verbessert? Ich wollte so schmerzlich gerne eine gute Missionarsfrau sein, wollte gut sein für die Menschen, die mit mir zu tun hatten. Die Einheimischen hatten viele Missionare erlebt – und letztlich überlebt. Stellte sich für sie überhaupt die Frage, ob jemand „gut für sie“ war? Sie würden auch nach unserem Weggehen weiterleben, wahrscheinlich nicht besser, aber auch nicht schlechter. Sie mussten sich den wechselnden Gegebenheiten stellen, genau wie wir. Für sie lief dieser Anpassungsprozess seit mindestens drei Generationen, für mich war alles hier fremd, Neuland. Die Kultur, die Sprache, das Klima, die Natur – neu, ungewohnt. Woher nahm ich den Anspruch, etwas im Leben dieser Menschen verbessern zu wollen, auch noch „gut für sie“ zu sein? Erst vor einigen Wochen war Besuch von einem hohen Angestellten des Missionswerkes dagewesen. Er hatte selbst etliche Jahre auf einer Außenstation gelebt, seine hängenden Augenlider deutete ich als „gütig“. Nachdem ich stockend geäußert hatte, manchmal das Gefühl gehabt zu haben, in Deutschland boome das Leben, während ich hier im Busch in so jungen Jahren nichts davon mitbekäme, meinte der Mann mit den vermeintlich gütigen Augen: „Unter diesen Opfern ist die Mission groß geworden.“ Die Mission, groß? Wie geht das, fragte ich mich? Wollte ich ein Teil dieser Mission sein? Ich war so jung, so unerfahren, hatte so wenig Antworten auf die Fragen des Lebens. Nur Fragen türmten sich auf in mir – und sie bewirkten, dass ich mich am Ende des Tages völlig ratlos fühlte. Wieder einmal würde ich heute Abend zu Bett gehen mit der bangen Frage, was ich wohl falsch gemacht oder versäumt hatte.
Beginn der Regenzeit
Während der Nacht hatte es unaufhörlich in Strömen geregnet. Am Abend war der Regen über den Urwald wie eine Wand herangerauscht. Erst waren die Vögel verstummt, die Natur war still geworden, wie tot, dann war nur ein leichtes Raunen zu vernehmen, ein Geräusch, wie im Windhauch aneinanderreibender Blätter. Je mehr sich der Regen näherte, desto mehr steigerte sich dieses Geräusch, immer unüberhörbarer werdend, bis es wie ein Wasserfall klang. Als der Regen das Haus erreicht hatte, trommelte er gleichförmig, laut und eintönig auf das Wellblechdach ein. Im Bett wirkte dieses gleichmäßige Prasseln irgendwann einschläfernd.
Ich erwachte, wie eigentlich immer, vom Geschrei der Vögel. Die Einheimischen nannten sie garamut bilong tudak, Baumtrommeln der Dämmerung. Egal, ob Trockenzeit oder Regenzeit: kurz vor oder nach sechs Uhr ließen diese Vögel keinen Zweifel daran, dass die Nacht vorüber war.
Jetzt ist sie da, die Regenzeit, dachte ich frohlockend beim Aufstehen. Sicher hatte schon diese eine Nacht genügt, die klaffenden Risse im Rasen um das Haus ein wenig zu schließen. Nur wenige Tage würden genügen, alles, was ringsum braun und verdorrt war, wieder ergrünen zu lassen.
Ich ging in die Küche, um die Spritzen zum Auskochen aufzustellen. Vom Gang aus hörte ich meinen Sohn Amos in seinem Zimmer vor sich hinbrabbeln und singen. Stolz stellte ich den Topf mit den Spritzen auf meine neueste Errungenschaft: einen Gaskocher mit zwei Feuerstellen. Vorbei die Plackerei, als ich noch umständlich ein Feuer im Herd anzünden musste, um langsam das Wasser zu erhitzen. Welch eine Erleichterung gegenüber vorher!
Während die Spritzen vor sich hinköchelten, holte ich mir aus dem Kerosin betriebenen Kühlschrank und dem Fliegengitter-Vorratsschrank mein Frühstück. Hätte es diesen Schrank nicht gegeben, so hätte man ihn erfinden müssen. Das Fliegengitter schützte die Lebensmittel vor Kakerlaken. Die Füße des Schranks ruhten zusätzlich in kerosingefüllten Dosen, so dass die Vorräte vor den allgegenwärtigen Ameisen sicher waren. Diese kamen in jeder Gestalt vor: im Haus waren es die ganz kleinen feinen sie waren praktisch überall, so dass sogar im Wohnzimmer die Getränke jeweils in eine wassergefüllte Untertasse gestellt werden mussten. Draußen gab es eine weitere Vielfalt dieser lästigen Spezies. Da waren die mittelgroßen schwarzen Ameisen sowie die größeren schwarzen begierig auf alles Vertilgbare. Am schlimmsten waren die kurakum, große rote, die sich vor allem an den Obstbäumen breitmachten und so richtig gemein und schmerzhaft zubeißen konnten.
Am Vortag, dem letzen in der Trockenzeit, wie ich nun wusste, hatte ich Roggenbrot gebacken. Gut war es geworden, nach dem Rezept einer Freundin in meinem handgeschriebenen Kochbuch, feuchtes Roggenbrot à la Anita . Wir deutschen Frauen in Papua Neuguinea (P.N.G.) waren ständig dabei, Brotrezepte auszutauschen. Zum Roggenbrot gab es gesalzene Butter und Guavenmarmelade vom Baum vor dem Küchenfenster.
Nachdem die Spritzen zwanzig Minuten gekocht hatten, ging ich ins Badezimmer. Amos war noch bei seinem Morgenritual, einem Vorsichhinträllern im Bett. Irgendwann würde er kommen, um kaikai, Essen zu verlangen. Dann würde er sich auf den Weg machen und die Veränderungen der Welt da draußen erkunden. Erst würde er ins Waschhaus gehen zu den Hausmädchen Yagamar und Sisies, die bereits geschäftig den Kerosinwasserkessel für die Wäsche anheizten. Wasser, wir hatten wieder kostbares Wasser! Und das mit Sicherheit noch für einige Monate.
Hausmädchen und Außenarbeiter waren üblich auf einer Missionsstation wie Begesin. Für das Hausmädchen bedeutete das Angelerntsein in einem Missionshaushalt eine deutliche Steigerung des Brautpreises, der hauptsächlich in Schweinen entrichtet wurde. Für den wokboi, den Außenarbeiter, war draußen im Busch die Anstellung eine gute Möglichkeit, sich eben diesen Brautpreis zu verdie
| Reihe/Serie | Reisetops ; 1 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 145 x 210 mm |
| Gewicht | 283 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Reisen ► Reiseberichte ► Australien / Neuseeland / Ozeanien |
| Schlagworte | Anthropologie • Asien • Deutsche Kolonien • Kannibalen • Kannibalismus • Kopfjäger • Kulturzerstörung • Menschenfresser • Missionierung • Naturvölker • Papua NeuGuinea • Papua-Neuguinea; Reise-/Erlebnisber. • Sozialer Umbruch • Völkerkunde |
| ISBN-10 | 3-86040-138-6 / 3860401386 |
| ISBN-13 | 978-3-86040-138-5 / 9783860401385 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich