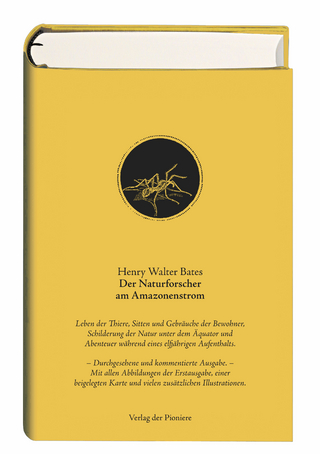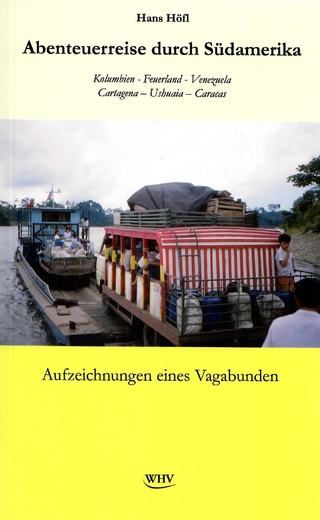Drogenkorridor Mexiko
Transit (Verlag)
978-3-88747-259-7 (ISBN)
Eine Begegnung mit einem Land, das drauf und dran ist, im Mord und Terror der verschiedenen Drogenbarone und -kartelle zu versinken und sich moralisch aufzugeben; ein Land, in dem viele die Wahrheit nicht mehr wahrnehmen wollen, weil die Wahrheit tödlich ist bzw. die Wahrheit von ihnen Widerstand abverlangen würde - Widerstand, zu dem sie nicht mehr fähig sind bzw. sie garantiert zu den nächsten Opfern machen würde. Das könnte tatsächlich ein Modell werden dafür, wie die Menschheit zugrunde gehen kann.Jeanette Erazo Heufelder, aus Südamerika stammend, hat sich mit viel Mut und viel Kenntnis auf eine Route begeben, in der sich ein Inferno auftut - und hat dabei ihre Augen offen behalten: für falsche Erklärungen und Vertuschungen, für historische - Opium und Morphium im Ersten und Zweiten Weltkrieg - und aktuelle Hintergründe - rasant wachsender Kokainkonsum in den 'besseren' nordamerikanischen und europäischen, also auch unseren Gesellschaften, ohne den die Macht und der Reichtum der mexikanischen Drogenbarone gar nicht denkbar wäre. Insofern hat sie ein Buch geschrieben nicht nur über das grausame, aber ferne Mexiko, sondern auch exemplarisch darüber, welche Verantwortung wir tragen für die dramatische Brutalisierung dieser Welt.
Jeanette Erazo Heufelder, 1964 geboren, ist Ethnologin und Autorin mit dem Themenschwerpunkt Lateinamerika. Sie war jahrelang als Autorin von Dokumentarfilmen tätig und hat als Kulturbeauftragte für die ecuadorianische Botschaft gearbeitet. Zuletzt erschienen 'Havanna Feelings – Die Magie des alten Kuba' und 'Der Smaragdkönig. Victor Carranza und das grüne Gold der Anden' (Malik Verlag). Das Buch war für den Lettre-Ulysses-Award nominiert. Jeanette Erazo Heufelder lebt mit ihrem Mann in Potsdam.
NarcolandiaHinter Santa Ana wird die junge Frau gesprächiger, die seit Ciudad Juarez im Bus neben mir sitzt und in den zurückliegenden Stunden hauptsächlich mit ihrem Smartphone beschäftigt war. In Santa Ana sind wir beide umgestiegen. Als sie am Ticketschalter hörte, dass auch ich bis nach Culiacan fahren wollte, hat sie sich im Bus wieder neben mich gesetzt und hantiert seitdem weiter an ihrem Handy herum. Es hätte keinen Empfang. Seit Stunden nicht. Sie müsste dringend ein paar Telefonate führen. Ihre Kinder würden sie wahrscheinlich schon seit Stunden zu erreichen versuchen. Ihrem jugendlichen Gesicht ist nicht unbedingt anzusehen, dass sie Mutter von mehreren Kindern ist. Sie streicht sich das schräge Pony aus der Stirn und lächelt stolz. Sie hätte vier Kinder. Zwei Jungen und zwei Mädchen. Ihr ältester sei 14, der jüngste 4. Ich frage, wo ihre Kinder jetzt sind. In Juarez? Um Himmels Willen, sagt sie erschrocken und bekreuzigt sich schnell. Dort sei es doch viel zu gefährlich. Nein, sie lebten alle in Culiacan. In Juarez hätte sie nur den Bus genommen. Sie käme gerade aus El Paso zurück. Vom Einkaufen. Sie hätte einen ganzen Stapel Jeans gekauft und Parfums und Turnschuhe. Die hier zum Beispiel. Sie hebt den rechten Fuß und zeigt mir ihre Nikes. Markenware. Aber wesentlich günstiger als in Culiacan. Deshalb würde sie die Sachen dort wieder verkaufen.Während sie redet, blickt sie zwischendurch immer wieder auf ihr Handy. Nichts zu machen. Mit einem Seufzer gibt sie auf. Es sei ohnehin zu spät, um noch irgendwo anzurufen. Sie gähnt. Der Busfahrer hat die Musik leise gedreht. Die meisten Fahrgäste dösen. Der Bus gleitet weiter schnurgerade durch die sternenübersäte Nacht. Vor der dunklen Silhouette der westlichen Sierra Madre zeichnen sich mannshohe Kakteen ab. Ansonsten säumt stundenlang nur steinige Wüste die Panamericana. Im Laufe der Nacht passieren wir vier militärische Kontrollposten. Jedes Mal müssen wir aussteigen. Jedes Mal wird unser gesamtes Gepäck durchsucht. Als es hell wird, mischt sich Farbe in die Landschaft. Sie wird grüner. Zu den Kakteen und Baumwollfeldern gesellen sich Palmen und Sträucher. Die ersten Zuckerrohrfelder tauchen auf. Und dann weitet sich die Landschaft bis zum Horizont der Sierra Madre zu einem Teppich aus Chili-, Bohnen- und Kürbisfeldern aus, gelegentlich unterbrochen von einem Pferde- oder Rindergehege. Wir sind nach zwanzig Stunden Fahrt im Bundesstaat Sinaloa angekommen.Das Handy meiner Sitznachbarin hat endlich Empfang. Nachdem sie mit jedem ihrer Kinder gesprochen hat, beginnt sie, der Nachbarschaft aus ihrem Viertel Bescheid zu sagen, dass sie in zwei Stunden mit einer Ladung Jeans, Turnschuhen und Armani-Parfums aus El Paso eintreffen würde. Sie vergisst nie, den Markennamen des Dufts zu erwähnen. Armani sei bei ihnen im Viertel momentan der absolute Renner, erklärt sie mir zwischen zwei Telefonaten. Ich frage sie, ob sie regelmäßig nach El Paso fährt. Alle zwei bis drei Monate, sagt sie. Dann lohnt es sich also? Sie schüttelt den Kopf. Das sei nicht der Grund. Auf die Idee mit den Einkäufen sei sie nur gekommen, um sich die Fahrten überhaupt leisten zu können. Sie müsse in El Paso ihren Mann besuchen. Ihre Stimme wird leiser. Ihr Mann sei im Gefängnis. Sie formt mit den Lippen lautlos ‚Drogen.’ Man hätte ihn erwischt, als er mehrere Kilo Cristal – eine synthetische Droge - von Phönix nach Washington schmuggelte. Eigentlich sei er von Beruf Zimmermann. Er hat auf dem Bau gearbeitet. Von seinem illegalen Nebenjob hätte sie nichts gewusst. Sie lebten in Washington, als die Sache aufflog. Sie selbst hatte Arbeit in einem Restaurant, als Tellerwäscherin, war aber zu der Zeit mit dem jüngsten Kind hochschwanger. Das Jugendamt wollte ihr die Kinder wegnehmen. Daraufhin hätte sie die Sachen gepackt und sei mit den Kindern nach Mexiko zurück. Jetzt lebten sie alle in Culiacan bei den Schwiegereltern. Aber wenigstens hätte sie im Gegensatz zu ihrem Mann nicht ihr Visum für die Vereinigten Staaten verloren. So könne sie hin und herpendeln. Auf ihrem Handy gehen nun laufend Nachrichten ein. Ob sie Nikes auch in Kindergrößen hätte, wird sie gefragt. Na ja, sagt sie, dann würde sie eben auch die Schuhe verkaufen, die sie ihren Kindern mitbringen wollte. Sie ist selbst ganz erstaunt über ihren Geschäftssinn und muss lachen, sichtlich erleichtert darüber, dass sie nicht auf den Sachen sitzen bleiben wird. Nachdem alle Anfragen beantwortet sind, beginnt sie Musik zu hören. Die Titel, die im Display des Smartphones erscheinen, verraten ihren Musikgeschmack: La Charla von Enigma Norteño, El Torturado von El RM, El Mayo y el Chapo, 500 balazos, alles Narcocorridos, Lieder aus der Welt der Drogenhändler, Lieder über ihre Geschäfte, Respektbekundungen über ihren angeblich intelligenten und daher gerechtfertigten Gebrauch von Gewalt. „Wie sollen wir die Sache erledigen,“ erkundigen sich in Empresa Inzunza ein paar Killer bei ihren Auftraggebern: „Möglichst schmerzhaft oder als Instant-Job? Mit Botschaft versehen oder spurlos beseitigen?“Meine Sitznachbarin hört gar nicht richtig hin, was da gesungen wird. Eine ganze Weile schaut sie nachdenklich aus dem Fenster, dann kommt sie noch einmal auf ihren Mann zu sprechen. Im ersten Jahr seiner Haft hätte sie ihn kein einziges Mal besucht. So wütend sei sie gewesen. Jetzt hätte er vier Jahre abgesessen. Zwei fehlten ihm noch. Dann sei sie 32. Sie wollten es noch einmal miteinander versuchen. Aber ohne Drogen. Wenn er wieder mit den Drogen anfinge, würde sie ihn verlassen. Mit den Kindern. Endgültig. Er wüsste das.Sie wählt aus der Songliste ein Liebeslied von Oscar Garcia aus, überlegt es sich dann aber anders und entscheidet sich für Colmillo Norteños Diablo de Culiacan, wieder ein Narcocorrido, dieses Mal einer, der davon erzählt, wie der Pakt zwischen dem Teufel und Culiacan zustande kam. Während aus dem Smartphone neben mir im fröhlichen Dreivierteltakt der Vertrag zwischen dem Teufel und einem Drogenhändler aus Culiacan geschlossen wird, dem Reichtum und ewiges Leben in Aussicht gestellt werden, breiten sich draußen auf den Feldern endlose Reihen Plastikplanenzelte aus, unter denen Sinaloas Tomaten zur Exportreife heranwachsen. Er sei nun ein reicher Mann, besingt der Sänger der Gruppe Colmillo Norteño gerade das Schicksal des Drogenhändlers aus Culiacan: Ein Mann der Mafia, der nun schon seit dreihundert Jahren den Stoff vertreibe, den sein Boss aus der Hölle bezöge. Und die Hölle sei Culiacan. Cuuhuuliacaahaan – schunkelt es aus dem Smartphone. Während mich der Narcocorrido bereits auf die Grundmelodie einschwört, die in Culiacan je nach Stadtviertel und Tageszeit zu einem dröhnenden Konzert anschwellen wird, liefern mir die Plastikplanenfelder vor dem Fenster, die unsere Fahrt seit geraumer Zeit begleiten, einen anderen Einblick in Sinaloas Geschichte. Denn noch vor der Droge war die Tomate da. Und schon vor der Tomate gab es den Zucker, mit dem die Erschließung Sinaloas als moderne Agrarexportregion begann. Schon immer lag Sinaloa nicht nur räumlich, sondern auch wirtschaftlich wesentlich näher an den USA als am mexikanischen Hauptstadtdistrikt. Es waren Investoren aus Kansas, die im 19. Jahrhundert den trockenen Küstenstreifen westlich der Sierra Madre in landwirtschaftlich nutzbares Land zu verwandeln begannen, indem sie das Wasser aus der Sierra Madre durch Bewässerungskanäle zu den Feldern leiteten und so aus einem abgeschiedenen, dünn besiedelten Bundesstaat das wichtigste agrarindustrielle Zentrum Mexikos machten. Mit dem Bau der Pazifik-Eisenbahn und der Hafenanlagen bei Los Mochis wird der Küstenstaat im frühen 20. Jahrhundert zur interkontinentalen Drehscheibe für Zucker, Tomaten und Opiumhandel.Hinter dem, was im Narcocorrido als dramatischer Schicksalspakt mit dem Teufel besungen wird, steckt das gleiche kaufmännisch kühle Denken, mit dem sich die Händler Anfang des 20. Jahrhunderts für den extensiven Anbau von Tomaten entschieden haben: Wenn sich eine gewinnbringende Gelegenheit bietet, wird sie ergriffen. Opium, vermutlich zu Zeiten des Eisenbahnbaus im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von chinesischen Arbeitsmigranten nach Mexiko eingeführt und zunächst nur für den lokalen Bedarf kultiviert, taucht bereits in den Zwanzigerjahren als festes Marktsegment im Exportsortiment der Händler auf.So wie die Gravitation die Bahn der Erde um die Sonne bestimmt, bewegt sich der Drogenhandel von Anfang an mit beinahe naturgegebener Gesetzmäßigkeit in Richtung Norden über die Grenze. Über die gleichen Handelskanäle, Organisationsstrukturen und Geschäftskontakte, über die auch die mexikanischen Exporttomaten den Markt in den Vereinigten Staaten erreichen. Die Musik neben mir hört plötzlich auf. Der Akku ist leer.Sie hätte sich das gut überlegt mit der zweiten Chance, sagt meine Sitznachbarin. Wäre ihr Mann faul, würde sie es nicht noch einmal mit ihm versuchen. Aber er hätte sich nie um Arbeit gedrückt. Das sei nicht das Problem. Die Gringos seien ganz scharf nach Drogen. Das sei das Problem. Es reichte, dass sie hörten, woher man kam, schon fragten sie, ob man ihnen nicht etwas besorgen könne. Sie wolle nicht jammern. Ihr Mann hätte gewusst, worauf er sich einließ, ihm hätte das schnelle Geld gefallen und nun badeten sie es gemeinsam aus. Allerdings wolle es ihr einfach nicht in den Kopf, warum sie daran schuld sein sollten, dass die Gringos ihr Problem mit den Drogen nicht in den Griff bekamen.Nach fast 24 Stunden Fahrt nähern wir uns Culiacan. Links und rechts der Landstraße stehen neue, teure Motelanlagen, die für Hunderte von Gästen gebaut worden sind, aber leer und steril aussehen. Sie heißen Paris, La Conquista, Mirage Royal und Paradiso und bemühen sich, ihren schillernden Namen durch luxuriöse Fassaden gerecht zu werden. Aber auf den Parkplätzen neben den Auffahrten herrscht gähnende Leere. Und so sind die fantasievollen Motels vor allem eines: die auffälligen Vorposten des Reichtums von Culiacan, der es sich leisten kann, potemkinsche Dörfer zu bauen. *Culiacan präsentiert sich bis heute als konservatives Agrar- und Geschäftszentrum. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Puente Negro, eine 1908 erbaute Eisenbahnbrücke, die zum Symbol des wirtschaftlichen Fortschritts und Wohlstands wurde. Das größte Ereignis im Jahr ist die Viehmesse. Für Unterhaltung sorgen zahlreiche Mariachi-Gruppen. Und als wichtigstes Exportprodukt gilt neben Fisch weiterhin die Tomate, gefolgt von Chili, Kichererbsen und Auberginen. Normalerweise müsste eine solche Stadt mit knapp achthunderttausend Einwohnern, die friedlich eingebettet zwischen Bergen und Meer liegt, in provinzieller Selbstzufriedenheit versinken. Culiacan scheint auf den ersten Blick dem diesem Bild zu entsprechen. Wer aus dem sauberen und modernen Busbahnhof ins Freie tritt, wird von einer Atmosphäre begrüßt, die keinerlei Überraschungen bereit zu halten scheint. Dieses Gefühl verstärkt sich, wenn man durch breite Straßen mit viel Grün in Richtung Innenstadt fährt, vorbei an Plätzen und Brunnen mit Palmen und Bougainvilles und an Autohäusern, deren neueste Modelle nicht nur in den Schaufenstern, sondern auch auf den Straßen zu sehen sind. Culiacan präsentiert sich als Handelstadt, die Wert auf Traditionen legt und sich Zeit zu wachsen ließ. Es gibt einen historischen Stadtkern mit Kathedrale und Arkadencafe und weiße Wohnviertel, die der Stadt eine Leichtigkeit geben, die an das rund 70 Kilometer westlich gelegene Meer erinnert. Culiacan zeigt seinen Wohlstand mit dem Stolz eines Kaufmanns, der betont, dass er seinen ganzen Besitz einzig und allein seinem Fleiß verdankt. Unübersehbar prangt überall in der Stadt das Symbol für den Fortschritt und Wohlstand: die Tomate. Sogar auf den Autokennzeichen Sinaloas klebt sie. Das beruhigt jene sensiblen Gemüter, die mit den schönen Dingen des Lebens die Menschheit beglücken und in Culiacan besonders viele Abnehmer für ihre Luxusautos, Luxusmarken und ihre Luxus-Lifestyle-Produkte gefunden haben, aber es erklärt natürlich keineswegs, wer sich in Culiacan all die Mustangs, Hummer und Corvettes leisten kann, die auf den Straßen der Stadt unterwegs sind. Dabei würde es die Stadt wohl selbst gerne glauben, dass das viele Geld, das in ihren Läden täglich umgesetzt wird, die Frucht grundsolider, ehrlicher Arbeit ist. Hat sie doch ihren Ruf als Handelsmetropole im vergangenen Jahrhundert viel zu hart gegen eine unnachgiebige Konkurrenz verteidigen müssen, um ihn sich nun durch den Beigeschmack ‚Narco’ kaputt machen zu lassen – mit dem im Spanischen alles und jeder etikettiert wird, der direkt oder indirekt in den Drogensektor verwickelt ist.Aber die Hinweise sind viel zu offensichtlich. Wie mit einer Gießkanne verteilt, tauchen in jedem Stadtviertel Häuser auf, an deren Kuppeln, Minaretten, Bögen und schmiedeeisernen Gittern und Zäunen der Stil der Drogenmafia zu erkennen ist. Solange der mexikanische Drogenhandel an die einheimische Produktion von Opiaten und Marihuana gekoppelt war, blieb in Culiacan die Gegenwart der Drogenhändler auf bestimmte Stadtviertel beschränkt. Ein solches Viertel war Tierra Blanca in den Sechzigerjahren, als hier die Caros, Elenes’, Fonsecas und Quinteros lebten, Familien aus Badiraguato, einem nahe gelegenen Ort in den Bergen, aus dem das Marihuana und das Opium stammt, das sie von Tierra Blanca aus weiter vertrieben. Der ursprünglich ländliche Charakter des Viertels, das aus einer Hazienda im nordöstlichen Außenbezirk Culiacans hervorgegangen ist, ist heute noch an den Fassaden der Häuser zu erkennen, die sich die zu Wohlstand gekommenen Familien weiterhin im Haziendastil bauen ließen. Ausgesprochen dezent sind diese heimatliche Verbundenheit demonstrierenden Häuser verglichen zu der protzigen Mafia-Architektur der Gegenwart, die mit ihren Kuppeln und griechischen Säulen genau das Gegenteil will: nämlich um jeden Preis auffallen.Die wilden Zeiten Tierra Blancas, in denen es das Chicago der Gangster in Sandalen war - eine Anspielung auf die Drogenbauern, die das Geld, das sie für ihre Ernten bekamen, in die Bars und Kaschemmen trugen, wo sie sich, sobald genug Alkohol geflossen war, hitzköpfige Streitereien mit der Waffe lieferten - gingen 1975 mit der ‚Operation Condor’ ihrem Ende zu. ‚Operation Condor’ war der Codename eines Drogenvernichtungsprogramms der mexikanischen Regierung. Es trug den gleichen Namen wie die Geheimdienstoperation, die im gleichen Zeitraum von mehreren rechtsgerichteten Regimes lateinamerikanischer Staaten durchgeführt wurde. Während letztere die Verfolgung und Auslöschung der politischen Opposition in ihren Ländern zum Ziel hatte, richtete sich die mexikanische Operation gegen die kleinbäuerlichen Drogenproduzenten. Die Bauern wurden verhaftet oder getötet, ihre Marihuana- und Mohnfelder niedergebrannt und mit Pestiziden vergiftet. Einige Händler aus Culiacan wichen während der heißen Phase der Operation in benachbarte Bundesstaaten aus. Von dort aus registrierten sie aufmerksam, dass das Drogenvernichtungsprogramm der Regierung eine marktbereinigende Wirkung besaß. Denn die Nachfrage aus den USA blieb unverändert hoch. Und die Verknappung des Angebots erhöhte sogar die Preise. Im gleichen Zeitraum führte der US-amerikanische Anti-Drogen-Kampf zu einem Zusammenbruch der Drogentransportwege für kolumbianisches Kokain in der Karibik. Der Drogenhändler Miguel Angel Felix Gallardo war der Erste, der auf diese parallelen Entwicklungen reagierte und seine Kontakte nach Kolumbien nutzte, um den unterbrochenen Kokaintransfer in die USA an die mexikanische Pazifikküste umzuleiten, wo er die Ware in Empfang nahm und sie gemeinsam mit einer Gruppe mit ihm verwandter oder befreundeter Händler auf erprobten Wegen durch Mexiko über die US-Grenze schmuggelte. Unter Gallardos Leitung wuchs die Gruppe zu einem Logistikunternehmen, das bald den gesamten mexikanischen Markt beherrschte. Aber da es in der Welt der Drogenkartelle nur Bündnispartner oder Feinde gibt, wobei sich verbündete Kartelle in der Regel nur die Feinde teilen, nicht aber die Schmuggelrouten, und so selbst aus Verbündeten jederzeit Feinde werden können, spaltet sich auch das von Gallardo geleitete Kartell der ersten Stunde nach dessen Festnahme 1989 in mehrere, nunmehr voneinander unabhängig arbeitende Gruppen auf, die Mexikos Marktplätze und Transportwege unter sich aufteilen. Die ursprüngliche Sinaloa-Connection mit den Schmuggelwegen durch das westliche Mexiko wird von Gallardos früherem Gehilfen Joaquin Guzman weitergeführt und im Laufe des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends zum führenden Drogenkartell Amerikas ausgebaut. Mit Culiacan als neu erstrahlendem Handelszentrum, in dem ein Stadtviertel wie Tierra Blanca inzwischen vom Ruhm seiner vergangenen Tage leben kann und wie die Puente Negro und die Tomate als Wahrzeichen einer Stadt gehandelt wird, die eigentlich nichts so sehr wie jede geschäftsschädigende Verbindung zum Drogensektor fürchtet. Nur wo sich diese nicht mehr verbergen lässt, tut sie so, als handle es sich dabei nur um die Indizien einer jahrzehntelang gewachsenen Drogenkultur, um harmlose folkloristische Attraktionen. Culiacan könnte mit Sehenswürdigkeiten im Narco-Stil mittlerweile einen Themenpark füllen: Mit dem Friedhof Die Gärten von Humaya, auf dem die oft fotografierten Mausoleen reicher Drogenhändler wie bunte Lolipops in den tiefblauen Himmel ragen. Mit der Kapelle des Jesus von Malverde, dem Schutzpatron der Drogenhändler, in der rund um die Uhr Musikkapellen spielen und Souvenirverkäufer Malverde-Devotionalien anbieten. Mit den sogenannten Dollareros auf der Avenida Juarez, vor deren ambulanten Dollar-Wechselständen die Autos der Kunden Schlange stehen, die bei ihnen ihre Devisen umwechseln wollen, die keine Bank mehr annimmt, seit zur Bekämpfung der Geldwäsche die Höhe der monatlich erlaubten Dollar-Überweisungen auf 4000 Dollar für Kontoinhaber beschränkt worden ist und für alle anderen bei 1500 Dollar liegt. Händler und Kunden geben unter den bunten Sonnenschirmen, die auf einer Länge von ein paar hundert Metern die öffentliche Straße blockieren, ein friedliches Bild ab. Vielleicht, weil die Polizei vor den Ständen ihre Runden dreht und darauf aufpasst, dass sie bei ihren Geschäften ungestört sind. Zu den neuen Attraktionen von Culiacan gehört auch eine Spritzfahrt nach Colinas de San Miguel, einem der elegantesten Viertel der Stadt, wo zwischen weißen Villen und Neubauten, die sich wie eine Perlenkette die grünen Hügel hoch reihen, vereinzelt Rohbauten ohne Türen und Fenster stehen, die noch vor der Fertigstellung von der Polizei konfisziert worden sind. Als Quote bezeichnen die Culichis, die Einwohner Culiacans, diese Trophäen polizeilicher Ermittlungsarbeit. Sie hätten pure Alibifunktion. Denn die öffentliche Sicherheit sei im Besitz der wahren Herren der Stadt, nicht ihrer Lakaien. Die Kontrolle über die städtischen Viertel und Straßen funktioniere nach einer dem Schachtelprinzip der russischen Matroschkas ähnlichen Hierarchie. Je größer die Puppe, desto mehr Viertel und Straßenzüge gehören ihr. Wenn es in dieser Verschachtelung irgendwo hakt, wird die betroffene Schachtel ersetzt. Die Quote sei die eleganteste Lösung. In ärmeren Vierteln betriebe man weniger Aufwand. Dort würden Probleme kostengünstiger erledigt. Deshalb die vielen Toten in Vierteln wie 6 de Enero, der Verlängerung von Tierra Blanca längs der Avenida Obregon, wo sich Bierausschank an Bierausschank reiht, und – stets im Dreierpack - Pizzabude an Fischstand und Hähnchenbraterei. Die verbotenen Lieder der Narcocorridos, die in keinem Radio gespielt werden dürfen, haben es dem Besitzer von 6 de Enero offensichtlich angetan, und deshalb ertönt jetzt aus den Lautsprechern einer Imbissbude Colmillo Norteños Ajustes Inzunza, eine Art Leitfaden für korrektes Auftreten als Auftragskiller, der sich direkt an die drei Jungs zu richten scheint, die vor der Imbissbude ihre Pizza verdrücken: Aufgepasst Jungs! Stets mit Bazookas und Granaten ausgestattet, in kugelsicherer Weste, hinter getönten Scheiben eines Wagens ohne Plakette. Und wo offene Rechnungen beglichen werden, selbstverständlich nur durch Auslöschung frei Haus! Und nicht vergessen! In kleinen Stücken von einer Brücke hängen lassen und eine Karte mit eurer Empfehlung nicht vergessen!Auf der Avenida Obregon staut sich der Verkehr. Ein Motorradfahrer schlängelt sich an den Autos vorbei. Auf dem Rücksitz hinter ihm zwei Kinder. Ein zehnjähriger Junge und ein etwa siebenjähriges Mädchen. Der Fahrer grüßt mit einer lässigen Handbewegung in Richtung Pizzabäcker. Der Junge dahinter imitiert ihn sofort. Der Pizzabäcker ruft etwas zurück, aber das geht im ohrenbetäubenden Lärm von Colmillo Norteños Erziehungsratschlägen unter, die in dieser Straße für jeden das richtige parat haben. Denn weiter heißt es im Text: Und vergesst nicht, Señores. Das Motto lautet: Kinder werden nie angerührt. Kinder sind prinzipiell unschuldig. Es ist eine Sache unter Erwachsenen. Hört ihr! Nur Große sind in sie verwickelt. Y que no se olvidenSeñores mi lemaLos niños no tienenLa culpa de nadaGrandes contra grandesEstán enredadosEs ist eine ganz normale Szene in einer Stadt, in der es niemandem mehr auffällt, wenn an einem Wochentag Kinder, statt in der Schule zu sitzen, auf dem Rücksitz einer Yamaha durch die Stadt rasen und ihnen ein Narcocorrido den Unterricht ersetzt. Weil die vermeintliche Drogenfolklore in Wirklichkeit die Fieberkurve der Stadt anzeigt, der die Orientierung abhanden gekommen ist, seit Joaquin Guzman in die Sphären eines Narco-Superstars aufgestiegen ist, wo er zusammen mit seinem Partner Ismael Zambada wie Ludwig, der Sonnenkönig, den Mittelpunkt seines eigenen Universums bildet. Und Culiacan der Sitz seines Hofstaats geworden ist, der wie der alte Adel den Zusatz Narco im Namen trägt. Ein Narco-Hofstaat mit einer Hofkultur, die ganz auf das ungekrönte Haupt des Kartells von Sinaloa zugeschnitten ist, das den Spitznamen El Chapo – Der Kurze - im Titel trägt und mit über zwei Jahrzehnten an der Spitze des Sinaloa-Kartells – trotz siebenjähriger Haftunterbrechung - der am längsten amtierende Drogenboss in Mexiko ist. Ein Zeitraum, der lang genug ist, um den Eindruck entstehen zu lassen, dass der Ausnahmezustand, in dem die Stadt seit der Übernahme durch seine Sicherheitschefs verharrt, die Normalität sei, in die man hineingeboren wird, darin sein Leben verbringt und stirbt.*Am Urgrund der Erinnerungen einer ganzen Generation hallen die Schüsse der AR-15 nach, die im Januar 1976 den Drogenboss Lamberto Quintero niederstreckten, ein Mord aus Rache, dem ein Blutbad folgte, bei dem das Viertel um das Santa-Monika-Krankenhaus, in dem der sterbende Lamberto Quintero lag, zum Schauplatz des Showdowns wurde. „Horch!“ sagt ein kleiner Junge, der in dem Augenblick, in dem eine Salve die Luft zerriss, ein paar Häuserblocks weiter in seinem Hochstuhl sitzt und von seiner Mutter gefüttert wird. „Horch!“ wiederholt er aufgeregt, als weitere Schüsse zu hören sind. Er streckt den Finger in die Luft, so wie es seine Mutter immer macht, wenn sie will, dass er gut zuhört. Die Mutter starrt ihren zehn Monate alten Jungen ungläubig an. Ihr Sohn hatte soeben die ersten Worte seines Lebens gesprochen. Er sagte nicht Mama oder Kran oder Auto. Er kommentierte eine echte Schießerei in seiner Stadt, die erste von vielen, die er in dieser Stadt noch zu hören bekommen würde. Schon ein paar Tage nach den Vorfällen wird der Corrido, der Lamberto Quinteros Leben und Sterben besingt - als erster Narcocorrido überhaupt – von Culiacans Radiostationen gespielt und wirkt an seiner Legendenbildung mit. ‚Ihr, die ihr ihn gesehen habt, wie er stets über die Brücke nach Tierra Blanca fuhr, erinnert alle daran, dass man Don Lamberto nie vergessen darf. Ich für meinen Teil kann versichern, dass er Culiacan immer fehlen wird.’ Drei Jahre später singt der Junge, der zu den Schüssen das Sprechen gelernt hat, das Lied voller Inbrunst seiner Schwester vor. Er hat es im Kindergarten aufgeschnappt.‚An einem 28. Januar, wie schmerzt mich dieses Datum, wurde Don Lamberto von einem Wagen verfolgt.’ Weiter kommt er nicht. Seine Mutter hält ihm den Mund zu und erklärt ihm streng, dass solche Lieder bei ihnen im Haus nicht gesungen würden.Die Familie ist damals nach der Schießerei aus der Innenstadt in das Wohnviertel Los Pinos gezogen, in dem junge Familien der Mittelschicht mit Kindern in kleinen Einfamilienbungalows und Reihenhäusern mit Vorgärten lebten.„In den Siebzigerjahren glaubte man noch, dass einen das richtige Stadtviertel vor schlechter Gesellschaft schützen könne. Aber jetzt ist es umgekehrt so, dass alle Viertel den Narco-Stil imitieren.“ Aus dem Jungen ist inzwischen selbst ein Familienvater geworden, der sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, wenn er mit seinem 12jährigen Sohn die Großeltern in Los Pinos besucht, wo sich die Nachbarschaft seit seinen eigenen Kindheitstagen gewaltig verändert hat. Nebenan wohnt jetzt ein Dealer, der seinen Wagen aus Sicherheitsgründen immer vor dem Haus seiner Eltern parkt, und Kunden, die das erste Mal zu ihm kommen, die Adresse seiner Nachbarn angibt. Um seine eigene Haut zu schützen, riskiert er das Leben seiner Nachbarn. Es käme vor, dass Kunden von ihm im Vorgarten seiner Eltern stünden, wenn sie die Haustür öffneten. Was, wenn sie mit ihm verwechselt und versehentlich erschossen würden? Leute wie er hätten aus Los Pinos ein gefährliches Pflaster gemacht. Aber bei wem sollten sich die Bürger beschweren, wenn bei ihnen im Viertel die Polizisten für dieselbe Person wie die Dealer arbeiteten: Für Gustavo Inzunza Inzunza, alias El Macho Prieto, dem Sicherheitschef von Ismael – alias El Mayo - Zambada, der wiederum der Partner von Joaquin - El Chapo - Guzman ist. Für jenen Inzunza also, dessen Geschäften eine Reihe brutaler Corridos gewidmet sind.Wer wie seine Eltern Distanz zu den Nachbarn halte, leiste da schon Widerstand. Denn normalerweise stünde die Loyalität dem Nachbarn gegenüber, mit dem man keine Schwierigkeiten haben will, über Recht und Gesetz. Selbst als Waffen- und Gelddepot ließen sich Nachbarn missbrauchen, auch solche, die persönlich gar nicht in den Drogensektor verwickelt seien. Allein die Nachbarschaft mache sie ungewollt zu Komplizen. Seit der ehemalige Gouverneur von Sinaloa während seiner Amtszeit einmal erklären musste, wie die Drogenmafia in direkter Nachbarschaft zu seiner Residenz eine versteckte Operationsbasis unterhalten konnte, die als Waffendepot und mindestens einem Dutzend Sicarios als Unterschlupf diente, ohne dass jemand auf die Aktivitäten in dem Haus aufmerksam geworden wäre, und er vor der Presse verkündete, dass es in einer Stadt wie Culiacan, in der das organisierte Verbrechen an jedem Punkt präsent sei, nun einmal nicht ausbliebe, dass man einen Killer zum Nachbarn hat, ohne etwas davon zu wissen, fügten sich alle dieser Maxime wie einem unausweichlichem Schicksal. Die Schießerei, die im Januar 1976 vor der Santa-Monika-Klinik stattfand, hätte sich ihnen noch ins kollektive Gedächtnis gegraben, weil sie einen Anfang markierte. Heute würde sein Sohn beinahe jede Nacht von Schüssen geweckt. Er sei schon zu einem regelrechten Schusswechsel-Experten geworden, der anhand der Schüsse sagen konnte, mit welcher Waffe sie aus welcher Entfernung abgegeben worden waren. Am Frühstückstisch hielten sie dann regelmäßig Lagebesprechungen ab:„Um wie viel Uhr hast du die Schüsse gehört?“ „Zwischen halb vier und vier.“ „Wie weit klangen sie entfernt? Von hier bis zum Oxxo-Supermarkt?“ „Nein, nicht ganz so weit. Eher von hier bis zur Apotheke.“Wie klangen die Schüsse? Dumpf? Hart. Wie eine Five Seven. Wie viele Schützen?Nur einer. Aber er hat ein ganzes Magazin leergeschossen. Zwanzig Schuss. Nach Gesprächen wie diesem würden seine Frau und er je nach Einschätzung der Gefahrenlage entscheiden, ob ihr Sohn alleine mit dem Bus in die Schule fahren könne oder ob es besser sei, ihn im Auto hinzubringen. Und ob man die übliche Strecke nehmen oder lieber einen Umweg wählen sollte. Ich frage den Vater, ob er denn nicht auch nachts von den Schüssen geweckt würde. Er muss lachen. Er hätte über dreißig Jahre lang Zeit gehabt, sich an sie zu gewöhnen. Dann wird er ernst. Er macht sich Sorgen über seinen Sohn. Dass er jede Nacht wach werde, zeige, wie angespannt und unruhig er ist.In seiner eigenen Kindheit sei die Gewalt zwar auch ab und zu in seine Lebenswelt geschwappt - er hörte Schüsse, er erlebte hautnah die Verhaftung eines Drogenbosses -, aber kein Bestandteil von ihr gewesen. Die Gewalt heute sei Bestandteil der Lebenswelt von Kindern. In der Schule prahlten Schulkameraden seines Sohnes damit, dass sie bei einer Hinrichtung dabei gewesen sind. Mögen solche Äußerungen auch übertrieben sein und die Bilder auf ihren Handys in Wirklichkeit aus dem Internet stammen. Es reiche aus, andere Kinder einzuschüchtern. Ich frage den Vater, ob ich mich mit seinem Sohn unterhalten könne. Er zögert mit der Antwort und möchte zunächst wissen, ob sein Sohn in dem Buch, das ich schreibe, zu erkennen sein würde. Ich versichere ihm, dass ich niemanden namentlich erwähne, der das nicht will. Er werde seinen Sohn fragen, sagt er. Auch die Schulpsychologin werde er fragen. Denn mit ihr müsse ich wirklich sprechen.Am gleichen Abend erhalte ich eine Mail. Sein Sohn überlegt es sich noch. Aber die Schulpsychologin will mich treffen. Ich verabrede mich mit ihr für den nächsten Tag im Hotel. Wir setzen uns in den Frühstücksraum, wo wir am späten Vormittag ungestört sind. Der Kellner kommt an unseren Tisch und bringt uns Kaffee. Sie wartet, bis er sich entfernt hat, bevor sie leise zu sprechen beginnt.Sie wird an vier Schulen eingesetzt und betreut im Moment dreißig Kinder im Alter zwischen sechs bis vierzehn Jahren. In den vierzehn Jahren, in denen sie im schulpsychologischen Dienst tätig ist, sind ihr einige Veränderungen aufgefallen. An den Kindern, aber auch an den Müttern der Kinder. Die Mütter haben Furcht vor der Erziehung. Als ob es sich bei Erziehung um etwas handele, worauf sie keinen Einfluss hätten. Was außerhalb ihrer Macht stünde. Wie ein Phänomen aus der Galaxis. Sie sehen, dass ihre Kinder Fehler machen, und sagen nichts. Bis sie schließlich Angst vor den eigenen Kindern haben. Der Kellner kommt wieder an unseren Tisch und fragt, ob wir noch Kaffee möchten. Sie wartet wieder, bis er weit genug weg ist. Dann kommt sie auf die Mutter eines Schülers zu sprechen, den sie bis vor kurzem betreut hat. Diese Mutter war erst 17, als der Sohn zur Welt kam. Sie und der Vater des Jungen hatten während der Schwangerschaft geheiratet. Nach der Geburt ist sie alleine in den Norden gegangen, um als Drogenkurierin zu arbeiten. Das Geld schickte sie ihrem Mann. Einige Zeit ging alles gut, dann wurde sie in den Vereinigten Staaten mit dem Stoff erwischt und kam ins Gefängnis. Sobald kein Geld mehr floss, lieferte der Vater das gemeinsame Kind bei einem Verwandten von ihr ab, und brach jeden Kontakt zu dem Jungen ab. Dem Verwandten, ein Onkel der Frau, bei dem der Junge nun lebte, war es egal, wo er sich aufhielt und was er machte. Als die Mutter aus dem Gefängnis entlassen wurde, war ihr Sohn acht Jahre alt. Er war ihr völlig fremd. Sie hatte Angst vor ihm. Je weniger sie ihn sah, desto wohler fühlte sie sich. Jetzt mit dreizehn ist der Junge endgültig verschwunden. Die Psychologin vermutet, dass er für einen der Besitzer des Viertels arbeitet. Es sei gar nicht selten, dass diese in die Rolle von Ersatzvätern schlüpfen und von den Jungs dafür angehimmelt werden, weil sie Sachen mit ihnen unternehmen, die ihre eigenen Väter nie gemacht haben. Nebenbei gewöhnen die Besitzer die Kinder an den Job. Sie nehmen sie mit zur Arbeit. Lassen sie zusehen, wie ein Mensch umgebracht wird. Drücken ihnen eine Pistole in die Hand. Lassen sie schießen. Auf Hunde. Auf Hühner. Auf den ersten Menschen. Und testen so, ob sie zu gebrauchen sind.Seit einem Jahr hätte sich der Junge mit seinem zweiten Nachnamen anreden lassen. Einem typischen Narco-Namen wie Felix, Gil oder Caro. Jungs wollen so heißen wie ihre Vorbilder. Wenn sie zufällig einen zweiten Familiennamen haben, der in der Narco-Szene zu finden ist, dann geben sie diesen als ersten Nachnamen an. Der Drogenhandel wird von einem wachsenden Teil der Jugend als realistische Lebensoption gesehen. Während vor dem Krieg von hundert Jugendlichen zehn in Drogengeschäfte verwickelt waren, soll es heute in Sinaloa knapp die Hälfte sein. Laut den Daten der Justizbehörde sind seit Mai 2008 bis Februar 2010 über 200 Kinder und Jugendliche dem organisierten Verbrechen zum Opfer gefallen.Ob es denn unter den Schülern, die sich solche Narco-Familiennamen zugelegt haben, auch welche gäbe, die sie irgendwann wieder abgelegt haben, möchte ich wissen. Sie zuckt bei der Frage leicht zusammen. „Einer,“ sagt sie und bringt die Zahl kaum über die Lippen, so leise wird ihre Stimme jetzt. „Für einen meiner Schüler haben die Narcos an Attraktivität eingebüßt. Er hat entdeckt, dass er eigene Interessen hat und will Design studieren. “ *„Der Narco ist überall. Egal, wohin du blickst. Er schläft mit dir im Bett. Er sitzt mit dir am Frühstückstisch. Du schlägst die Zeitung auf. Er ist da. Du sperrst dich in die teuersten Viertel von Culiacan ein. In Alamos oder Primavera. Der Narco ist schon da. Du kannst dich drehen und wenden wie du willst. Der Narco ist da.“ Javier Valdez sitzt mit seinem Laptop in der Cafeteria des Ramada in der Nähe der Kathedrale und arbeitet. Er ist Journalist bei Riodoce, einer wöchentlich erscheinenden Zeitung aus Culiacan, und der Autor von Miss Narco und Malayerba, Büchern, die aus seinen Kolumnen hervorgegangen sind und Chroniken des Drogenalltags liefern. Es geht ihm wie allen Künstlern und Schriftstellern Culiacans: Die Narco-Phänomenologie bestimmt ihr Thema. Bei der Installationskünstlerin Rosy Robles ist es die Gewalt. Bei der Künstlerin Teresa Margolles der Tod. Der Schriftsteller Elmer Mendoza beschreibt an Schauplätzen seiner Geburtstadt Culiacan das Krebsgeschwür, das die mexikanische Gesellschaft zerfrisst, und Javier Valdez erzählt Geschichten, in denen das Narco-Phänomen zu einer Lebensform geworden ist. „Wir atmen Narco-Luft. Sie verpestet den Alltag. Sie hat uns krank gemacht. Wir leiden an einer besonderen Form des Valemadrismo, an fehlendem Unrechtsbewusstsein und totaler Gleichgültigkeit und haben uns so sehr an unseren Zustand gewöhnt, dass wir ihn als völlig normal empfinden. Wir merken gar nicht mehr, wie schwerkrank wir in Wirklichkeit sind.“ Wer die Krankheit bekämpfen will, wird in Culiacan nicht Arzt, sondern Journalist. Es ist ein dünner Grat, auf dem sich die Journalisten bewegen. Über die Verwicklung von Politikern in Drogengeschäfte können sie schreiben. Konkrete Angaben zu Häusern, Grundstücken, Firmen, Geschäften und Vermögen der Mafiabosse sollten sie besser verschweigen. Denn wer offen über die Verursacher der Krankheit zu schreiben wagt, riskiert sein Leben. Auch aus anderer Richtung lauere Gefahr, sagt Javier Valdez. Wenn um 7 Uhr morgens die Zeitungsverkäufer in ihren Autos mit Lautsprechern durch die Wohnviertel fahren und marktschreierisch mit dem „Blutbad des Tages“ ihre Zeitungen anpreisen, liefere die Verfolgung des organisierten Verbrechens dem organisierten Verbrechen die Werbung frei Haus. Man müsse aufpassen, dabei nicht ungewollt zu Helfern zu werden.Javier Valdez hat sich darauf spezialisiert, die Nahtstellen aufzudecken, an denen sich die Narcokultur mit dem kulturellen Geschmack der gesellschaftlichen Mehrheit trifft. „Früher wäre auf der Hochzeitsfeier einer Familie aus der Oberschicht keine Musikkapelle engagiert worden, die Narcocorridos spielt. Es wurde im gesellschaftlichen Umgang eine klare Trennlinie zwischen legal und illegal erworbenem Reichtum gezogen. Heute mischen sich gesellschaftlich angesehene Namen mit illegal erworbenem Reichtum. Adel heiratet Geld und verschafft dem Geld einen guten Namen. Auch so funktioniert Geldwäsche. Als gesellschaftlicher Aufstieg. Auf diese Weise ist der Narco in Culiacan in der Gesellschaft angekommen und Narcocorridos gehören fast schon zum guten Ton, werden auf jeder Hochzeit gespielt.“Der Narcocorrido ist aus den Corridos hervorgegangen, populären Balladen, die seit den Tagen der mexikanischen Revolution politische Ereignisse, aufsehenerregende Vorfälle, Morde aus Eifersucht, skurrile Zwischenfälle und Skandale kommentieren, immer im fröhlichen Dreivierteltakt der Musica Norteña, begleitet von Akkordeon, Kontrabass und Bajo Sexto. Wenngleich solche traditionellen Corridos nach wie vor komponiert werden, sind in Culiacan ausschließlich Narcocorridos zu hören, die immer noch die neuesten Nachrichten in Liedform darbringen, oft schneller und mit mehr Insiderwissen als die Zeitungsberichte, allerdings meist nur in Form von Hofberichterstattung. So wird eine staunende Zuhörerschaft, wie früher die Untertanen über Ereignisse am Hof, über Zwischenfälle und Dramen im Kartell von Sinaloa unterrichtet. Über den Tod von Edgar Guzman, dem Sohn des obersten Bosses. Über die große Verantwortung, die El Mayo Zambada für seine große Familie trägt. Über dessen Sohn Vicente, der in den Vereinigten Staaten verhaftet worden ist. Über die gerechte Wut von Chapo Guzman, mit der er gegen Feinde und Verräter vorgeht. In La Charla, einer fiktiven Unterhaltung, beschweren sich El Mayo y el Chapo wie zwei Diven über die Übertreibungen und Lügen, die von den Journalisten über sie in die Welt gesetzt werden. ‚Compadre, was sagst du dazu, was die Zeitungen über mich behaupten. Ich soll angeblich Millionen besitzen und dann diese Hochzeiten, die sie mir andichten’ - ‚Gräm dich nicht, Compadre. Schließlich sind das alles nur Lügen. Über mich reden sie auch viel. Ich habe das alles in dem Interview richtig gestellt.’ Als Ismael El Mayo Zambada der Zeitschrift Proceso, einem politischen Wochenmagazin, das Interview gibt, auf das sich der Corrido bezieht, und in der gleichen Ausgabe eine aktuelles Bild von ihm auf dem Titel erscheint, vermuten die einen, dass auf dem Foto nur sein Doppelgänger abgebildet ist, während die anderen aus sicherer Quelle wissen wollen, dass El Mayo auf dem Foto das Polohemd seines Partners El Chapo trägt, und die Nummer 1 des Kartells von Sinaloa bei diesem Interview sogar persönlich anwesend war. Wie Seifenopern scheinen die über die Drogenbosse verbreiteten Mythen und Legenden mit der Sehnsucht der Leute zu korrespondieren, der Lethargie ihres eigenen Alltags zu entfliehen, ohne zu wissen, wohin. In den Narcocorridos sieht alles so aus wie in ihrer Welt, nur eben aus der Sicht der Männer, an deren Tropf diese Welt hängt.Narcocorridos als provokante Antwort auf eine korrupte Politik, wie sie zum Beispiel in dem Lied Pactos entre Grandes zu finden ist, in dem der Protagonist dem Präsidenten Felipe Calderon einen Deal vorschlägt, bei dem er sich gegen Geld das Monopol im Drogengeschäft erkauft, sind ebenso rar geworden wie Narcocorridos als selbstironische Parodien. Im Interview mit dem Chino Antrax - einem wirklich existierenden Mitglied des Kartells von Sinaloa und dort wie El Macho Prieto für militärische Operationen und Aufräumarbeiten zuständig – beantwortet dieser die fiktiven Fragen eines Journalisten nach seiner Arbeit mit Versatzstücken aus unterschiedlichen Narcocorridos. Die meisten Narcocorridos verklären jedoch mit pathetischem Ernst die Drogenbosse und Auftragskiller zu Männern der Ehre, die dazu verdammt sind, Aufgaben zu erledigen, die keiner außer ihnen erledigen kann. Wie in der echten Hofberichterstattung darf in den Corridos nur gesagt werden, was autorisiert worden ist. Hält sich die Band nicht daran, läuft sie Gefahr, selbst ins Fadenkreuz jener Protagonisten zu geraten, deren Blutbäder so lyrisch besungen werden. „Vor ein paar Tagen stand ich bei Soriana vor dem Weinregal, unschlüssig, welchen Wein ich nehmen sollte, und merkte plötzlich, dass im Hintergrund das typische Chumtata Chumtata eines Narcocorridos lief. Ich hörte genauer hin. Das war 500 Balazos! Ein Narcocorrido, der von einer wilden Schießerei in Obregon im Bundesstaat Sonora handelt.“ Anajilda Moncato lacht immer noch ungläubig: „Die Schießerei zwischen den Bundespolizisten und Macho Prietos Leuten hat es wirklich gegeben. Glaubt man dem Lied, dann machten die Bundespolizisten dabei keine so gute Figur. Der Sänger vermutet, weil sie zu schlecht bezahlt werden, um für einen Einsatz ihr Leben zu riskieren. Während das Sinaloa-Kartell seine Reihen mit ehemaligen Soldaten füllen kann, welche die Seiten wechseln, weil sie von der Mafia weit besser bezahlt werden. Wenn Lieder wie 500 Balazos bei uns schon in der Gourmetabteilung einer Supermarktkette laufen, während sie in den Radiostationen verboten sind, dann sind wir tatsächlich in der Narco-Normalität angekommen.“ Anajilda Mancota ist Sozialwissenschaftlerin und unterrichtet an der Universität von Sinaloa. Ihr Spezialgebiet ist die Narcokultur. Ihre Daten sammelt sie im Alltag. In den Geschäften, die sich auf die wandelnden Moden und besonderen Vorlieben ihrer Kundschaft eingestellt haben. In Spirituosenläden, die ihre Regale mit Buchanan’s gefüllt haben, dem Lieblingswhiskey der Neureichen. In Schuhläden, in denen besonders viel Straußenlederstiefel mit den passenden Gürteln im Versace-Stil geordert und Stiefel im Leguanlederlook aus den Regalen genommen werden. In den Boutiquen, in denen Ed Hardy gerade Versace ablöst. In den Frisörsalons, die von blonden Haarverlängerungen auf dunkelbraune, glatte Extensions umgestellt haben. In den zahllosen Nagelstudios, in denen die Motive und Farben der ellenlangen künstlichen Fingernägel fast täglich wechseln. Im Gebrauchtwagenmarkt, wo teure Automarken relativ günstig zu bekommen sind, weil die Besitzer die Wägen nicht einmal ein Jahr lang fahren, bevor sie zum nächsten, neueren und exklusiveren Modell wechseln. Im boomenden Markt der Schönheitschirurgie. Im Angebot der Klingeltöne. „Aus dem Repräsentanten einer Subkultur ist ein Stereotyp geworden,“ sagt Anajilda über den Narco. „Es gibt kein staatliches kulturelles Projekt. Diese Lücke füllt die Narcokultur. Aber mehr noch als ein Kulturprojekt ist die Narcokultur ein Konsumprodukt. Sie hat in ihrer Gesamtheit einen eigenständigen neuen Markt erschlossen. Und liefert spendable Konsumenten.“ In der Ladenzeile des Einkaufszentrums, in dem die Kunden der Weinabteilung mit 500 Balazos – 500 Schüssen - berieselt werden, gibt es ein Schreibwarengeschäft, in dem eine Verkäuferin von einer echten Kugel getötet wurde, die bei einer Schießerei aus fahrenden Autos heraus abgegeben wurde und die Angestellte mitten auf die Stirn traf. Der unbekannten Toten – einer von täglich durchschnittlich acht Gewaltopfern in Sinaloa – wurde kein Corrido gewidmet. Auch keines der Kreuze, wie sie üblicherweise überall dort stehen, wo es zu tödlichen Gewalteskalationen zwischen verfeindeten Gruppen gekommen ist. Die ersten Kreuze tauchten in Culiacan irgendwann nach der Flucht Chapo Guzmans aus dem Gefängnis 2001 auf, als er von Culiacan aus sein Kartell zur Nummer 1 in Mexiko auszubauen begann und sich offen mit dem Kartell von Juarez anlegte. In dieser Zeit fing man an, die Orte, an denen die Narcos aufgrund der sich anbahnenden Bandenkriege ein immer früherer Tod ereilte, mit einem Kreuz zu markieren. Anfangs waren es bescheidene Holzkreuze, die in Mauernischen und unter Bäumen aufgestellt und mit Kerzen und Blumen geschmückt wurden. Das Zeremoniell wurde häufig von einem Corrido begleitet, eine letzte Ballade auf den Verstorbenen. Die Komponisten konnte man in der Francisco-Madera-Straße anheuern, wo sich die Übungsräume der Mariachi-Gruppen befinden. Ab Mai 2008 breiteten sich die Kreuze plötzlich in epidemischer Häufigkeit fast über Nacht in der ganzen Stadt aus. Und mit der Menge nahm auch ihre Größe zu. An Straßenecken, auf den Mittelstreifen der großen Boulevards, längs der Gehwege, in Wohnvierteln, auf öffentlichen Plätzen, vor Tankstellen, Banken, Getränkeläden, längs der Ausfahrtsstraßen aus Culiacan. Überall standen plötzlich Kreuze aus Marmor und Granit, deren Masse jedem eindringlich zeigte, dass etwas Neues und Unheimliches in der Stadt grassierte und dabei war, aus ihr einen Friedhof zu machen. Was war passiert? „Am 30. April 2008 veranstalteten wir bei Riodoce aus Anlass des fünfjährigen Bestehens unserer Wochenzeitung ein internationales Forum zu dem Thema Legalisierung der Drogen und Plan Merida,“ erinnert sich Javier Valdez. „Und während drinnen im Forum die Intellektuellen des Landes noch über die unterschiedlichen Lösungsansätze im Drogenkonflikt debattierten, schufen draußen die Kugeln Fronten. Am 30. April 2008 zerbrach die große Familie, die bis dahin gemeinsam unter dem Dach des Kartells von Sinaloa den Markt geregelt hatte, und einen Tag später herrschte Krieg.“Am 30. April 2008 stürmte die Polizei ein Haus, das von Arturo Beltran Leyva für das Sinaloa-Kartell als versteckte Operationsbasis genutzt wurde. Es war jenes Haus, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Residenz jenes Gouverneurs befand, der diesen Skandal mit dem lapidaren Satz ‚Jeder hat einen Sicario zum Nachbarn’ kommentierte. Während Gouverneur Jesus Aguilar Padilla am nächsten Tag seine Verbeugung vor der Macht der Capos in die Aufnahmegeräte der Journalisten diktierte, erklärte Arturo Beltran Leyva seinem Partner Chapo Guzman den Krieg, da dieser der Bundespolizei den entscheidenden Tipp geliefert und für einen Deal mit der Regierung ihn, Beltran Leyva, seinen alten Partner, verraten hätte. Unter den Männern, die bei der Erstürmung des Hauses durch die Bundespolizei getötet wurden, schien sich auch Beltran Leyvas Sohn befunden zu sein. So zumindest erklärt sich der Furor, mit dem Arturo Beltran Leyva die Fehde eröffnet. Keiner wird verschont. Nicht die Polizei. Nicht sein ehemaliger Partner. Zunächst stirbt Edgar Millan Gomez, der regionale Chef der Bundespolizei. Dann der Sohn von Chapo Guzman. Mit dem Mord am Sohn des Paten wird eine Gewalteskalation in Gang gesetzt, die alle friedlichen Rückzugswege verschließt und erst mit dem Tod Beltran Leyvas abklingen wird. Er wird am 16. Dezember 2009 von Marinesoldaten erschossen. In den zwanzig Monaten davor kulminiert der Krieg. Beltran Leyva verbündet sich mit den Feinden seiner ehemaligen Partner vom Sinaloa-Kartell und verschafft dem Kartell von Juarez und den Zetas Einlass in deren Einflussgebiet. Die Regierung Calderon entsendet als Reaktion auf die Morde an Bundespolizisten Soldaten und noch mehr Bundespolizisten. Chapo Guzman reagiert mit Großoffensiven.Mitten im Krieg entwickelt sich ein neuer Musiktrend: Movimiento Alterado. Die klassischen Instrumente der Musica Norteña werden mit Tuba und Schlagzeug gemischt, Instrumenten der Banda-Musik. Die Lieder werden schneller. Die Texte härter. Das Ergebnis sind Narcocorridos, die in verstörendem Tempo, das eben bedeutet Movimiento Alterado, die Gewaltexzesse des Mafiakrieges musikalisch begleiten. Köpfe rollen, Granaten detonieren, Menschen werden hingerichtet. El Macho Prieto, El Chino Antrax, El M1 oder schlicht El JT sind die besungenen Helden. Keine Rebellen mit politischem und sozialem Bewusstsein, sondern Killermaschinen der Mafia. ‚Kranke Corridos’ bezeichnen die Sänger ihre verstörenden Lieder über das ewige Reigen des Mordens und Tötens, die für die Narco-Industrie das sind, was Top-Gun für die Navy war: ein Werbeträger, der dem Mafiakrieg den Glamour eines Actionspektakels verleiht. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca Mit der AK 47 und der Bazooka im NackenVolando cabezas a quien se atravieza fliegen Köpfe, wo sie uns in die Quere kommenSomos sanguinarios, locos, bien ondeados wir sind blutgierig, verrückt, ziemlich zugedröhntNos gusta matar Uns gefällt es zu tötenPa' dar levantones, somos los mejores Für Entführungen sind wir die bestenSiempre en caravana, toda mi plebada Immer in Kolonne unterwegs, die ganze CliqueBien empecherados, blindados y listos kugelsicher geschützt, gepanzert und einsatzbereitPara ejecutar für die nächste HinrichtungWenn Strophe für Strophe ein Porträt Culiacans entsteht, das den Kadavern von Gewaltopfern gleicht, deren Körper mit Markierungen übersät und mit chirurgischer Präzision verstümmelt worden sind, um Nachrichten zu übermitteln und Reviere zu markieren, ist das durchaus wörtlich zu nehmen. Anhand ihrer Kadaver könne man den Zustand einer Gesellschaft ablesen, sagt Teresa Margolles, die Künstlerin aus Culiacan, die in ihren Installationen die Verbindung zwischen Tod und Gewalt aufzeigt. In den bestialisch verstümmelten Leichen des Narco-Kriegs breche sich ein Hass Bahn, der über den Tod hinausgehe. Warum sonst müssten ganze Gewehrsalven auf Menschen abgegeben werden, die bereits von der ersten Kugel tödlich getroffen wurden? In den Zentren des Drogenkriegs hat jede Straße einen Besitzer. Wer Besitzer einer Straße ist, ist auch Herr über Leben und Tod in der Straße. Wer in der Straße lebt und ihm die Gefolgschaft verweigert, ist nicht zu gebrauchen und wird wie Abfall entsorgt. Kadaver sind damit öffentlich. Zeitungen zeigen zerstückelte Körper als Aufmacher auf der ersten Seite. An den Tatorten stehen Jugendliche um von Kugeln zersiebte, blutverschmierte Leichen herum, die nicht abgedeckt worden sind, und filmen sie mit der Handy-Kamera. Kinder zeigen die Aufnahmen von Folteropfern ihren Klassenkameraden in der Schule. In der Welt des Narco ist der öffentliche Raum nur ein vorübergehender Zustand, dessen Privatisierung bereits Vorschub geleistet wird. Durch Fotografierverbote, die für alles bindend sind, außer für tote Körper. Durch Markierungen. Im Bundesstaat Coahuila zeigen große Zs an den Berghängen das Herrschaftsgebiet der Zetas an. Wer ohne Vorsichtsmaßnahmen die Grenzen der markierten Gebiete überschreitet, setzt sich auch als Unbeteiligter größter Gefahr aus. So verschwinden in Coahuila in den Zeta-Regionen immer wieder Reisende aus Sinaloa, deren PKWs das Kennzeichen des Feindes tragen. Und durch Kreuze. Kreuze sind Markierungen, die eindringlicher als alles andere zeigen, dass die Unversehrtheit des menschlichen Körpers in der Narco-Welt nichts wert ist. Zwei Meter hoch ragt das Kreuz von Edgar Guzman, das an der Stelle auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum errichtet wurde, wo man ihn erschossen hat. Es ist das größte Kreuz in Culiacan, dem Sohn des Besitzers der Stadt würdig. Aus teuerstem Marmor. Ein Grab für alle Ewigkeit, errichtet auf einem öffentlichen Parkplatz mitten in der Stadt.Während die Narco-Mausoleen im Friedhof Jardines del Humaya als Kopien jener bunten Zuckerbäckerstil-Häuser gebaut werden, in denen die Verstorbenen vor ihrem Tod wohnten, mit den gleichen Kuppeln, Säulen und Minaretten, mit Ölporträts, schmiedeeisernen Treppenaufgängen, Balkonen, Klimaanlagen und kompletter Kameraüberwachung; während also der Friedhof von Culiacan eine Art gated community ist, in der sich die Mafiafamlien am 2. November in den Häusern ihrer Toten treffen, sind die Kreuze auf Culiacans Straßen und Plätzen so etwas wie ihre militärischen Gedenktafeln. Gefallen im Krieg.Man erzählt sich, dass die Stadtverwaltung die Narco-Kreuze entfernen lassen wollte. Um Auseinandersetzungen mit den betroffenen Familien aus dem Weg zu gehen, sollten Priester als Vermittler eingesetzt werden. Letztlich sei die Initiative jedoch daran gescheitert, dass man nicht wusste, wer das Kreuz von Chapo Guzmans Sohn entfernen würde?Also bleibt diese Narco-Attraktion der Stadt erhalten wie die Kapelle von Jesus Malverde, die 1980 beim Neubau des Regierungspalastes nebenan abgerissen werden sollte. Angeblich hätte der empörte Protest der Jünger des 1909 verstorbenen großzügigen Banditen die Stadt jedoch dazu gezwungen, die Pläne des Grundrisses des neuen Regierungspalastes zu ändern und so den Abriss zu verhindern.Die Kapelle von Jesus Malverde hat Kultstatus erreicht. Zum Patronatsfest, das jährlich an seinem Todestag, dem 3. Mai, stattfindet, pilgern Besucher aus aller Welt zu dem Gebäude, das mehr einer Markthalle als einem Heiligenschrein gleicht. An Souvenirständen werden Malverde-Ketten, Bilder, Bücher, Kerzen und Büsten verkauft. Der schmucke Heilige mit dem schwarzen dichten Haar und dem Oberlippenbart trägt die Züge von Pedro Infante und ein Hemd im Rodeostil. Der Altar in einem fensterlosen Innenraum der Halle ähnelt dem Schminktisch einer Künstlergarderobe. Hunderte von Fotos und Postkarten aus aller Welt kleben an der Wand und sogar an der Decke. Blumenbouquets stehen in Plastikeimern auf dem Boden. Handgeschriebene Dankschreiben und liebevoll gemalte Malverde-Porträts und Plakate hängen hinter Bilderrahmen. Und zwischen Blumensträußen und Kerzen steht auf den Tisch im Zentrum des Raumes die neueste Büste des Stars. In den Seitennischen stehen ihre Vorgängermodelle, auf denen Malverde mehr Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Jorge Negrete aufweist. Die Seitenwände des kleinen Schreins und seine Außenwände sind mit den Danktafeln von Personen und Familien tapeziert, die sich bei ihrem Heiligen für die Erfüllung ihrer Bitten bedanken. Eine Banda Norteña steht im Vorraum der Kapelle und spielt den Corrido von Jesus de Malverde. Auf einem Seitenbänkchen vor dem Altar sitzt ein junges Pärchen mit einem kleinen Kind. Der Mann hat den gleichen Oberlippenbart wie sein Schutzpatron. Als das Lied zu Ende ist, bestellt er bei den Musikern einen weiteren Corrido. Dann setzt er sich wieder zu seiner Familie aufs Bänkchen und blickt weiter schweigend auf den Boden. Ein anderes Pärchen mit Kind betritt die kleine Kapelle. Die beiden Familien kennen sich. Die Männer deuten eine Umarmung an, die Frauen einen Wangenkuss. Dann stehen sie einige Minuten andächtig und schweigsam vor dem Altar. Bevor sie den Raum verlassen, zünden sie zwei Kerzen an und werfen einen Umschlag in eine der hohen Spendenboxen, die Malverdes Büste umrahmen. Im Vorraum unterhalten sie sich mit gedämpften Stimmen. Die Männer blicken ernst, ihre Frauen tauschen sich - ganz erfahrene Mütter - über ihre Kinder aus. Beide Frauen sind gertenschlank, beide tragen hautenge Jeans, hohe Schuhe und die langen braunen Haare offen. Ihre Männer ähneln sich ebenfalls mit ihren Cowboyhüten, weißen Hemden und den auf Hochglanz polierten Straußenlederstiefeln. Ihrer Kleidung nach gab es einen besonderen Grund, den heiligen Malverde in seiner Kapelle aufzusuchen. In der Nische des Altars liegt ein Berg Kieselsteine hinter einem mit Wasser gefüllten Behälter. Wer Malverde um einen Gefallen bittet, sucht sich angeblich einen der Steine aus, benässt ihn und nimmt ihn mit nach Hause. Wurde seine Bitte erfüllt, bringt er den Stein bei seinem nächsten Besuch wieder in die Kapelle zurück. Die beiden jungen Pärchen scheinen auf diesen Teil der Malverde-Folklore zu verzichten. Sie hören lieber noch eine ganze Weile den Musikern zu. Sie haben keine Eile und bestellen immer wieder neue Corridos, ausschließlich Lieder über Jesus de Malverde, von denen es Dutzende gibt. Als sie zahlen, ist den zufriedenen Gesichtern der Musiker anzumerken, dass das Trinkgeld ganz im Sinne des großzügigen Banditen gewesen sein muss –auf keinen Fall ein kleiner Kieselstein. *Anajilda Moncato will mir den neuen In-Treff Culiacans zeigen, die Musala-Insel auf dem Rio Tamazula, wo innerhalb kürzester Zeit ein nagelneues Stadtviertel mit Nachtklubs, Spielcasinos und überwachten Luxuswohnanlagen aus dem Boden gestampft worden ist. Wir haben uns in einem Cafe in Las Quintas verabredet, dem alten Vergnügungsviertel der Stadt. Auf dem Weg dorthin wird mein Taxi an einer Kreuzung von einem weißen Nissan Navarra geschnitten, dem im letzten Moment einfiel, dass er links abbiegen muss. Der Taxifahrer bremst ab und macht dem Wagen Platz. „Nicht, dass er noch auf die Idee kommt, mir das Ziegenhorn ins Gesicht zu halten.“ Er deutet mit einer Handbewegung, bei der er seine Finger schnappen lässt, an, was das Motiv für seine Höflichkeit ist: Angst.Die gleiche Handbewegung hatte eben der Vater des Jungen gemacht, als ich ihn fragte, wie es seinem Sohn ginge. Er hatte mir zuvor eine Mail geschickt. Sein Sohn war einverstanden, mit mir zu sprechen. Wir wollten uns in der Universität treffen, wo sein Vater Architektur unterrichtet und uns für das Gespräch sein Büro zu Verfügung stellt. Ich bin zu früh gekommen. Der Junge ist noch nicht da. Sein Vater erzählt mir, dass eine Freundin seines Sohnes vor ein paar Tagen fast an einem Kreislaufzusammenbruch gestorben sei, weil ihr von einer Klassenkameradin synthetische Drogen unter das Essen gemischt worden waren. Als der schulpsychologische Dienst die Mutter der Täterin darüber informierte, drohte die Frau damit, sich beim Gouverneur, der angeblich ein persönlicher Freund von ihr ist, über die Schule zu beschweren. Die Mutter lebt vor, wie man andere für die eigenen Bedürfnisse missbraucht. Nie würde sich dieses Mädchen für sein eigenes Verhalten verantworten müssen. Selbst dann nicht, wenn sie den Tod ihrer Klassenkameradin auf dem Gewissen gehabt hätte. Sollte sie in ein paar Jahren mit dem Auto einen Unfall bauen, bei dem ein Mensch ums Leben kommt, würde die Mutter dafür sorgen, dass sie am nächsten Tag ein neues Auto, aber ansonsten keine Probleme bekommt. Sollte sie mit den Kindern anderer Narco-Schwergewichte aneinander geraten, würde die Mutter dafür sorgen, dass ihr Kind einige Zeit die Stadt verlässt, solange, bis Gras über die Sache gewachsen war. Das sei Problemlösung á la Mafiaart. Später erzählt mir sein Sohn von den Prahlereien einer Gruppe Klassenkameraden mit ihren Vätern, die groß und stark und reich seien und mit ihnen auf Fotos posierten, auf denen beide, Vater und Sohn, ihre AKs 47, die berüchtigten Ziegenhörner, in die Kamera hielten. Er erzählt auch, dass er versucht, ihnen möglichst aus dem Weg zu gehen. Und dass seine Freunde die gleiche Angst vor den Söhnen der Narcos hätten wie er selbst. Von dem Vorfall, bei dem seine Freundin beinahe umgebracht worden wäre, spricht er nicht. Es ist zu frisch. Dafür redet er über Lehrer, denen die Angst vor ihren Schülern ins Gesicht geschrieben steht. Sie stellen Regeln auf und belohnen dann die, die sie brechen, mit guten Noten, weil die Kinder ihnen offen mit den Vätern drohen. Ob er lieber mit seinen Eltern aus Culiacan wegziehen würde? Ohne eine Sekunde zu zögern, schüttelt er den Kopf. „Später vielleicht,“ sagt er, „um zu studieren. Aber nicht, um davonzulaufen.“ Plötzlich kommt Leben in sein Gesicht. Es gäbe einen Lehrer, der sich nicht einschüchtern ließe. Sein Geschichtslehrer. Er hätte einem Jungen eine schlechte Note gegeben und als dieser wieder mit den üblichen Drohungen anfing, hätte er ihm kühl geantwortet, dass die Drohungen nichts an seiner Note ändern würden, da er keine Drohungen bewerte, sondern die Mitarbeit im Fach Geschichte, die in seinem Fall hundsmiserabel sei. „Der hat echt keine Angst,“ sagt der Junge bewundernd.„Die Angst ist meine Schutzheilige,“ sagt der Taxifahrer hingegen. Alle würden von Santa Muerte reden, dabei käme es auf Santo Miedo an. Denn die heilige Angst helfe, zu überleben. Ein Kollege von ihm hätte den Fehler gemacht, zu hupen, weil vor ihm an der Ampel ein Auto nicht losfuhr, obwohl die Ampel längst auf grün umgeschaltet hatte. Er hätte das lieber nicht machen sollen. Denn daraufhin sei der Fahrer des vorderen Wagens ausgestiegen und hätte ihm eine Kugel in den Kopf gejagt. Die Sicarios würden an den Ampeln Wetten abschließen, ob der Fahrer hinter ihnen zu hupen anfängt oder nicht. Hupt er, wird er umgebracht, hupt er nicht, lassen sie ihn leben. Er hätte sogar davon gehört, dass sie dann den Autofahrern ihren Wetteinsatz auszahlen würden. Ich verziehe ungläubig das Gesicht. Er fängt meinen skeptischen Blick im Rückspiegel auf und versichert, dass das einem Bekannten seines Bruders tatsächlich passiert sei. Geschichten vom Hörensagen. Gerüchte, in denen die Mafiabosse und ihre Schranzen zu Herren über Leben und Tod erhoben werden. Überall, wo Angst herrscht, entstehen solche Gerüchte. Das Gerücht eines Capos zum Beispiel, der sich Löwen als Haustiere hält und sie mit Menschenfleisch füttert. Das Gerücht von der Entführung der Tochter eines reichen Unternehmers, die auf einer Bundesstraße aus dem Auto des Vaters verschleppt wurde, weil sie dem Boss des Entführers gefiel. Plötzlich tauchen die gleichen Gerüchte in weit entfernten Gegenden wieder auf.Das Gerücht von einer Frisörin zum Beispiel, die in der Unterhaltung mit einer Kundin auf die Brutalität der Zetas - wahlweise Chapos oder La Linea – zu sprechen gekommen sein soll und dabei von einer anderen Kundin angebafft worden wäre, dass es in ihrem eigenen Interesse läge, ihr endlich die Haare zu schneiden, statt weiter schlecht über ihre Freunde zu sprechen, erzählt man sich in Sinaloa, Chihuahua und Coahuila.Der Taxifahrer besteht darauf, dass diese Geschichten stimmen. Er fragt mich, ob ich El Infierno gesehen hätte. Dann wüsste ich doch, dass diese Geschichten wirklich passieren. In Culiacan würden Autofahrer erschossen, nur, weil sie sich dagegen wehren, dass sie an einem Unfall schuld sein sollten. Kürzlich sei es wegen so einer Sache zu einem hitzigen Streit zwischen zwei Autofahrern gekommen. Der eine zog die Pistole und brachte den anderen um. Das klinge wie der Witz, in dem zwei Männer eine Bar betreten und der eine auf einen Typen vor dem Tresen zeigt und sagt: Der dort ist mein Feind. Und sein Begleiter fragt: Wer? Und der Typ zieht seine Pistole, schießt alle tot, bis auf einen, und sagt dann: Der, der noch lebt. Aber was man sich anderswo als Witz erzähle, sei leider die traurige Wirklichkeit in seiner Stadt. Von wegen Gerüchte! “Wenn ich in meinem Taxi von einem Verrückten niedergeknallt werde,“ sagt er erregt, „bekommt meine Frau keinen Peso von der Versicherung.“ Die Schäden, die diese wilden Schießereien auf offener Straße verursachen, beliefen sich mittlerweile auf astronomische Summen. Die Versicherungen zahlten nichts und die Witwen blieben auf einem Berg Schulden sitzen, empört er sich, als er mich vor dem Cafe in der Avenida Sinaloa absetzt. Tagsüber eine ruhige Straße unter schattigen Bäumen mit kleinen Cafes und Restaurants, verwandelt sich der mehrspurige Sinaloa-Boulevard nachts in Culiacans Schickeria-Meile, auf der die Angeberschlitten einer Jeunesse Doree stundenlang ihre Runden drehen. Das Motto lautet: sehen und gesehen werden. Wie die Porschefahrer auf der Münchner Leopoldstraße fahren auf der Avenida Sinaloa die Besitzer stundenlang mit ihren neuesten BMW Roadsters, Dodge Vipers, Ford Mustangs und Lamborghini Gallardo Spyders die Straße auf und ab. Ganze Horden junger Mädchen, die zu ihrem 15. Geburtstag, dem sogenannten Quinceañera, von den Eltern eine Fete auf dem Korso geschenkt bekommen haben, kurven kreischend in gemieteten Strechlimousinen und Oldtimerbusen, in denen ihre Cliquen feiern, auf der Straße herum. Reifen quietschen, Motoren röhren, Narcocorridos schunkeln. Zwei Mercedes SLs blockieren die Straße. Ihre Besitzer unterhalten sich seelenruhig. Die Wägen dahinter machen unterdessen Party. Auf der Gegenspur findet ein Wettrennen statt. An der Kreuzung Sinaloa, Ciudad Pueblo verkeilen sich geschätzte achtzig Autos und lösen sich wieder kunstvoll voneinander. Es wird gejohlt und gefeiert. Von der Veranda des Cafes aus haben wir freie Sicht auf das Spektakel.„Alles Söhnchen,“ sagt der Cafe-Besitzer. „Sie haben die Straße adoptiert.“ Er lacht und fügt hinzu. „Aber man beißt nicht die Hand, die einen füttert.“Von der Avenida Sinaloa verlagert sich der Korso zu vorgerückter Stunde auf die Isla Musala, der Insel, auf der vor 10 Jahren noch Kühe grasten. Heute ist sie der Hotspot der Stadt. Das Vergnügungsviertel der Jugend Culiacans, der Söhne und Töchter der Reichen und Neureichen, der Narcojuniors und Buchones, der undurchsichtigen und halbseidenen Welt des Narco-Geldes. Alles mischt sich hier. Nachtclubs, Restaurants, Einkaufszentren, Spielkasinos, Multiplexkinos, Banken und eine überwachte Wohnanlage. Für die einen ist der Vergnügungskomplex auf der Isla Musala der typische Fall von politischer Vetternwirtschaft und Geschäftemacherei. So hätte mit Antonio Sosa zum Beispiel ein Unternehmer den Zuschlag für den Bau des Megaprojekts erhalten, der ein enger Freund des damaligen Gouverneurs gewesen sei. Und die Spielbank auf der Insel gehöre mit Jorge Hank Rhon - dem ehemaligen Bürgermeister von Tijuna und Besitzer einer Sportwetten- und Casinokette – dem Angehörigen einer Familie, die bekannt für die Verquickung von Politik und privaten Interessen sei. Ihr Slogan laute: Ein armer Politiker ist ein armseliger Politiker. Andere gehen weiter. Für die ist die Isla Musala das Mekka des Narco-Liberalismus und der Geldwäsche im großen Stil.Ab 11 Uhr nachts geht hier nichts mehr. Die Blechkarawane rollt in Schrittgeschwindigkeit über die Insel. Vor den Clubs und Diskotheken parken die Autos in Dreierreihen. Auf der Beifahrerseite der Geländelimousinen steigen Mädchen in slipkurzen Miniröcken und Highheels aus, mit dem Blackburry in der Hand und dem Guccitäschen im Arm. Sie stöckeln in Gruppen voraus ins O Zafira, Kuwa und Bebedero D’Nadri, während ihre Freunde in Gruppen auf den Parkplätzen stehen bleiben, sich gegenseitig ihre Autos zeigen und technische Neuanschaffungen begutachten. „Wir sind Narco, aber reich,“ kommentiert einer von Anajildas Freunden die Situation. Er sieht meinen fragenden Blick und übersetzt: „Unser Geschmack ist grottenschlecht, aber wir können uns das leisten.“Wir stehen schon eine ganze Weile hinter einem roten Geländewagen und kommen nicht weiter. Aber das ist liegt nicht am Verkehr. Der Fahrer des Wagens vor uns ist gerade beim Pinkeln. Als er endlich fertig ist und weiterfährt, sagt Anajilda trocken „Nos tocó la ley de Herodes. Das ist das Gesetz von Herodes. Da müssen wir durch!“ eine Anspielung auf einen anderen Film von Luis Estrada, mit dem er den Mexikanern schon vor El Infierno ihre Lage in einem Land vor Augen geführt hat, in dem jahrzehntelange Korruption gesellschaftliche und individuelle Deformationen und Verhaltensweisen zu Tage gefördert hat, die von jedem als Demütigung empfunden werden. Ein Großkotz blockiert die Straße und kann damit rechnen, dass erwachsene, in Rhetorik geschulte und höflicher Umgangsformen mächtige Menschen seine Unerzogenheit still schlucken und brav und geduldig warten, bis er seine Blase entleert, das Schwätzchen mit einem Bekannten beendet und drei Frauen mit Barbie-Maßen ausgiebig hinterher gesehen hat. Die geballte Faust bleibt in der Tasche. Das Gesetz des Stärkeren regiert. Und damit die Angst. Angst vor denen, die eine öffentliche Straße als Privatgrundstück betrachten. Angst vor den Nachbarn, die Nächte hindurch auf der Straße bei voller Lautstärke feiern. Angst vor den lärmenden Gästen am Nebentisch, die sich im Restaurant benehmen, als wären sei alleine. Seit Erscheinen des Films ist ‚Herodes’ Gesetz’ in Mexiko zu einem geflügelten Wort für alles geworden, was man zu tun gezwungen wird, weil man keine Wahl hat, auch wenn es einem innerlich widerstrebt. La ley de Herodes - O te chingas o te jodes. Friss, Vogel, oder stirb! Ertrag es oder du wirst umgebracht.Mir fallen die Zeilen eines Corridos ein:La gente se asusta y nunca se pregunta Die Leute erschrecken sich und stellen keine FragenSi ven los comandos cuando van pasando Wenn sie die Kommandos vorbeifahren sehenTodos enfierrados bien encapuchados y alle bewaffnet, gut vermummt und Bien camuflash. getarntDie Angst, die den Alltag beherrscht, hat dem Nachtleben in Culiacan nichts anhaben können. Selbst 2008, in der heißen Phase des Krieges zwischen Beltran Leyva und Chapo Guzman, werden weiter Restaurants, Casinos, Bars und Diskotheken besucht. Nur einmal erstarrt die Stadt vor Schreck. In den Tagen nach Edgar Guzmans Erschießung. Als jeder ahnte, was nun kommen musste, aber keiner wusste, wie Chapo Guzman den Mord an seinen Sohn rächen würde. Da hat sich Culiacan auf das Schlimmste gefasst gemacht. Auf den Straßen war kein Auto unterwegs. In den Läden blieben die Kunden aus. Die Leute sperrten sich zu Hause ein. Die traditionellen Serenaden am Vorabend des Muttertags, bei denen Gruppen Jugendlicher von Haus zu Haus ziehen und ihre Mütter mit einem Ständchen überraschen, fielen ebenso aus wie die Familienessen am nächsten Tag in einem der Restaurants im Plaza Forum, einem beliebten Einkaufszentrum der Stadt. Am 10. Mai 2008 war das Forum so menschenleer wie nie zuvor oder jemals wieder danach. Die ganze Stadt hielt den Atem an und verhielt sich mucksmäuschenstill. Als sie allmählich wieder aus ihrer Schockstarre erwachte, war etwas da, was sie vorher nicht gekannt hatte. Die Angst als Dauerzustand. Die Bilanz des Krieges für Sinaloa lautet für die Jahre 2008 und 2009: knapp 2000 Morde. Davon hundertsechzig an Polizisten. Es gab fast nur Verlierer bei diesem Krieg. Aber unbestritten einen Gewinner. Chapo Guzman. Wurde seine Position innerhalb des Kartells von Sinaloa noch 2005 - vier Jahre nach seiner Flucht aus der Haftanstalt Puente Grande bei Guadalajara in Jalisco - von der mexikanischen Bundesstaatsanwaltschaft als relativ isoliert und kaum ins operative Geschäft involviert eingestuft, so ist er aus dem Krieg gegen Beltran Leyva als unangefochtene Nummer 1 herausgegangen.
NarcolandiaHinter Santa Ana wird die junge Frau gesprächiger, die seit Ciudad Juarez im Bus neben mir sitzt und in den zurückliegenden Stunden hauptsächlich mit ihrem Smartphone beschäftigt war. In Santa Ana sind wir beide umgestiegen. Als sie am Ticketschalter hörte, dass auch ich bis nach Culiacan fahren wollte, hat sie sich im Bus wieder neben mich gesetzt und hantiert seitdem weiter an ihrem Handy herum. Es hätte keinen Empfang. Seit Stunden nicht. Sie müsste dringend ein paar Telefonate führen. Ihre Kinder würden sie wahrscheinlich schon seit Stunden zu erreichen versuchen. Ihrem jugendlichen Gesicht ist nicht unbedingt anzusehen, dass sie Mutter von mehreren Kindern ist. Sie streicht sich das schräge Pony aus der Stirn und lächelt stolz. Sie hätte vier Kinder. Zwei Jungen und zwei Mädchen. Ihr ältester sei 14, der jüngste 4. Ich frage, wo ihre Kinder jetzt sind. In Juarez? Um Himmels Willen, sagt sie erschrocken und bekreuzigt sich schnell. Dort sei es doch viel zu gefährlich. Nein, sie lebten alle in Culiacan. In Juarez hätte sie nur den Bus genommen. Sie käme gerade aus El Paso zurück. Vom Einkaufen. Sie hätte einen ganzen Stapel Jeans gekauft und Parfums und Turnschuhe. Die hier zum Beispiel. Sie hebt den rechten Fuß und zeigt mir ihre Nikes. Markenware. Aber wesentlich günstiger als in Culiacan. Deshalb würde sie die Sachen dort wieder verkaufen.Während sie redet, blickt sie zwischendurch immer wieder auf ihr Handy. Nichts zu machen. Mit einem Seufzer gibt sie auf. Es sei ohnehin zu spät, um noch irgendwo anzurufen. Sie gähnt. Der Busfahrer hat die Musik leise gedreht. Die meisten Fahrgäste dösen. Der Bus gleitet weiter schnurgerade durch die sternenübersäte Nacht. Vor der dunklen Silhouette der westlichen Sierra Madre zeichnen sich mannshohe Kakteen ab. Ansonsten säumt stundenlang nur steinige Wüste die Panamericana. Im Laufe der Nacht passieren wir vier militärische Kontrollposten. Jedes Mal müssen wir aussteigen. Jedes Mal wird unser gesamtes Gepäck durchsucht. Als es hell wird, mischt sich Farbe in die Landschaft. Sie wird grüner. Zu den Kakteen und Baumwollfeldern gesellen sich Palmen und Sträucher. Die ersten Zuckerrohrfelder tauchen auf. Und dann weitet sich die Landschaft bis zum Horizont der Sierra Madre zu einem Teppich aus Chili-, Bohnen- und Kürbisfeldern aus, gelegentlich unterbrochen von einem Pferde- oder Rindergehege. Wir sind nach zwanzig Stunden Fahrt im Bundesstaat Sinaloa angekommen.Das Handy meiner Sitznachbarin hat endlich Empfang. Nachdem sie mit jedem ihrer Kinder gesprochen hat, beginnt sie, der Nachbarschaft aus ihrem Viertel Bescheid zu sagen, dass sie in zwei Stunden mit einer Ladung Jeans, Turnschuhen und Armani-Parfums aus El Paso eintreffen würde. Sie vergisst nie, den Markennamen des Dufts zu erwähnen. Armani sei bei ihnen im Viertel momentan der absolute Renner, erklärt sie mir zwischen zwei Telefonaten. Ich frage sie, ob sie regelmäßig nach El Paso fährt. Alle zwei bis drei Monate, sagt sie. Dann lohnt es sich also? Sie schüttelt den Kopf. Das sei nicht der Grund. Auf die Idee mit den Einkäufen sei sie nur gekommen, um sich die Fahrten überhaupt leisten zu können. Sie müsse in El Paso ihren Mann besuchen. Ihre Stimme wird leiser. Ihr Mann sei im Gefängnis. Sie formt mit den Lippen lautlos 'Drogen.' Man hätte ihn erwischt, als er mehrere Kilo Cristal - eine synthetische Droge - von Phönix nach Washington schmuggelte. Eigentlich sei er von Beruf Zimmermann. Er hat auf dem Bau gearbeitet. Von seinem illegalen Nebenjob hätte sie nichts gewusst. Sie lebten in Washington, als die Sache aufflog. Sie selbst hatte Arbeit in einem Restaurant, als Tellerwäscherin, war aber zu der Zeit mit dem jüngsten Kind hochschwanger. Das Jugendamt wollte ihr die Kinder wegnehmen. Daraufhin hätte sie die Sachen gepackt und sei mit den Kindern nach Mexiko zurück. Jetzt lebten sie alle in Culiacan bei den Schwiegereltern. Aber wenigstens hätte sie im Gegensatz zu ihrem Mann nicht ihr Visum für die Vereinigten
| Erscheint lt. Verlag | 20.10.2014 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 150 x 220 mm |
| Gewicht | 435 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Reisen ► Reiseberichte ► Südamerika |
| Schlagworte | Drogenhandel • Drogenkartelle • Drogenkrieg • Drogenkriminalität • Europa • Historische und aktuelle Hintergründe • Mexiko • Mexiko; Politik/Zeitgesch. • Mexiko; Reise-/Erlebnisber. • USA |
| ISBN-10 | 3-88747-259-4 / 3887472594 |
| ISBN-13 | 978-3-88747-259-7 / 9783887472597 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich