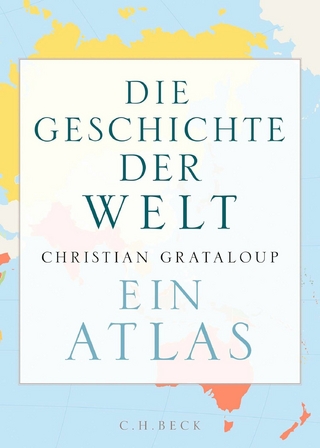Riskante Substanzen (eBook)
433 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-44349-2 (ISBN)
Timo Bonengel studierte Germanistik und Geschichtswissenschaft an der Universität Erfurt.
Timo Bonengel studierte Germanistik und Geschichtswissenschaft an der Universität Erfurt.
Inhalt
Einleitung 7
Die Entgrenzung von Abhängigkeit und »antisoziales« Verhalten: Therapie und Rehabilitation 41
1. »A serious national threat«: Heroinabhängigkeit und das Epidemie-Modell 42
2. »Addicts into citizens«: Die modernen Therapieprogramme 80
Kontrollierter Drogenkonsum: Differenzierung und Liberalisierung? 121
3. »Part of the mainstream of American life«: Marihuana und die Politik der Entkriminalisierung 123
4. »No adverse consequences«? Die (Un-)Beherrschbarkeit von Kokain 166
Drogen als Zerstörer von Potential: Prävention und Abschreckung 206
5. »A massive change in attitudes«: Drogenprävention und die Verantwortung des Individuums 208
6. »A kind of stalking horse«: Der medizinische Nutzen illegaler Drogen 257
Drogenkonsum und die Bedrohung von Reproduktion: Bestrafung um jeden Preis? 296
7. »The worst threat is mom herself«: Crack-Konsum und Mutterschaft 298
8. »The wrong message«: Spritzentausch als Mittel der AIDS-Prävention 333
Schluss: »A disease of free will«? 370
Dank 388
Abkürzungen 390
Quellen und Literatur 392
Quellen 392
Literatur 419
Einleitung »Any discussion of drug use inevitably [...] involves the consideration of individual and social risk. Drug use as a risk-taking and risk-producing behavior is the heart of the matter.« »What we think about addiction very much depends on who is addicted.« Was haben ein Rapper, ein Großunternehmer und eine Bürgerrechtsaktivistin gemeinsam? Was wie der Anfang eines weniger gelungenen Witzes klingt, hat in Wirklichkeit keine Pointe. Alle drei, der Rapper Jay-Z, der Unternehmer Sir Richard Branson und die Bürgerrechtsaktivistin Michelle Alexander, sind prominente Kritiker des »War on Drugs« - sowohl in seiner weltweiten als auch in seiner US-amerikanischen Gestalt. Branson, Philanthrop und Gründer der Virgin Group, erklärte 2016: »Der Krieg gegen die Drogen war immer auch ein Krieg gegen Menschen. Unverhältnismäßig zielte er vor allem auf Minderheiten, die Armen und Entrechteten.« Jay-Z schlug ebenfalls in diese Kerbe, als er im gleichen Jahr den rassistischen Charakter des »War on Drugs« in den USA kritisierte: »Die New Yorker Polizei durchsuchte in Brooklyn unsere Nachbarschaft, während in Manhattan Banker in der Öffentlichkeit Crack konsumierten und straffrei blieben.« Die Juristin Alexander hatte schon 2010 für Aufsehen gesorgt, als sie ihre Studie The New Jim Crow veröffentlichte. Darin belegt sie, welche drastischen Konsequenzen der »War on Drugs« für Hispanics und Afroamerikaner*innen mit sich bringt. Nicht nur wurden und werden sie in unverhältnismäßigen Zahlen wegen Drogendelikten festgenommen, sondern auch häufiger verurteilt und härter bestraft als Weiße. Durch massenhafte Verhaftungen und Verurteilungen auch wegen nicht-gewalttätiger Drogendelikte (»possession« beziehungsweise »simple possession«) wird, so Alexander, den derart Stigmatisierten systematisch die gesellschaftliche und ökonomische Teilhabe erschwert. Der moderne »War on Drugs« seit Mitte der 1980er Jahre, den Alexander zu Recht vor allem hinsichtlich des intensivierten Strafverfolgungsansatzes analysiert, stellt in ihren Augen eine Reaktion auf die Erfolge des Civil Rights Movement in den 1960er und 1970er Jahren dar. Die neuen Rechte und Freiheiten, die sich Afroamerikaner*innen erkämpft hatten, würden ihnen durch die Eskalation einer rassistischen Drogenpolitik wieder systematisch entzogen. Mit dieser schlüssigen Interpretation steht Alexander im wissenschaftlichen Feld nicht allein da. Rechts-, politik-, sozial- und geschichtswissenschaftliche Studien stützen ihre These. Die meisten dieser Arbeiten konzentrieren sich ebenfalls auf den Zeitraum vom Ende der 1980er Jahre bis in die Gegenwart, und das verständlicherweise: Denn auch wenn Richard Nixon bereits im Sommer 1971 eine »neue, uneingeschränkte Offensive« gegen Drogen ausrief, kam es erst ab dem Ende der 1980er Jahre zu einem drastischen Anstieg der Verhaftungen und Verurteilungen wegen Drogendelikten. Da diese Tendenz ein plastisches und unmittelbares Symptom von gesellschaftlichem und institutionalisiertem Rassismus darstellt, ist es nicht nur nachvollziehbar, sondern auch dringlich, diesen Aspekt zu beleuchten. Das hat allerdings zu einer doppelten Schieflage beziehungsweise Verzerrung geführt. Die moderne US-Drogenpolitik wurde und wird in den genannten Disziplinen meistens hinsichtlich des Strafverfolgungsansatzes analysiert und nicht als umfassendere Sozial- und Gesundheitspolitik. Das wiederum scheint zu einer Verzerrung in der öffentlichen Wahrnehmung beigetragen zu haben, und hier kommt wieder Richard Branson ins Spiel. Branson hat Recht, wenn er den diskriminierenden Charakter des »War on Drugs« kritisiert. Er liegt aber auch daneben. Ahnungsvoll deutete er beispielsweise an: »Als US-Präsident Richard Nixon 1971 illegale Drogen zum ?Staatsfeind Nummer eins? erklärte, hatten wenige eine Ahnung davon, was ihn wirklich dazu trieb, einen weiteren Krieg anzufangen.« Branson berief sich anschließend auf ein angebliches Zitat von Nixons innenpolitischem Berater John Ehrlichman. Dieser habe erklärt, die Nixon-Regierung habe absichtlich Hippies mit Marihuana und Afroamerikaner mit Heroin in Zusammenhang gebracht und dann beide Substanzen kriminalisiert, um diese Gruppen zu unterdrücken. Nun stecken in Bransons Andeutungen auch zutreffende Aspekte: Nixon weigerte sich tatsächlich, den Empfehlungen einer von ihm einberufenen Kommission zu folgen, und den Besitz geringer Mengen von Marihuana zu entkriminalisieren. Noch bevor die Kommission Ergebnisse veröffentlichte, hatte der Präsident öffentlich erklärt, er werde einer solchen Empfehlung nicht nachkommen. Marihuana war allerdings bereits seit 1937 auf Bundesebene kriminalisiert. Gesetzgeber*innen reduzierten unter der Nixon-Regierung die Strafen für den Besitz der »Hippie-Droge« sogar im Controlled Substances Act von 1970. Und nicht nur die Nixon-Regierung brachte Afroamerikaner mit Heroin in Verbindung, das taten auch Medien und Wissenschaftler*innen. Der private Besitz von Opiaten war zudem schon seit 1914 de facto illegal, seit 1956 war es Heroin in jeglichem Verwendungskontext. Außerdem setzte ausgerechnet der bei Linksliberalen wenig beliebte Nixon zu Beginn des »War on Dugs« liberale Psychiater als Regierungsexperten für Drogenpolitik ein und bedachte Forschung, Therapie und Rehabilitation mit massiven finanziellen Aufstockungen. The House I Live In zeigt, dass Bransons Ansicht, moderne Drogenpolitik sei in den USA lediglich ein Mittel zur bewussten Unterdrückung verarmter ethnischer Minderheiten, weit verbreitet ist. In der preisgekrönten Dokumentation des Regisseurs Eugene Jarecki von 2012 steht ebenfalls der strafende Ansatz des »War on Drugs« seit den späten 1980er Jahren im Mittelpunkt. Auch Michelle Alexander kommt darin zu Wort und auch Jareckis Film belegt eindrücklich und richtigerweise die rassistische Schlagseite des Strafverfolgungsansatzes. Auf dem Filmplakat heißt es jedoch: »The War on Drugs Has Never Been About Drugs«. Und so richtig das Argument der rassistischen Diskriminierung ist, so falsch ist eben die Behauptung, es sei im »War on Drugs« überhaupt nicht um Drogen gegangen und diese seien bloß ein Vorwand. Die Studienlage und eine verzerrte öffentliche Wahrnehmung erfordern es, den »War on Drugs« zu historisieren und nicht nur als bewusst rassistische Politik von Kriminalisierung und Bestrafung zu begreifen. Ich möchte damit nicht die Argumente von Alexander und anderen Rechts- und Sozialwissenschaftler*innen widerlegen, sondern vielmehr ihre Perspektive ergänzen: Sie haben Recht, dass der Strafverfolgungsansatz unverhältnismäßig Afroamerikaner*innen und Hispanics, und damit verbunden, in Armut lebende Menschen betrifft. Meine Perspektive stärkt dieses Argument eher, anstatt es zu verwässern. Wir werden sehen, dass der »War on Drugs« nicht auf eskalierende Verhaftungen und Haftstrafen begrenzt ist. Er ist nicht nur ein Vorwand, um ethnische Minderheiten ihrer Rechte und Freiheiten zu berauben. Es ging auch im »War on Drugs« um Gesundheit und Leistungsfähigkeit, um Produktivität, Potential und Reproduktion. Aber auch hier spielten gesellschaftliche Kategorien eine Rolle: Stereotypisierungen und diskriminierende Politiken beschränkten sich nicht auf den strafenden Ansatz. Stattdessen ist mein Argument, dass sich soziale Ordnungsvorstellungen und diskriminierende Praktiken viel subtiler auch über diese Diskurse um Gesundheit, Produktivität, Potential und Reproduktion entfalten, die neben Vorstellungen von Sicherheit und Kriminalität zentral für die moderne Drogenpolitik der USA sind. Deshalb genügt es nicht, den »War on Drugs« als reines Ensemble von strafenden Praktiken zur bewussten Unterdrückung von Minderheiten zu begreifen - es wird der viel durchdringenderen Wirkung sozialer Ordnungsvorstellungen nicht gerecht. Ein solcher Ansatz fehlt bisher auch in der geschichtswissenschaftlichen Debatte um die US-amerikanische Drogenpolitik, einem zwar nicht überbordenden, aber florierenden Feld. Grundlegend sind hier beispielsweise David Courtwrights Sozialgeschichte des Opiatkonsums vom 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts , seine Oral History mit Abhängigen aus den 1920er bis 1960er Jahren und die politikgeschichtlichen Studien von David Musto, die sich vom 19. Jahrhundert bis zum Anfang der 1980er Jahre erstrecken und primär insititutionen- und gesetzesorientiert funktionieren. Darüber hinaus existieren sozial-, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Untersuchungen einzelner Substanzen, von Alkohol über Marihuana, Kokain und Heroin bis zu verschiedenen Medikamenten. Neben eher narrativ angelegten Werken zur Geschichte verschiedener Abhängigkeitstherapien haben Historikerinnen Entstehung und Handlungslogiken der wissenschaftlichen Abhängigkeitsforschung vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 2000er Jahre analysiert. Ebenso existieren eine gesellschafts- und politikgeschichtliche Aufarbeitung der längeren Geschichte von Drogenkonsum und -politik samt eher konservativer Interpretation sowie eine Geschichte bundesstaatlicher Drogenpolitiken vom Zweiten Weltkrieg bis zum Anfang der 1970er Jahre. Auch vergleichende Studien der US-amerikanischen und der deutschen Drogenpolitik gehören inzwischen zum Kanon der geschichtswissenschaftlichen Literatur. In den meist rechts-, politik- und sozialwissenschaftlichen Studien zum »War on Drugs« dominiert eine Analyse des strafenden Ansatzes, von Gesetzen, Verhaftungs- und Verurteilungsraten. Eine systematische historische Analyse des modernen »War on Drugs« als Sozial- und Gesundheitspolitik fehlt bislang. Damit zusammenhängend haben noch keine Untersuchungen das Verhältnis der Wissenschaft(en) zum »War on Drugs« in den USA beleuchtet. Die populäre Ansicht lautet hier, es handle sich um einen »nicht wissenschaftsbasierten« Auswuchs einer moralischen und rassistischen Agenda, der durch mehr Einfluss der Wissenschaft korrigiert werden könne und müsse. Die Drug Policy Alliance, eine prominente Organisation in den USA, die sich für eine Liberalisierung der Drogenpolitik einsetzt, erklärt beispielsweise, die moderne Drogenpolitik widerspreche »vollkommen jeder wissenschaftlichen Vernunft«. Die Journalistin Kathrin Zinkant forderte 2014 auf Zeit Online angesichts aktueller Drogenpolitik ganz allgemein, diese gehöre »auf [ein] wissenschaftliches Fundament«. War und ist Drogenpolitik also »nicht wissenschaftsbasiert«? Diese Frage ist der Ausgangspunkt meiner Untersuchung, in der ich mich auf den Zeitraum von den frühen 1960er Jahren bis in die frühen 1990er Jahre konzentriere. Das umfasst den Beginn des »War on Drugs«, den Nixon im Sommer 1971 ausrief und deckt die Amtszeit von George H. W. Bush mit ab, unter dem die moderne Drogenpolitik der USA ihre stärker strafende Gestalt erhielt. Gleichzeitig eröffnet der Untersuchungszeitraum einen Blick, der sich von der Konzeption moderner Therapieprogramme seit den frühen 1960er Jahren bis über die politisch, wissenschaftlich und gesellschaftlich bedeutsamen Phänomene von Crack-Kokain und der HIV/AIDS-Krise erstreckt. Das erlaubt mir, die moderne US-amerikanische Drogenpolitik in ihren verschiedenen Facetten auszuleuchten sowie Entstehung und Entwicklung des modernen »War on Drugs« als Sozial- und Gesundheitspolitik nachzuzeichnen. Angesichts der wissenschaftlichen Forschungslücke und von verzerrten populären Deutungen ist es an der Zeit, den US-amerikanischen »War on Drugs«, im öffentlichen Diskurs häufig das Symbol für unvernünftige strafende Drogenpolitik schlechthin, dahingehend historisch zu untersuchen, inwieweit verschiedene Vorstellungen von Gesundheit und »deviantem« Verhalten von Bedeutung sind, wie diese mit der sozialen Ordnung zusammenhängen und welche Rolle wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Expert*innen spielen. Wie aber lassen sich diese Fragen genauer formulieren, theoretisch rahmen und sinnvoll beantworten? Eine Analyse sozialer Ordnungen als Analyse von Problematisierungen Das »Regieren« allgemein, und damit auch die US-amerikanische Drogenpolitik, lässt sich als ein Ensemble aus Problematisierungen und Lösungsstrategien beschreiben. Das ist, auf den Punkt gebracht, der Ansatz dieses Buchs. In einem umfassenderen Sinn schrieb der Philosoph Michel Foucault dazu: »Nun, wenn die Arbeit des Denkens einen Sinn hat - dann den, die Art und Weise, wie die Menschen ihr Verhalten [...] problematisieren, an ihrer Wurzel wieder aufzugreifen.« In Teilen der Geschichtswissenschaften ist es inzwischen beinahe selbstverständlich geworden, sich auf Foucault zu berufen. Trotzdem oder gerade deswegen bedarf das einer sinnvollen Begründung, zumal, wenn man sich mit einem Zitat schmückt, in dem es ganz grundsätzlich um den »Sinn« der »Arbeit des Denkens« geht. Moderne liberale Gesellschaften werden über Problematisierungen regiert, und eine Geschichte von Regierungsweisen und -strategien kann, in den Worten von Peter Miller und Nikolas Rose, als eine »Geschichte von Problematisierungen« geschrieben werden. Dabei geht es nicht nur um das »Regieren« in einem institutionellen Sinn, in dem eine Gesellschaft durch Exekutive, Legislative und Judikative regiert wird, durch das Verabschieden und Durchsetzen von Gesetzen. Dieser Aspekt spielt eine wichtige Rolle, doch allgemeiner sind gesellschaftliche Ordnungen untrennbar mit Aushandlungsprozessen in Bezug auf Problemdefinitionen und -lösungen verbunden: Wo kein Problem ausgemacht wird, finden keine Debatten, Positionierungen und Interventionen statt, kein handelndes Einwirken. Durch diese Praktiken, die Positionierungen verschiedener Akteur*innen im Diskurs, wird überhaupt erst eine Ordnung ins Soziale gebracht. Gesellschaften strukturieren sich nicht von selbst. Deshalb bedeutet »Regieren« in diesem Zusammenhang die Ordnung von Gesellschaften durch eine Vielzahl an Aushandlungs- und Differenzierungspraktiken hinsichtlich Problemdefinitionen und -lösungen. In Foucaults Werken waren Problematisierungen in Bezug auf »Wahnsinn« und Sexualität zentral, und zwar hinsichtlich ihres »produktiven« Potentials: Er analysierte, wie durch das Sprechen über und Handeln angesichts von Sexualität (oder eben »Wahnsinn«) der entsprechende Gegenstand durch Problematisieren maßgeblich abgesteckt wird und wie in diesen Diskursen Normen gesetzt werden, die dann zu Selbstverständlichkeiten werden. Der entscheidende Vorteil der historischen Analyse von Problematisierungen ist, dass mit diesem Konzept die Positionierung in einer erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung umgangen werden kann, die inzwischen seit mehreren Jahrzehnten geführt wird und immer noch aktuell ist. Denn indem man analysiert, wie zu einem gegebenen Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum etwas problematisiert wird und welche Lösungsstrategien in Anschlag gebracht werden, verschreibt man sich weder einem radikalen Sozialkonstruktivismus noch einer essentialistischen, positivistischen Sichtweise. Dazu schreibt Foucault: »Problematisierung bedeutet nicht die Darstellung eines zuvor existierenden Objekts, genauso wenig aber auch die Erschaffung eines nicht existierenden Objekts durch den Diskurs.« Mit anderen Worten: Problematisierungen zu analysieren verneint nicht, dass diese um einen tatsächlich existierenden Gegenstand beziehungsweise ein reales Phänomen kreisen. Andererseits verfällt eine Analyse von Problematisierungen nicht dem Irrglauben, man könne diesen existierenden Gegenstand objektiv eins zu eins abbilden, definieren, und es würde auf das gegebene Problem mit einer vordeterminierten Lösung reagiert. So beschreibt auch der Anthropologe Paul Rabinow Foucaults Konzept der Problematisierungsweise, das in dessen eigenen Werken skizzenhaft geblieben ist. Rabinow schreibt, dass sowohl die Art der Problemdefinition als auch die entsprechenden Lösungsstrategien Teil eines Aushandlungsprozesses sind, an dem unterschiedliche Akteur*innen teilhaben.
| Erscheint lt. Verlag | 11.3.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte |
| Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geografie / Kartografie | |
| Schlagworte | Drogen • Drogenpolitik • Sucht • USA • Vereinigte Staaten von Nordamerika • War on Drugs |
| ISBN-10 | 3-593-44349-X / 359344349X |
| ISBN-13 | 978-3-593-44349-2 / 9783593443492 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich