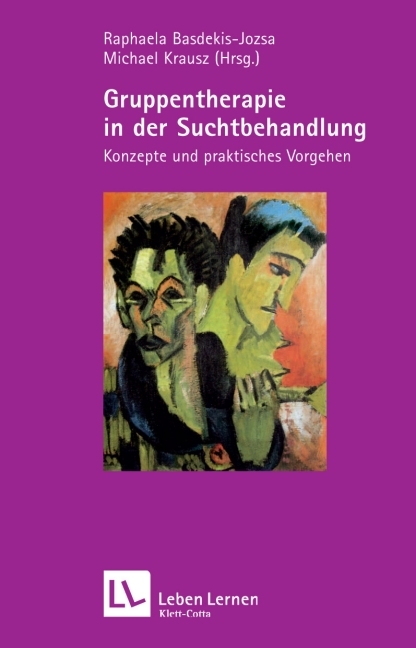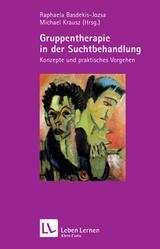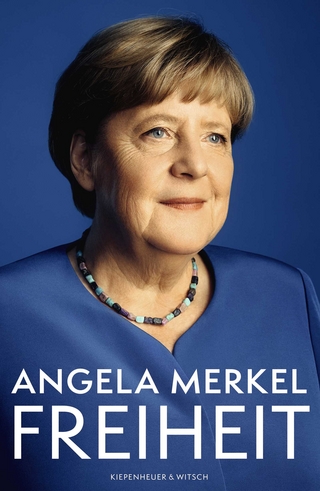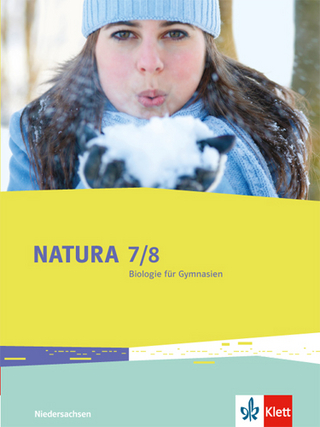Gruppentherapie in der Suchtbehandlung
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Die Arbeit in Gruppen und die Nutzung ihrer psychotherapeutischen Wirkmechanismen ist das »tägliche Brot« in den speziellen Einrichtungen für süchtige Patienten. Dennoch wurde bisher nicht klinikübergreifend darüber nachgedacht, mit welchen Methoden man diese große und schwierige Patientengruppe am besten erreichen kann.
Die Impulse für dieses Handbuch kommen aus der Praxis. Es will die Qualität der Gruppentherapie für Süchtige durch Erfahrungsaustausch verbessern. Vorgestellt werden verschiedene in den Kliniken erarbeitete Ansätze: vom verhaltenstherapeutischen Manual über systemisch-lösungsorientierte bis hin zu tiefenpsychologischen Konzepten. In einem zweiten Schwerpunkt schreiben die Autoren über ihre Erfahrungen mit speziellen Suchtgruppen, z. B. mit traumatisierten Süchtigen, mit Opiatabhängigen oder Medikamentensüchtigen. Damit Praktiker von Praktikern lernen können, enthält nahezu jeder Beitrag eine ausformulierte Therapiestunde.
Diese konkrete Anschaulichkeit sowie ein »Serviceteil« mit Kontaktadressen, Internetlinks und Literaturhinweisen machen den Band zum wichtigen Basisbuch für alle, die mit süchtigen Patienten arbeiten.
Raphaela Basdekis-Josza, Dr. med., war als Ärztin für Verhaltenstherapeutische Ambulanz in der Ambulanz für chronisch- mehrfach Abhängige in der Klinik für Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf tätig, z. Z. Ärztin in der Abteilung für Forensik und Sexualforschung.
Michael Krausz, Prof. Dr. med., Facharzt für Psychiatrie, ist Gründungsdirektor des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung an der Universität Hamburg und stellvertretender Leiter der Sektion "Sucht" bei der "World Psychiatric Association"; Mitherausgeber der Zeitschrift "Suchttherapie", Editor von "European Addiction Research".
Michael Krausz, Raphaela Basdekis-Jozsa
Vorbemerkung
A Einleitung in die Thematik
Raphaela Basdekis-Jozsa, Georg Farnbacher
Wirkmechanismen und Effektivität der Gruppentherapie in der Suchtbehandlung
B Spezifische Anwendungskonzepte
Michael Krausz
Spektrum der Gruppenarbeit in der Suchttherapie
Eva Brückner
Verhaltenstherapeutische Gruppenarbeit in der stationären Entwöhnungstherapie
B1 Gruppentherapie für Alkoholabhängige
Joachim Körkel
Das »Ambulante Gruppenprogramm zum kontrollierten Trinken« (AkT):
Grundlagen, Programmmerkmale und erste Befunde
Heinz Westermann
Die Entwicklung eines psychoedukativen Gruppenprogramms bei problematischem Alkoholkonsum (PEGPAK) im Kontext einer gemeindenahen psychiatrischen Versorgung
B2 Gruppentherapie für Opiatabhängige
Raphaela Basdekis-Jozsa
Psychoedukation in der Behandlung Heroinabhängiger
Petra Franke
Verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppen während des qualifizierten Entzugs opiatabhängiger Patienten
B3 Gruppentherapie für Medikamentenabhängige
Rüdiger Holzbach, Birgit Mekelburg
Gruppentherapie bei Medikamentenabhängigkeit
B4 Gruppentherapie für komorbide Patienten
Dürten Kudla, Evelyn Gottwalz
Gruppentherapeutische Interventionen für Menschen mit schizophrenen Störungen und einem gleichzeitig bestehenden Drogenmissbrauch/-abhängigkeit
Jens Reimer, Georg Farnbacher, Bernd Schulte, Raphaela Basdekis-Jozsa
Psychoedukation bei Hepatitis-C-infizierten opiatabhängigen Patienten
Ingo Schäfer
Gruppentherapeutische Behandlungsprogramme für traumatisierte Suchtpatienten
C Selbsthilfe
Gabriele Hentschke, Brigitte Gemeinhardt
Selbsthilfegruppen im Suchthilfesystem
D Systemische Ansätze in der Suchttherapie
Brigitte Gemeinhardt
Systemisch-lösungsfokussierte Gruppentherapie im Suchtbereich
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren
Vorbemerkung Das Interesse für ein bestimmtes Behandlungssetting oder ein theoretisch begründetes Interventionskonzept in der psychologischen oder psychiatrischen Therapie ist höchst schwankend, man könnte fast sagen konjunkturabhängig. Auch im Rückblick lässt sich oft nur schwer sagen, warum z. B. die Therapeutische Gemeinschaft (O?Brien and Perfas, 2005), Gestalttherapie nach Petzold (Petzold and Sieper, 1996) oder generell die Gruppentherapie (Uchtenhagen, Battegay et al., 1973) zu bestimmten Zeiten besondere oder sogar herausragende Aufmerksamkeit erfahren haben (Krausz, Uchtenhagen et al., 1999), um dann wieder eher in die zweite oder dritte Reihe der Bücherregale und der fachlichen Aufmerksamkeit geraten zu sein. Ausgehend von der alltäglichen Praxis der Arbeit mit Suchtkranken erscheint es geradezu erstaunlich, dass es bisher nur wenige Publikationen oder gar klinische Studien zur Effektivität und Ausgestaltung der Gruppenarbeit mit Süchtigen gibt, dass dem ganzen Themenkomplex kaum systematische Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Dies sagt sowohl etwas aus über die klinische Forschung wie über die praktizierte Weiterbildung und die theoretische Reflektion des therapeutischen Angebotes. Sie sind, gelinde gesagt, in diesem Segment unbefriedigend. Die lebendige Vielfalt, die sich in den verschiedenen Beiträgen der Autorinnen und Autoren dieses Buches widerspiegelt, bestätigt die Initiative, den Schatz praktischer Erfahrung sowie die Vielfalt gerade in den letzten Jahren entstandener, systematisierender, neuer Initiativen darzustellen. Die interessante und differenzierte Diskussion um eines der wenigen, methodisch strengen klinischen Forschungsprojekte im Suchtbereich, das Modellprojekt Heroingestützte Behandlung (Krausz, Uchtenhagen et al., 1999), war einer der interessanten und auch wissenschaftlich herausfordernden Ansatzpunkte, was u. a. in dem Kapitel zur Psychoedukation in der Behandlung Heroinabhängiger seinen Niederschlag findet. Was lässt sich bei der kritischen Betrachtung der Erfahrung im Versorgungssystem sowie des Forschungsstandes quasi als Ausgangspunkt festhalten? 1. Die Möglichkeiten und Indikationsgebiete der Gruppenarbeit mit Süchtigen sind viel größer, als es sich im Durchschnitt der klinischen Praxis widerspiegelt. Schon heute wäre die Qualität vieler Versorgungsangebote und deren Systematisierung, vielleicht sogar Standardisierung, viel weiter, wenn Weiterbildung, Tagungen und Therapieausbildung diese Entwicklungen mehr zur Kenntnis nehmen würden. Es gibt insgesamt einen bedauerlichen Mangel an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem großen Arbeitsfeld. 2. Damit eng verbunden ist die bedauerliche Tatsache, dass es in Deutschland so gut wie keine Therapieforschung im Suchtbereich gibt. Viele Fragen konzentrieren sich vielmehr auf wenig standardisierte und teilweise allgemeine Versorgungssettings. Auch die so genannten Forschungsverbünde im Suchtbereich haben dazu keine Beiträge geliefert. Eine systematische Evaluierung auch neuerer Interventionsstrategien und Anwendungsbereiche findet also nur in extrem wenigen Fällen statt. Systematische klinische Forschung, wie sie z. B. in den USA umfangreich gefördert wird, findet in Europa und insbesondere in Deutschland so gut wie nicht statt. Eine der wenigen Ausnahmen ist die schon erwähnte Pilotstudie zur heroingestützten Behandlung, in deren Rahmen auch ein Kontrollgruppenvergleich zwischen standardisierten psychotherapeutischen bzw. psychosozialen Interventionen stattgefunden hat. 3. Die Aufmerksamkeit der etablierten Psychotherapieschulen für die Arbeit mit Süchtigen ist traditionell eher begrenzt. Ihre Ansätze und Gruppenkonzepte sind zudem selten auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Klientengruppen abgestimmt, wie dies bei der Arbeit mit Süchtigen sicher sinnvoll ist. Diese der Not gehorchende Umgehensweise in der Praxis war folglich eher eine kritische Distanz gegenüber theoriegestützten Ansätzen oder gar Standardisierung und hat insbesondere dominierenden Eklektizismus zur Folge gehabt. Dies muss im Rahmen vieler Behandlungsangebote nicht negativ sein, beschränkt aber die Entwicklungsmöglichkeiten, die Vergleichbarkeit und die Möglichkeiten einer Qualitätssicherung enorm. Die Arbeit in Gruppen und die Nutzung der spezifischen psychologischen und psychotherapeutischen Wirkmechanismen in der Arbeit mit Gruppen ist das tägliche Brot sowohl der Suchttherapie wie der Selbsthilfe. Um so positiver und nicht zu unterschätzen ist der Trend in der Suchttherapie, in verschiedenen Formen diese Arbeit zu qualifizieren und unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Gruppen von Suchtkranken anzupassen. Die Vielfältigkeit der Beiträge hier spiegelt den insbesondere aus der Versorgung heraus geborenen Versuch wider, diese Arbeit zu qualifizieren und die besten Erfahrungen auch aus anderen Bereichen der Psychotherapie für die Suchtarbeit nutzbar zu machen. Viele Anregungen sind dabei aus dem Fundus der Suchtforschung in den USA zu übernehmen. Aber auch in Deutschland gibt es eine Reihe interessanter und der speziellen Bedürfnislage von Abhängigen in verschiedenen Situationen des Prozesses geschuldete Therapieangebote, vom Kurs für das kontrollierte Trinken bis zur Psychoedukation. Angesichts der Abwesenheit von klinischer Forschung und des gleichbleibenden Mangels an Fördermitteln gibt es auch gar keinen anderen Weg, zu einer Qualifizierung des Angebotes in diesem riesigen therapeutischen Bereich beizutragen. In diesen Kontext will sich auch dieses Buch einordnen. Es will die systematische Diskussion um Gruppenarbeit in der Suchttherapie durch systematischen Erfahrungsaustausch und die Aufbereitung vorhandenen Wissens unterstützen und letztendlich auch zu weiteren Anstrengungen in der Weiterbildung wie der klinischen Forschung anregen. Die Macher haben dabei selbst durch Recherche und Erfahrungsaustausch dazugelernt und sind der Überzeugung, dass es sich bei diesem speziellen Thema um ein für die Zukunft der Suchttherapie und deren Qualität enorm wichtiges handelt. Michael Krausz, Raphaela Basdekis-Jozsa Literatur Krausz, M., A. Uchtenhagen et al. (1999). Medizinisch indizierte Heroinverschreibung in der Behandlung Drogenabhängiger: Klinische Versuche und Stand der Forschung in Europa. Sucht 45 (3): 171-186 O?Brien, W. B. and F. B. Perfas (2005). The Therapeutic Community. Substance Abuse - A Comprehensive Textbook. J. J. Lowinson, P. Ruiz, R. B. Millman and J. B. Langrod. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Petzold, H. G. und J. Sieper (1996). Integration und Kreation. Paderborn: Junfermann Uchtenhagen, A., I. Battegay et al. (1973). Gruppentherapie und soziale Umwelt. Gruppentherapie und soziale Umwelt. Zürich: Huber
Vorbemerkung Das Interesse für ein bestimmtes Behandlungssetting oder ein theoretisch begründetes Interventionskonzept in der psychologischen oder psychiatrischen Therapie ist höchst schwankend, man könnte fast sagen konjunkturabhängig. Auch im Rückblick lässt sich oft nur schwer sagen, warum z. B. die Therapeutische Gemeinschaft (O?Brien and Perfas, 2005), Gestalttherapie nach Petzold (Petzold and Sieper, 1996) oder generell die Gruppentherapie (Uchtenhagen, Battegay et al., 1973) zu bestimmten Zeiten besondere oder sogar herausragende Aufmerksamkeit erfahren haben (Krausz, Uchtenhagen et al., 1999), um dann wieder eher in die zweite oder dritte Reihe der Bücherregale und der fachlichen Aufmerksamkeit geraten zu sein. Ausgehend von der alltäglichen Praxis der Arbeit mit Suchtkranken erscheint es geradezu erstaunlich, dass es bisher nur wenige Publikationen oder gar klinische Studien zur Effektivität und Ausgestaltung der Gruppenarbeit mit Süchtigen gibt, dass dem ganzen Themenkomplex kaum systematische Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Dies sagt sowohl etwas aus über die klinische Forschung wie über die praktizierte Weiterbildung und die theoretische Reflektion des therapeutischen Angebotes. Sie sind, gelinde gesagt, in diesem Segment unbefriedigend. Die lebendige Vielfalt, die sich in den verschiedenen Beiträgen der Autorinnen und Autoren dieses Buches widerspiegelt, bestätigt die Initiative, den Schatz praktischer Erfahrung sowie die Vielfalt gerade in den letzten Jahren entstandener, systematisierender, neuer Initiativen darzustellen. Die interessante und differenzierte Diskussion um eines der wenigen, methodisch strengen klinischen Forschungsprojekte im Suchtbereich, das Modellprojekt Heroingestützte Behandlung (Krausz, Uchtenhagen et al., 1999), war einer der interessanten und auch wissenschaftlich herausfordernden Ansatzpunkte, was u. a. in dem Kapitel zur Psychoedukation in der Behandlung Heroinabhängiger seinen Niederschlag findet. Was lässt sich bei der kritischen Betrachtung der Erfahrung im Versorgungssystem sowie des Forschungsstandes quasi als Ausgangspunkt festhalten? 1. Die Möglichkeiten und Indikationsgebiete der Gruppenarbeit mit Süchtigen sind viel größer, als es sich im Durchschnitt der klinischen Praxis widerspiegelt. Schon heute wäre die Qualität vieler Versorgungsangebote und deren Systematisierung, vielleicht sogar Standardisierung, viel weiter, wenn Weiterbildung, Tagungen und Therapieausbildung diese Entwicklungen mehr zur Kenntnis nehmen würden. Es gibt insgesamt einen bedauerlichen Mangel an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem großen Arbeitsfeld. 2. Damit eng verbunden ist die bedauerliche Tatsache, dass es in Deutschland so gut wie keine Therapieforschung im Suchtbereich gibt. Viele Fragen konzentrieren sich vielmehr auf wenig standardisierte und teilweise allgemeine Versorgungssettings. Auch die so genannten Forschungsverbünde im Suchtbereich haben dazu keine Beiträge geliefert. Eine systematische Evaluierung auch neuerer Interventionsstrategien und Anwendungsbereiche findet also nur in extrem wenigen Fällen statt. Systematische klinische Forschung, wie sie z. B. in den USA umfangreich gefördert wird, findet in Europa und insbesondere in Deutschland so gut wie nicht statt. Eine der wenigen Ausnahmen ist die schon erwähnte Pilotstudie zur heroingestützten Behandlung, in deren Rahmen auch ein Kontrollgruppenvergleich zwischen standardisierten psychotherapeutischen bzw. psychosozialen Interventionen stattgefunden hat. 3. Die Aufmerksamkeit der etablierten Psychotherapieschulen für die Arbeit mit Süchtigen ist traditionell eher begrenzt. Ihre Ansätze und Gruppenkonzepte sind zudem selten auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Klientengruppen abgestimmt, wie dies bei der Arbeit mit Süchtigen sicher sinnvoll ist. Diese der Not gehorchende Umgehensweise in der Praxis war folglich eher eine kritische Distanz gegenüber theoriegestützten Ansätzen oder gar Standardisierung und hat insbesondere dominierenden Eklektizismus zur Folge gehabt. Dies muss im Rahmen vieler Behandlungsangebote nicht negativ sein, beschränkt aber die Entwicklungsmöglichkeiten, die Vergleichbarkeit und die Möglichkeiten einer Qualitätssicherung enorm. Die Arbeit in Gruppen und die Nutzung der spezifischen psychologischen und psychotherapeutischen Wirkmechanismen in der Arbeit mit Gruppen ist das tägliche Brot sowohl der Suchttherapie wie der Selbsthilfe. Um so positiver und nicht zu unterschätzen ist der Trend in der Suchttherapie, in verschiedenen Formen diese Arbeit zu qualifizieren und unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Gruppen von Suchtkranken anzupassen. Die Vielfältigkeit der Beiträge hier spiegelt den insbesondere aus der Versorgung heraus geborenen Versuch wider, diese Arbeit zu qualifizieren und die besten Erfahrungen auch aus anderen Bereichen der Psychotherapie für die Suchtarbeit nutzbar zu machen. Viele Anregungen sind dabei aus dem Fundus der Suchtforschung in den USA zu übernehmen. Aber auch in Deutschland gibt es eine Reihe interessanter und der speziellen Bedürfnislage von Abhängigen in verschiedenen Situationen des Prozesses geschuldete Therapieangebote, vom Kurs für das kontrollierte Trinken bis zur Psychoedukation. Angesichts der Abwesenheit von klinischer Forschung und des gleichbleibenden Mangels an Fördermitteln gibt es auch gar keinen anderen Weg, zu einer Qualifizierung des Angebotes in diesem riesigen therapeutischen Bereich beizutragen. In diesen Kontext will sich auch dieses Buch einordnen. Es will die systematische Diskussion um Gruppenarbeit in der Suchttherapie durch systematischen Erfahrungsaustausch und die Aufbereitung vorhandenen Wissens unterstützen und letztendlich auch zu weiteren Anstrengungen in der Weiterbildung wie der klinischen Forschung anregen. Die Macher haben dabei selbst durch Recherche und Erfahrungsaustausch dazugelernt und sind der Überzeugung, dass es sich bei diesem speziellen Thema um ein für die Zukunft der Suchttherapie und deren Qualität enorm wichtiges handelt. Michael Krausz, Raphaela Basdekis-Jozsa Literatur Krausz, M., A. Uchtenhagen et al. (1999). Medizinisch indizierte Heroinverschreibung in der Behandlung Drogenabhängiger: Klinische Versuche und Stand der Forschung in Europa. Sucht 45 (3): 171-186 O?Brien, W. B. and F. B. Perfas (2005). The Therapeutic Community. Substance Abuse - A Comprehensive Textbook. J. J. Lowinson, P. Ruiz, R. B. Millman and J. B. Langrod. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Petzold, H. G. und J. Sieper (1996). Integration und Kreation. Paderborn: Junfermann Uchtenhagen, A., I. Battegay et al. (1973). Gruppentherapie und soziale Umwelt. Gruppentherapie und soziale Umwelt. Zürich: Huber
| Erscheint lt. Verlag | 23.8.2006 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Leben lernen ; 193 |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 135 x 210 mm |
| Gewicht | 330 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychiatrie / Psychotherapie |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Suchtkrankheiten | |
| Schlagworte | Gruppentherapie • Suchtprävention • Suchttherapie • Verhaltenstherapie |
| ISBN-10 | 3-608-89038-6 / 3608890386 |
| ISBN-13 | 978-3-608-89038-9 / 9783608890389 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich