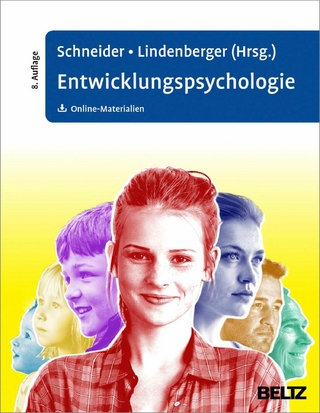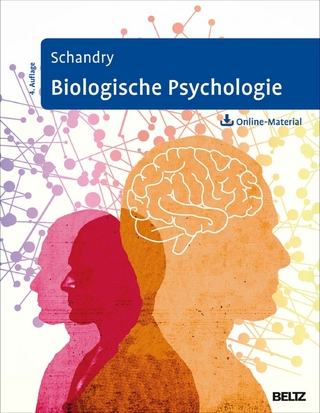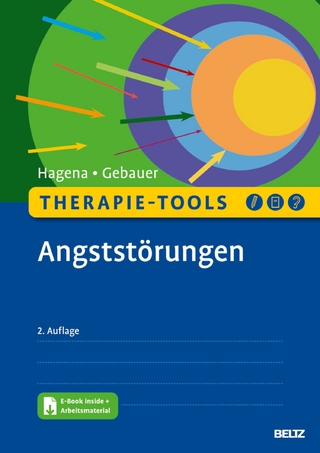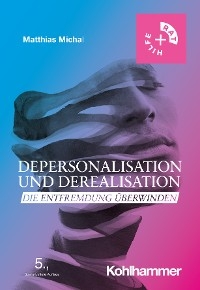
Depersonalisation und Derealisation (eBook)
224 Seiten
Kohlhammer Verlag
978-3-17-043573-5 (ISBN)
Prof. Dr. med. Matthias Michal, stellvertretender Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, leitet seit 2005 die erste Spezialsprechstunde 'Depersonalisation-Derealisation' in Deutschland.
Prof. Dr. med. Matthias Michal, stellvertretender Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, leitet seit 2005 die erste Spezialsprechstunde "Depersonalisation-Derealisation" in Deutschland.
2 Das Symptom, die Diagnose und die Krankheit
Zur Untersuchung bei einem Psychiater, Psychotherapeuten, Neurologen oder Nervenarzt gehört in der Regel die Erhebung eines psychischen oder psychopathologischen Befundes (»psychopathologisch« bedeutet krankhafte Veränderung der seelischen Funktionen). Im Rahmen dieser Befunderhebung beurteilen sie unter anderem auch, ob der Patient Symptome von Depersonalisation und Derealisation aufweist. Im deutschen Sprachraum werden diese Symptome den sogenannten Ich-Störungen zugerechnet, im anglo-amerikanischen den Wahrnehmungsstörungen. Da sehr häufig Patienten nicht spontan über diese Symptome klagen, sollte der Arzt gezielt danach fragen. Werden solche Symptome berichtet, sollte der Arzt den Patienten ermuntern, so ausführlich und konkret wie möglich seine Symptome zu schildern. Wichtig ist dabei auch, dass der Arzt etwas über den zeitlichen Verlauf der Symptome erfährt: Also, handelt es sich um eine Art von anfallsweisem Auftreten, bei dem die Symptome nur für ein paar Sekunden oder Minuten da sind, oder handelt es sich um längere über Stunden anhaltende Zustände, oder gar um einen über Monate und Jahre anhaltenden Dauerzustand? Diese Informationen sind für den Arzt wichtig, weil sie bereits Hinweise auf die zugrunde liegende Erkrankung liefern können. Zum Beispiel kommt es bei der Panikstörung nur zu kurzdauernden Anfällen von Depersonalisation/Derealisation, die üblicherweise noch von anderen Angstsymptomen begleitet sind. Genauso kommt es bei der Temporallappenepilepsie gleichfalls nur zu kurzdauernden Anfällen von Depersonalisation/Derealisation. Bei der Migräne hingegen können auch über Stunden andauernde Depersonalisationszustände auftreten. Es gibt aber auch das Krankheitsbild der Depersonalisations-Derealisationsstörung (DDS). Bei Patienten mit einer DDS ist das ganze Erleben von Depersonalisation und/oder Derealisation gekennzeichnet. Man spricht dann auch von primärer Depersonalisation, wohingegen Symptome von Depersonalisation, die ausschließlich im Rahmen einer anderen Erkrankung auftreten (z. B. Panikstörung, Epilepsie), als sekundäre Depersonalisation bezeichnet werden.
Das oben genannte Krankheitsbild der Depersonalisations-Derealisationsstörung ist eine offizielle Diagnose. Seelische Erkrankungen werden weltweit nach dem Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verschlüsselt. Dieses Klassifikationssystem heißt »Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme« (engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD). Es ist das wichtigste und weltweit anerkannte Klassifikationssystem für Krankheiten in der Medizin. Die Diagnose war bereits in jeder Version der ICD vorhanden und findet sich auch wieder in der neuen 11. Version (ICD-11), die seit Anfang 2022 gültig ist. Im Vergleich zur Vorgängerversion ICD-10 wurde erfreulicherweise die Definition an das amerikanische Diagnosesystem angeglichen. Die Diagnose der Depersonalisations-Derealisationsstörung wird in Zukunft nicht mehr unter den sonstigen neurotischen Störungen gemeinsam mit der Neurasthenie (chronisches Erschöpfungssyndrom) geführt, sondern zusammen mit den dissoziativen Störungen aufgelistet. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist das in der Forschung mehr verwendete Diagnosesystem der American Psychiatric Association (APA, Amerikanische Psychiatrische Vereinigung) gebräuchlich (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM; deutsch: Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen). Aktuell liegt die fünfte Version vor (DSM-5, APA 2013).
2.1 Die diagnostischen Kriterien
Die Tabelle zeigt die diagnostischen Kriterien der Depersonalisations-Derealisationsstörung der ICD-10 (F48.1) und des DSM-5 (300.6) (▸ Tab. 2.1). In der seit 2022 geltenden ICD-11 erfolgt eine weitgehende Angleichung der ICD-Kriterien an das DSM-5. Außerdem wird in der ICD-11 die Depersonalisations-Derealisationsstörung nicht mehr unter den sonstigen neurotischen Störungen geführt, sondern wie im DSM-5 unter den dissoziativen Störungen. Allerdings wird es noch mehrere Jahre dauern, bis die ICD-11 im Gesundheitssystem auch auf administrativer Ebene angewendet werden kann. Bis zur Umstellung werden die Abrechnungsdaten und Diagnosen in den Arztbriefen noch mit der ICD-10 verschlüsselt. In der ICD-10 wird die Depersonalisations-Derealisationsstörung auch als Depersonalisations-Derealisationssyndrom bezeichnet. In beiden Klassifikationssystemen fehlt ein Zeitkriterium. Experten sind sich aber einig, dass die Diagnose in der Regel nicht vergeben werden sollte, wenn die Symptome nicht über mindestens drei Monate (besser sechs) die meiste Zeit des Tages vorhanden waren.
Tab. 2.1:Diagnostische Kriterien der Depersonalisations-/Derealisationsstörung nach DSM-5 und ICD-10
| DSM-5: 300.6 | ICD-10: F48.1 |
|---|
|
Kommentar: Diese Diagnose sollte nicht gestellt werden, wenn das Syndrom im Rahmen einer anderen psychischen Störung auftritt, (...), in Folge einer Intoxikation mit Alkohol oder anderen psychotropen Substanzen, bei einer Schizophrenie (...), einer affektiven Störung, einer Angststörung oder bei anderen Zuständen (wie einer deutlichen Müdigkeit, einer Hypoglykämie oder unmittelbar vor oder nach einem epileptischen Anfall). Diese Syndrome treten im Verlauf vieler psychischer Störungen auf und werden dann am besten als zweite oder als Zusatzdiagnose bei einer anderen Hauptdiagnose verschlüsselt. |
Typischerweise empfinden die Betroffenen die Symptome als quälend. Häufig fühlen sich Betroffene durch die Symptome im zwischenmenschlichen und oder beruflichen Bereich beeinträchtigt. Sehr häufig sind vor allem Ängste, »verrückt« zu werden, die Kontrolle über den Verstand zu verlieren und peinlich aufzufallen (»man könnte mir ansehen, dass etwas mit mir nicht stimmt«). Im späteren Verlauf der Erkrankung leiden die Betroffenen vor allem unter dem Gefühl der Isolation und der Angst, ihr Leben oder den Sinn ihres Lebens zu verpassen. Mit Bezug auf die Arbeits- oder Studier- und Lernfähigkeit beklagen die Betroffenen...
| Erscheint lt. Verlag | 16.8.2023 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften |
| Medizin / Pharmazie | |
| Schlagworte | Depersonalisation • Depersonalisationsstörung • Derealisation • Entfremdung • Krisenintervention • posttraumatische Störungen • Psychodiagnostik • Psychogene Störungen • Psychosomatische Medizin |
| ISBN-10 | 3-17-043573-6 / 3170435736 |
| ISBN-13 | 978-3-17-043573-5 / 9783170435735 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich