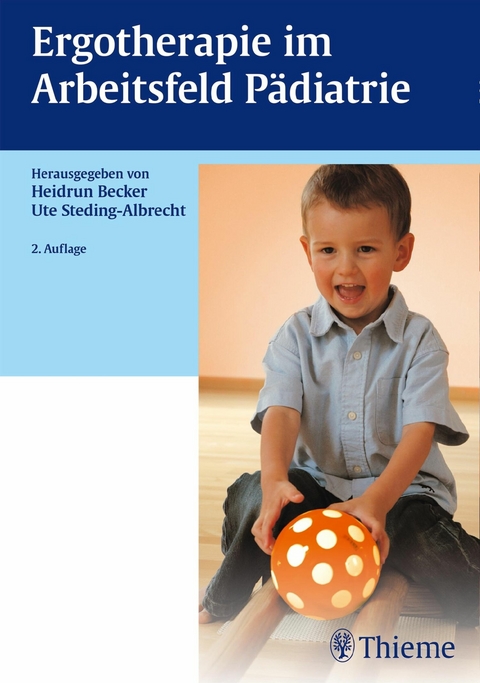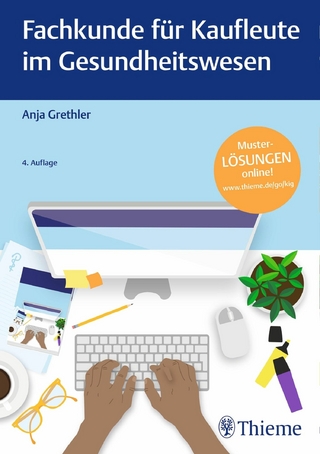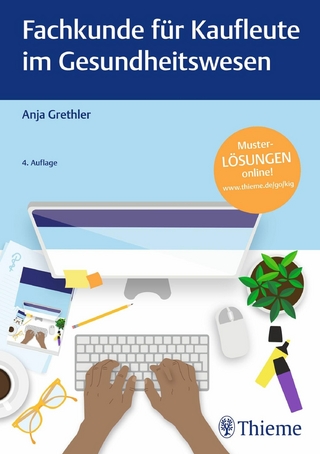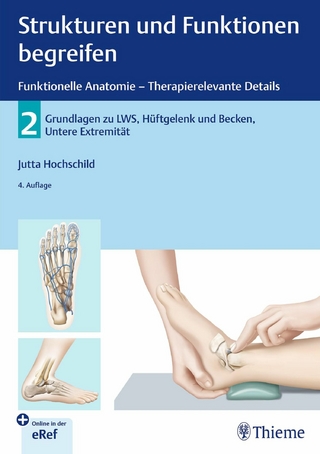Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie (eBook)
480 Seiten
Thieme (Verlag)
978-3-13-169312-9 (ISBN)
Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie 1
Innentitel 5
Impressum 6
Autoren 7
Geleitwort 9
Vorwort 11
Vita 12
Inhalt 15
1 Kindliche Entwicklung 27
1.1 Entwicklungspsychologische Modelle 28
1.1.1 Denken u?ber Entwicklung 28
Phasen, Stufen, Spru?nge 28
Entwicklung als Aufbau versus Entwicklung als Wachstum 29
Reifung versus Lernen 29
1.1.1 Denken über Entwicklung 28
1.1.2 Ausgewählte Entwicklungstheorien 30
Strukturgenetische Entwicklungsmodelle 30
Psychoanalytische Entwicklungsmodelle 33
Lernmodelle der Entwicklung 34
Ökologische Entwicklungstheorien 34
Entwicklung im Alter 34
1.2 Pränatale Entwicklung und erstes Lebensjahr 36
1.2.1 Pränatale Entwicklung 36
Sensorische und motorische Entwicklung 36
Sozioemotionale Entwicklung 37
Kognition 38
1.2.2 Neugeborene 38
Sensomotorik 38
Sozioemotionale Entwicklung 40
Kognition 40
1.2.3 Zwei bis zwölf Monate 41
Sensomotorik 41
Sozioemotionale Entwicklung 43
Kognitive Entwicklung 44
Selbstständigkeit 44
1.3 Kleinkinder 45
1.3.1 Einjährige Kinder (13–24 Monate) 45
Sensomotorik 45
Hände manipulieren, spielen, fu?hlen 46
Entwicklung der Graphomotorik und Händigkeit 46
Sozioemotionale Entwicklung 46
Kognition 47
Sprache 47
Selbstständigkeit 47
1.3.2 Zweijährige Kinder (25–36 Monate) 48
Sensomotorik 48
Hände: manipulieren, spielen,fu?hlen 49
Entwicklung der Graphomotorik und Händigkeit 49
Sozioemotionale Entwicklung 49
Kognition 49
Sprache 49
Selbstständigkeit 51
1.4 Kindergartenkinder 52
1.4.1 Dreijährige Kinder (37–48 Monate) 52
Sensomotorik 52
Hände: manipulieren, spielen, fu?hlen 52
Entwicklung der Graphomotorik und der Händigkeit 52
Sozioemotionale Entwicklung 52
Kognition 54
Sprache 54
Selbstständigkeit 54
1.4.2 Vierjährige Kinder (49–60 Monate) 54
Sensomotorik 54
Hände: manipulieren, spielen,fu?hlen 54
Entwicklung der Graphomotorik.und der Händigkeit 55
Sozioemotionale Entwicklung 55
Kognition 56
Sprache 56
Selbstständigkeit 56
1.5 Vorschulkinder 57
1.5.1 Fünfjährige Kinder 57
Sensomotorische Entwicklung 57
Hände: manipulieren, spielen, fu?hlen 58
Entwicklung der Graphomotorik und der Händigkeit 58
Sozioemotionale Entwicklung 59
Kognition 59
Sprache 59
Selbstständigkeit 59
1.6 Schulkinder 60
Schulfähigkeit 60
1.6.1 Schule als Umwelt 61
Anforderungen der Umwelt 61
1.6.2 Entwicklung von Autonomie und sozialer Kompetenz 61
Kind und Familie 62
Gleichaltrige (Peers) 62
Lehrer und Lehrerin 62
Entwicklung des Selbstkonzepts 62
Entwicklung der Leistungsmotivation 62
1.6.3 Aktivitäten im Alltag des Kindes 63
Selbstständigkeit 63
Aktivitäten aus dem Bereich Schule 63
Freizeit und Spiel 64
1.6.4 Kognitive Entwicklung 64
1.6.5 Wahrnehmung 65
1.6.6 Motorische Entwicklung 65
Grobmotorik 65
Feinmotorik 65
1.7 Vorpubertät 66
1.7.1 Körperliche Veränderungen 66
Weibliche Entwicklung 66
Männliche Entwicklung 67
Körperbild 68
Kognitive Entwicklung 68
1.8 Jugendliche 70
1.8.1 Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz 70
Entwicklungsaufgaben nach Havighurst 70
Entwicklungsaufgaben nach Erikson 71
1.8.2 Bedeutung Gleichaltriger für die Entwicklung in der Adoleszenz 71
1.8.3 Einfluss des Erziehungsstils auf das Verhalten von Jugendlichen 72
2 Neurophysiologische Grundlagen 73
2.1 Grundlagen der Bewegung 74
2.1.1 Bewegungsplanung 74
2.1.2 Stabilität 74
2.1.3 Körperhaltung 74
2.1.4 Muskelphysiologie 75
2.1.5 Motorische Systeme und zentrales Nervensystem 76
Neuroanatomische Grundlagen 76
Funktionelle Organisation des zentralen Nervensystems 78
2.2 Grundlagen der Wahrnehmungsverarbeitung 81
2.2.1 Umwandlung der Umweltstimuli in die „Welt“ des Gehirns 81
2.3 Plastizität 83
3 Neuropsychologische Grundlagen 85
3.1 Aufmerksamkeit 86
3.1.1 Definition und Komplexität des Begriffs Aufmerksamkeit 86
3.1.2 Hierarchische Einteilung der Aufmerksamkeit 86
3.1.3 Cocktail-Party-Phänomen 87
3.1.4 Neurophysiologie der Aufmerksamkeit 88
3.1.5 Störungen der Aufmerksamkeit 89
Visueller Hemineglect 89
„Aufmerksamkeit-Defizit“-Syndrom (ADS) 89
3.1.6 Schlussfolgerungen 89
3.2 Gedächtnis 91
3.2.1 Sensorisches Gedächtnis 91
3.2.2 Kurzzeitgedächtnis 91
3.2.3 Langzeitgedächtnis 92
3.2.4 Erinnerung als konstruktiver Prozess 92
3.2.5 Gedächtnisstörungen: Neurologische Grundlagen des Gedächtnisses 92
3.3 Exekutive Funktionen 94
3.3.1 Human-Befunde 94
3.3.2 Zielgerichtetes Verhalten bei Frontalhirnschädigungen 95
3.4 Motivation 96
3.4.1 Theoretische Ansätze 96
3.4.2 Motivation durch Instinkte 96
3.4.3 Kognitionen, Erwartungen und Attributionen 97
3.5 Emotion 98
3.5.1 Bedeutung der Emotion 98
3.5.2 Physiologische Prozesse der Emotion 98
3.5.3 Wie werden physiologische Erregung und Bewertung verknüpft? 99
3.5.4 Störungen der Emotion 99
3.5.5 Neurophysiologie der Emotion 100
3.6 Lernen 101
3.6.1 Klassische Konditionierung 101
Löschung und spontane Erholung 101
Reizdiskrimination 101
Generalisierte Furchtreaktion 101
3.6.2 Instrumentelle Konditionierung 102
Verhaltenssteuerung 102
Verstärker 102
4 Entwicklungsstörungen 103
4.1 Ursachen von Entwicklungsstörungen 104
4.1.1 Pränatale Störungen 104
4.1.2 Perinatale Störungen 105
Intrapartale Störungen 105
Fru?hgeburten 105
4.1.3 Postnatale Störungen 105
Apgar-Score 105
4.2 Klassifikationen 107
4.2.1 „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) und „International Classification of Diseases“(ICD-10) 107
Beispiele der Komponenten der ICF 108
4.2.2 Zielformulierung auf Aktivitäts-und Partizipationsebene 108
5 Ergotherapeutischer Behandlungsprozess 113
5.1 Klinisches Reasoning 114
5.2 Behandlungsprozess 117
5.2.1 Theoretische Grundlagen 117
Funktionsorientierte oder betätigungsorientierte Ausrichtung? 118
Auf welcher Theorie baut der Befunderhebungsprozess auf? 118
Ansätze fu?r Befund undB ehandlung 119
5.2.2 Problemlöseprozess 120
5.2.3 Beschreibung des Behandlungsprozesses 120
Intervention beginnen – Überweisungskontext 121
Verordnung von Ergotherapie im Kindesalter 121
Befunderhebung 122
Planung und Durchfu?hrung der Behandlung 126
5.3 Diagnostik und Befundaufnahme 134
5.3.1 Grundlegende Gedanken zur Datensammlung in der Befundphase 134
Merkmale einer betätigungsorientierten Befundaufnahme 136
5.3.2 Befundungsprozess 136
Daten und Informationen sammeln 136
Betätigungsprofil erstellen 137
Betätigungsanalyse durchfu?hren 138
Testverfahren 139
Ziele mit Klienten formulieren 141
Dokumentation 142
5.3.3 Betätigungsorientierte Messinstrumente 142
Betätigung 142
Basisfähigkeiten während einer Betätigung 142
Selbstversorgung 143
Spielfähigkeit und Spielentwicklung 143
Schulfähigkeiten 144
5.3.4 Diskussion 144
5.4 Evaluation 146
5.4.1 Evaluation der Patientenstruktur 147
5.4.2 Effizienz der Arbeit 147
5.4.3 Evaluation der Therapeutenauslastung 147
5.4.4 Evaluation der Verordnungsstruktur 147
5.4.5 Ergebnisevaluation 148
Test- und Screeningverfahren 148
Beobachtung und Verlaufsdokumentation 148
Befragung der Klienten 149
Befragung der Angehörigen 149
5.4.6 Evaluation der Therapeutenkompetenzen 151
5.4.7 Evaluation der Teamarbeit 151
5.4.8 Qualitätsmanagement 151
5.4.9 Evidenzbasierte Praxis und Leitlinien 151
Evidenzbasierte Praxis 151
Evaluation als Werkzeug evidienzorientierter Ergotherapie 153
Leitlinien 153
5.5 Pädagogische Fragestellungen in der Ergotherapie 154
5.5.1 Pädagogik und pädiatrische Ergotherapie 154
Womit beschäftigt sich die Pädagogik? 154
Welche Schnittstellen gibt eszwischen pädiatrischer Ergotherapie und Pädagogik? 154
Welche Bereiche sind fu?r die Ergotherapie relevant? 154
5.5.2 Pädagogische Spannungsfelder und ihr Bezug zur pädiatrischen Ergotherapie 156
Mikrosoziale/interpersonale Ebene: Erziehung 156
Interpersonale Ebene: Lehren 164
5.5.3 Fragen und Aufgaben für die theoretische und praktische Ergotherapie 164
Praktische Ergotherapie 164
Theoretische Ergotherapie 165
5.5.4 Zusammenfassung 165
5.6 Konzeptionelle Modelle in der Pädiatrie 166
5.6.1 Model of Human Occupation (MOHO) 166
Child Occupational Self Assessment (COSA) 166
Model of Human Occupation (MOHO) 166
Aufbau des COSA (Version 2.1) 167
Durchfu?hrung 168
Wer wird mit dem COSA befragt? 168
Aktuelle Forschung in den USA und Deutschland zum COSA 168
5.6.2 Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 171
Kanadisches Modell (CMOP) 171
Aufbau des COPM 172
Durchfu?hrung 172
Wer wird mit dem COPM befragt? 173
Aktuelle Forschung in Kanada und Deutschland 173
5.6.3 Möglichkeiten und Grenzen klientenzentrierter Assessments 175
Möglichkeiten 175
Grenzen 176
5.6.4 Bieler Modell 177
Handeln in der Ergotherapie – zum Konzept der Handlungsfähigkeit 177
Handlungsbedingungen 178
Grundsätzliches zur Anwendung des Bieler Modells 180
Zusammenfassung 181
6 Ergotherapeutische Konzepte 183
6.1 Bobath-Konzept 184
6.1.1 Entstehung des Bobath- Konzepts 184
6.1.2 Paradigmen und Prinzipien 184
6.1.3 Indikationen 185
6.1.4 Umsetzung des Bobath- Konzepts in der Ergotherapie 185
Ergotherapeutischer Behandlungsprozess nach dem Bobath-Konzept 186
6.1.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Weiterbildung 188
6.1.6 Ergotherapeutischer Behandlungsprozess in Verknüpfung mit der ICF 188
Körperfunktionen und Körperstrukturen 188
Beeinträchtigung der Aktivität und der Partizipation 189
6.2 Sensorische Integrationstherapie 192
6.2.1 Konzept 192
SI-Dysfunktionen 196
6.2.2 Befunderhebung 197
Fragebögen 197
Spielbeobachtung 198
Gezielte klinische Beobachtungen 198
SCSIT 198
SIPT 198
Weitere Tests 199
6.2.3 Therapie 199
Erlernen und Anwenden des SI-Konzeptes 201
6.3 Frostig-Konzept 203
6.3.1 Diagnostik 203
6.3.2 Therapie 204
Körperbewusstsein 205
6.3.3 Einsatzmöglichkeiten in der Ergotherapie 205
Weitere Informationen 206
6.4 Basale Stimulation 207
6.4.1 Konzept 207
Grundannahmen des Konzeptes 207
Entwicklung des Konzeptes 207
6.4.2 Diagnostik und Elternarbeit 208
6.4.3 Therapie 208
Beru?hrung als Dialog 208
Somatische Angebote 209
Vestibuläre Angebote 210
Vibratorische Angebote 211
Auditive Angebote 211
Visuelle Angebote 211
Orale Angebote 211
Habituation 212
6.4.4 Basale Stimulation und Ergotherapie 212
6.5 Psychomotorik 214
6.5.1 Konzept 214
6.5.2 Didaktik und Methodik 214
Ziel 215
6.5.3 Diagnostik 215
6.6 Affolter-Modell® 216
6.6.1 Anfänge 216
6.6.2 Grundlagen 216
Umwelt 216
Taktil-kinästhetisches System 216
Alltagsgeschehnisse 217
6.6.3 Normalentwicklung 218
Modale Entwicklungsstufe (bis ca. 4. Lebensmonat) 218
Intermodale Entwicklung (4. bis ca. 12. Lebensmonat) 218
Seriale Entwicklungsstufe (ca. ab dem 12. Lebensmonat 219
6.6.4 Diagnostik 219
6.6.5 Therapie 219
Angebot 219
Einstieg 220
Elementares Fu?hren 221
Pflegerisches Fu?hren 222
Versprachlichung 223
Effektkontrolle 223
6.6.6 Elternarbeit 224
6.7 Castillo-Morales-Konzept 225
6.7.1 Dr. Castillo Morales 225
6.7.2 Konzept 225
6.7.3 Indikation 225
6.7.4 Therapie 227
Hilfen fu?r Kinder mit neurologischen Abweichungen 227
Orofaziale Regulationstherapie 228
6.7.5 Elternarbeit 229
6.8 Forced-Use-Therapie 230
6.8.1 Konzept 230
6.8.2 Diagnostik 230
6.8.3 Indikation 230
6.8.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 231
6.8.5 Therapie 231
6.9 Weitere therapeutische Konzepte 233
6.9.1 Feldenkrais 233
Konzept 233
Indikation 233
Information 233
6.9.2 Verhaltenstherapie 234
Geschichte 234
Grundlagen 234
Vorgehensweise 234
Therapieverfahren 236
Indikation 237
Bedeutung fu?r die Ergotherapie 237
7 Betätigungen, Aktivitäten und Mittel der Ergotherapie 239
7.1 Alltag als Therapiefeld – Hausarbeit macht schlau 242
7.1.1 Ziel und Prozess der Ergotherapie 242
7.1.2 Was bedeutet Hausarbeit? 243
7.1.3 Bedeutung von Handlungen im Alltag 243
7.1.4 Beeinträchtigung von Handlung und Handlungsfähigkeit 244
7.1.5 Hausarbeit als Aktivität aus ergotherapeutischer Sicht 244
7.1.6 Erlernte Fertigkeiten und deren Übertragung auf den Schulalltag 245
7.2 Handwerk 249
7.2.1 Bedeutung der Aufrichtung in Bezug auf das Handwerk 249
7.2.2 Wert des Selbstherstellens 249
7.2.3 Handwerk in der Ergotherapieausbildung 249
7.2.4 Handwerk im ergotherapeutischen Alltag 250
Behandlungsplanung und Durchfu?hrung 251
7.2.5 Bedeutung des Hand-Werks in der Ergotherapie 255
7.3 Spiel – „Und du solltest die Verkäuferin sein ...!“ 256
7.3.1 Spiel als Betätigungsform der frühen Kindheit 256
Spielhandlungen 256
7.3.2 Lernen und Anpassung im Spiel 257
7.3.3 Spielentwicklung 258
7.3.4 Partner des Kindes im Spiel 258
Eltern als Spielpartner 258
Kinder als Spielpartner 263
Therapeuten als Spielpartner 264
7.3.5 Spiel in der Therapie 264
Spielen unter funktionellen Aspekten 264
Spielen als Therapieziel 264
Spielen in der Spieltherapie 264
7.3.6 Raum für Spiel und Spielmaterial 265
7.3.7 Spielpositionen 267
7.3.8 Spielthemen 267
7.4 Musik 269
7.4.1 Rhythmus 269
7.4.2 Indikationen 269
7.4.3 Therapeutische Wirkung 270
7.5 Computer 271
7.5.1 Einsatz von Computern in der Ergotherapie 271
PC-Arbeitsplatz und Arbeitshaltung 271
Möglichkeiten und Grenzen des Computers als Therapiemittel 271
7.5.2 Computer als Hilfsmittel zum Schriftspracherwerb 272
Computerprogramm Multitext mit Etex-Sprachausgabe 273
8 Adaptation 275
8.1 Hilfsmittelversorgung 276
8.1.1 Hygiene 276
Baden 276
Toilette 276
8.1.2 Lagerungen und Spielpositionen bei kleinen oder schwerbehinderten Kindern 277
Ru?ckenlage 277
Bauchlage 278
Seitlage 278
Sitzen 278
8.1.3 Stand und Aufrichtung 280
8.1.4 Spielpositionen bei größeren Kindern 280
8.1.5 Mobile Fortbewegung 281
8.1.6 Der Weg zum Hilfsmittel 282
Informationen sammeln 282
Hilfsmittel erproben 282
Verordnung des Hilfsmittels 283
Hilfsmittel anpassen und Bezugspersonen einweisen 283
Hilfsmittel u?berpru?fen 283
8.2 Kinder mit Körper-behinderung lernen lesen und schreiben 284
8.2.1 Unterstützte Kommunikation 284
8.2.2 Am Computer lesen und schreiben lernen 284
9 Elternarbeit 287
9.1 Situation der Eltern von Kindern mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen 288
9.1.1 Krisenbewältigung als Lernprozess 288
Eingangsstadium 288
Durchgangsstadium 288
Zielstadium 289
Trost, Unterstu?tzung und Freundschaft 289
9.2 Elternarbeit in der Ergotherapie 290
9.2.1 Methoden der Elternarbeit 290
Aufklärung und Information 290
Anleitung 291
9.3 Elternberatung in der Ergotherapie 292
9.3.1 Kontaktaufnahme und Beziehungen 292
9.3.2 Unterschiede zwischen Gespräch und Beratung 292
9.3.3 Aspekte der Beratung 293
Initiative zur Beratung 293
Problembewusstsein und Veränderungswille 293
Auftragsklärung 294
Setting 294
9.3.4 Beispiel für Themen in der Elternberatung 295
Fähigkeiten und Fertigkeiten 295
Grenzen 295
Pädagogische Richtungen 296
Spielmaterial 296
Rhythmus und Rituale 296
Auszeiten 296
Verantwortung und Schuld 296
Unterschiedliche Therapieansätze 296
9.3.5 Von der Problemtrance zur Lösungsorientierung 297
9.3.6 Zusammenfassung 299
10 Ergotherapie bei typischen Störungen 301
10.1 Ergotherapie mit frühgeborenen Kindern und frühgewordenen Eltern 302
10.1.1 Frühgeborene 302
Langzeitprobleme 302
Erstversorgung des Fru?hgeborenen 303
Reizverarbeitung und Dialog 303
Entwicklung des Körperschemas und Körperbildes 304
Negativerfahrungen 305
Allgemeine Entwicklungsförderung 305
Körpernahsinne 306
10.1.2 Eltern frühgeborener Kinder 306
Dialog: Eltern – Kind 306
Hilfestellung 307
Kontakt und Kommunikation 307
Allgemeines 308
10.1.3 Ergotherapie mit frühgeborenen Kindern 308
Beobachtungskriterien des Allgemeinzustandes und der Reife 308
Lagerung 308
Handling 310
Andere Fachgebiete und interdisziplinäre Zusammenarbeit 312
10.2 Ergotherapie bei Kindern mit Entwicklungs-störungen bzw. Entwicklungsverzögerungen 313
10.2.1 Variationen der normalen Entwicklung 314
10.2.2 Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsrückstand 317
10.2.3 Entwicklungsdiskrepanzen bzw. Teilleistungsstörungen 318
10.2.4 Entwicklungsstörungen 319
10.2.5 Behinderung 320
10.2.6 Ergotherapie bei Entwicklungsstörungen 320
Diagnostik 321
Befundaufnahme unter Einbeziehung der Eltern 321
Vorgehensweise 323
10.3 Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungs-störungen 326
10.3.1 Wahrnehmungsstörungen in verschiedenen Lebensaltern 326
Säuglingsalter 326
Kindergartenalter 327
Schulalter 328
10.3.2 Ursachen 328
10.3.3 Symptome 328
Auditive Wahrnehmungsstörungen 329
Visuelle Wahrnehmungsstörungen 329
10.3.4 Diagnostik 329
Assessments und Tests 330
Diagnostik auditiver Wahrnehmungsstörungen 330
Diagnostik visueller Wahrnehmungsstörungen 331
10.3.5 Therapien anderer Fachgebiete 331
10.3.6 Ergotherapie 331
Behandlungsziele 331
Strategien und Interventionen 331
Dauer und Häufigkeit 336
Behandlungsabschluss 336
10.4 Ergotherapie bei Kindern mit graphomotorischen Störungen 338
10.4.1 Schriftspracherwerb 338
10.4.2 Voraussetzungen für das Schreiben 338
Taktil-propriozeptiveWahrnehmung 338
Haltung 339
Schulter- und Armfunktion 339
Auge-Hand-Koordination 339
Hand-Hand-Koordination 339
Händigkeit 339
Identifikation der Finger 340
Opposition des Daumens 340
Präzisionsgriffe – Zug- und Stoßbewegungen 340
10.4.3 Stifthaltungen 340
Faustgriff 340
Einwärts gedrehter Quergriff mit gestrecktem Zeigefinger 341
4-Punktgriff 341
Schlu?sselgriff 341
Individuelle unökonomische Stifthaltungen 342
10.4.4 Diagnostik 343
Developmental Test of Visual Perception (DTVP-2) 343
Sensory Integration and Praxis Test nach Ayres (SIPT 343
Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) 343
Miller Assessment for Preschoolers (MAP) 343
Erfassung der Händigkeit 343
Checkliste 343
10.4.5 Therapie 345
Stifthilfen 346
Linkshändigkeit 346
10.5 Ergotherapie bei Kindern mit Körperbehinderung 347
10.5.1 Definitionen 347
10.5.2 Erscheinungsbilder und Ursachen von Körperbehinderung 347
10.5.3 Kinder mit infantiler Zerebralparese 348
10.5.4 Ergotherapie bei Kindern mit infantiler Zerebralparese 349
Ziele und Maßnahmen 349
Konzepte 350
10.5.5 Spina bifida und Hydrozephalus 350
Formen 350
Neurologische Symptomatik 351
Therapien anderer Berufsgruppen 351
10.5.6 Ergotherapie bei Kindern mit Spina bifida 351
Hauptprobleme 351
Konzepte 352
Ziele und Maßnahmen 352
10.5.7 Neuromuskuläre Erkrankungen 353
Neurogene Muskelerkrankungen 353
Myopathien 354
Therapien anderer Berufsgruppen 355
10.5.8 Ergotherapie bei neuromuskulären Erkrankungen 355
Ziele und Maßnahmen 355
Konzepte 356
Zusammenfassung 357
10.6 Ergotherapie bei sehgeschädigten und blinden Kindern 367
10.6.1 Wann spricht man von einer Sehschädigung oder Sehbehinderung? 367
10.6.2 Erkrankungen des Sehsystems 367
Ursachen fu?r Schädigungen 368
Allgemeine Folgen einer Sehbehinderung 368
10.6.3 Ärztliche Diagnostik und Therapie 368
Ärztliche Untersuchungen 368
Ärztliche Behandlung 368
Förderung und Therapie 369
10.6.4 Ergotherapie 369
Ziele 369
Diagnose 369
Behandlungsansätze und Konzepte 370
Therapiemittel und Spiele 370
Therapeutische Maßnahmen 371
10.6.5 Blindheit 372
Besonderheiten beim Spiel blinder Kinder 372
Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder 373
10.6.6 Zentrale Sehbehinderung 373
Besonderheiten im Verhalten von Kindern mit CVI 373
Strategien fu?r die Therapie 373
10.7 Ergotherapie bei Kindern mit Hörbeeinträchtigungen und -behinderungen 376
10.7.1 Anatomie und Funktionen des Gehörs 376
10.7.2 Formen, Schweregrade und Ursachen kindlicher Hörstörungen 376
Formen von Hörstörungen 376
Schweregrade 376
Ursachen 377
10.7.3 Therapien anderer Fachgebiete 377
Ärztliche Therapie 377
Logopädische sowie audiopädagogische Maßnahmen 378
Kompensatorische Strategien 378
10.7.4 Ergotherapie 378
Therapeutische Anpassungsleistungen 378
Informationen sichern 378
Geräuschidentifikation fördern 379
Geräuschlokalisation fördern 379
10.8 Ergotherapie bei Kindern mit schwerer Mehrfachbehinderung 380
10.8.1 Bewegung 381
Grundsituation 381
Ergotherapeutische Ansätze 381
10.8.2 Tasten und Spüren 383
Grundsituation 383
Ergotherapeutische Ansätze 384
10.8.3 Interagieren und Kommunizieren 386
Grundsituation 386
Ergotherapeutische Ansätze 386
10.9 Ergotherapie bei Kindern mit Teilleistungsstörungen 389
10.9.1 Lese-Rechtschreib-Störung 389
Ätiologie 389
Prävalenz 390
Diagnostik 390
Ergotherapie 390
Beratung und Umfeldgestaltung 390
10.9.2 Rechenstörung 391
Ätiologie 391
Prävalenz 391
Diagnostik 391
Therapie 392
Ergotherapie 392
Beratung 392
10.10 Ergotherapie bei Kindern mit geistiger Behinderung 393
10.10.1 Begriffsannäherung 393
10.10.2 Ursachen 394
10.10.3 Ärztliche Diagnostik 395
10.10.4 Ergotherapeutische Befundaufnahme 396
Parallelisierungsthese 397
10.10.5 Genetisch bedingte Syndrome 398
Angelman-Syndrom 398
Cornelia-de-Lange-Syndrom 399
Down-Syndrom 399
Fötales Alkoholsyndrom 399
Fragile-X-Syndrom 399
Rett-Syndrom 400
Rubinstein-Taybi-Syndrom 400
10.10.6 Ergotherapie 400
Therapieziele 400
Therapieplanung 400
Medien und Mittel ergotherapeutischer Intervention 401
Mögliche Behandlungskonzepte 402
10.11 Ergotherapie bei Kindern mit Aufmerksamkeits-defizit-/ Hyperaktivitäts-störung (ADHS) 405
10.11.1 Terminologie und Klassifikation 405
10.11.2 Symptome 406
Hyperaktivität 406
Impulsivität 407
Unaufmerksamkeit 407
Handlungsfähigkeit 408
Soziale Problematik 408
Emotionales Verhalten 409
Positive Verhaltensweisen 409
10.11.3 Entstehungsmodell 409
10.11.4 Spezifische Entwicklung 411
Säuglinge 411
Kleinkinder 411
Kindergarten-Kinder 411
Schu?ler 411
Jugendliche 411
Erwachsene 412
Prognose 412
10.11.5 Komorbiditäten und Differenzialdiagnostik 412
Multimodale Diagnostik 412
10.11.6 Multimodales Therapiekonzept 413
10.11.7 Ergotherapie 413
Befundaufnahme 413
Behandlung 416
Beratung 418
10.11.8 Fazit 419
10.12 Ergotherapie bei Kindern mit Autismus 421
10.12.1 Autistische Störung und Asperger-Syndrom 421
Verbreitung 421
Autistische Triade 421
Weitere Besonderheiten 422
Komorbidität 422
Verlauf 422
10.12.2 Diagnostik 422
10.12.3 Störungen der Handlungskompetenz und Betätigung im Alltag 423
10.12.4 Ergotherapie 424
Sensorische Integrationstherapie 424
Verhaltenstherapie 424
TEACCH 424
Unterstu?tzte Kommunikation 425
10.12.5 Andere Fachgebiete 427
11 Ergotherapeutische Arbeitsfelder 429
11.1 Ergotherapie in der Frühförderung 430
11.1.1 Grundprinzipien 430
11.1.2 Aufgaben der Ergotherapie 430
11.1.3 Möglichkeiten und Grenzen 431
11.2 Ergotherapie im Sozialpädiatrischen Zentrum 432
11.2.1 Grundprinzipien 432
11.2.2 Aufgaben der Ergotherapie 433
11.2.3 Besondere Kinder – besondere Anforderungen 433
11.3 Ergotherapie in der Praxis 434
11.3.1 Heilmittelrichtlinien als Behandlungsgrundlage 434
11.3.2 Leistungen der Ergotherapie 434
11.3.3 Indikationen 435
11.4 Ergotherapie in der Kinderklinik 436
11.4.1 Grundprinzipien 436
11.4.2 Indikationen 436
11.4.3 Aufgaben der Ergotherapie 436
11.4.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 437
11.4.5 Unterschiede zur ergotherapeutischen Arbeit in einer Praxis 437
11.5 Ergotherapie in der Kindertagesstätte 439
11.5.1 Grundprinzipien 439
11.5.2 Aufgaben der Ergotherapie 439
11.5.3 Ergotherapeutische Räume 439
11.5.4 Messbare Behandlungserfolge 439
11.6 Ergotherapie in der Schule 443
11.6.1 Sonderpädagogische Förderung in der Bundesrepublik 443
11.6.2 Ergotherapeuten in Schulen 444
11.6.3 Team 445
12 Interdisziplinäre Teamarbeit 447
12.1 Was ist ein interdisziplinäres Team? 448
12.2 Das Team im Rahmen einer Institution 448
12.3 Teamarbeit und Konfliktlösungen aus der Sicht der Rollentheorie 449
Konfliktlösungen aus Sicht der Rollentheorie 450
12.4 Das Team aus Sicht der Gruppendynamik 450
12.5 Das Team aus der Sicht der Psychoanalyse 451
12.5.1 Themenzentrierte Interaktion 451
12.5.2 Milani-Comparetti 452
12.6 Das Team aus der Sicht der Kommunikationstheorie 453
12.7 Teamsupervision 454
Sachverzeichnis 456
| Erscheint lt. Verlag | 14.1.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Gesundheitsfachberufe |
| Schlagworte | ADHS • Albrecht • Arbeitsfeld • Autismus • Bobath-Konzept • Castillo Morales • Entwicklungspsychologie • Ergotherapie • ICF • Klinisches Reasoning • Pädiatrie • Sensorische Integrationstherapie • Steding |
| ISBN-10 | 3-13-169312-6 / 3131693126 |
| ISBN-13 | 978-3-13-169312-9 / 9783131693129 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 11,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich