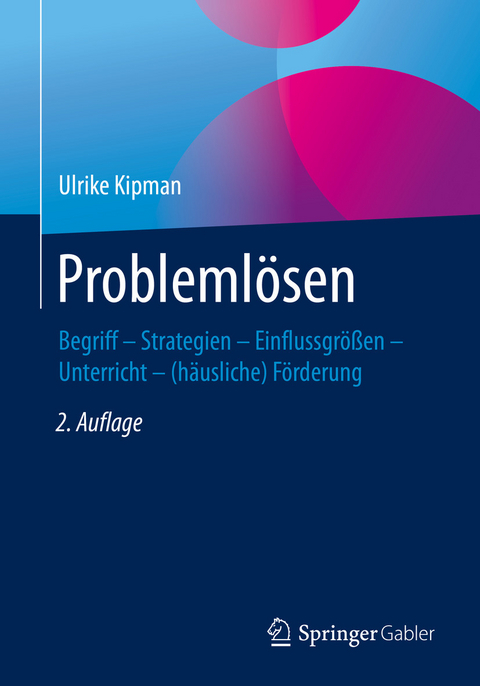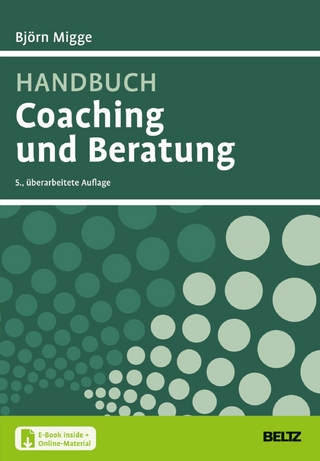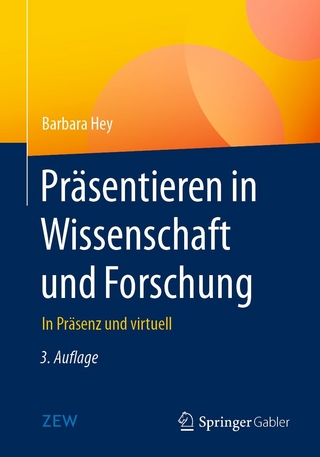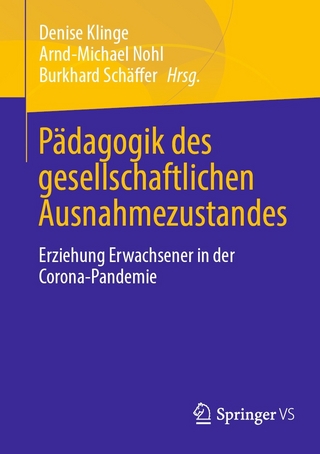Problemlösen (eBook)
XIV, 256 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-658-26804-6 (ISBN)
Problemlösen gilt als eine der Schlüsselqualifikationen des 21. Jahrhunderts. Es geht beim Problemlösen nicht nur darum, Informationen sinnvoll zu vernetzen, dynamisch in Beziehung zu setzen, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und eine Kette richtiger Entscheidungen zu treffen, sondern auch vielfach darum, eine Vielzahl an Außenkriterien zu berücksichtigen und ein entsprechendes 'Weltwissen' an den Tag zu legen. Dieses Buch soll die Frage beantworten, wie man zu einem guten Problemlöser / einer guten Problemlöserin werden kann bzw. warum bestimmte Personen bei der Lösung von Problemen erfolgreicher sind als andere. Nach einer umfassenden Zusammenstellung der Literatur zu diesem Thema werden Einflussgrößen auf das Problemlösen analysiert und miteinander abgeglichen und Ideen für den Unterricht in der Primarstufe und Sekundarstufe I präsentiert. Zudem werden verschiedene Arten des Unterrichts im Hinblick auf die Wirksamkeit für unterschiedliche Personengruppen diskutiert, dies vor dem Hintergrund, dass nicht nur Problemstellungen stark variieren sondern auch die Problemlöser/innen. Eine Handreichung mit Brettspielen, die die Kriterien des Problemlösens erfüllen, ist ebenfalls Teil dieses Buches. Letztendlich wird ein Modell vorgeschlagen, welches erfolgreiches Problemlösen vielschichtig zu erklären versucht.
In der 2. Auflage wurden alle Kapitel überarbeitet und an den neuesten Kenntnisstand zum Thema Problemlösen angepasst. Die Kapitel zur schulischen und häuslichen Förderung der Problemlösekompetenz wurden stark erweitert und es werden nun eine Vielzahl an neuen Aufgaben und Spielen präsentiert, die beim Fördern von Problemlösen eine wertvolle Unterstützung leisten können. Das Kapitel zur Kombinatorik wurde nach der Rückmeldung von Studierenden und Kollegen komplett umstrukturiert und ist nun verständlicher und übersichtlicher aufgebaut.
Ulrike Kipman ist Hochschulprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Salzburg im Bereich Bildungswissenschaften. Sie lehrt an der Pädagogischen Hochschule, an der Universität Salzburg und an der Fachhochschule Salzburg in der Bereichen Pädagogik, Psychologie und Mathematik und unterrichtet an diversen Akademien und Instituten. Ihre Forschungsinteressen liegen vor allem im Bereich Problemlösen, Entscheidungsstrategien und Kombinatorik.
Vorwort zur 2. Auflage 5
Vorwort zur 1. Auflage 6
Inhaltsverzeichnis 7
1: Einleitung und Gliederung 13
1.1 Überlegungen und Aufbau 14
Literatur 17
2: Definitionen 18
2.1 Was ist ein Problem? 18
2.2 Was bedeutet Problemlösekompetenz? 21
2.3 Gibt es verschiedene Problemtypen? 23
2.3.1 Analytische Probleme 25
2.3.2 Synthetische Probleme 26
2.3.3 Dialektische Probleme 27
2.4 Der Prozess des Problemlösens 28
2.4.1 Verstehen der Aufgabe 29
2.4.2 Ausdenken eines Plans 29
2.4.3 Ausführen des Plans 30
2.4.4 Rückschau 30
2.5 Problemlösestrategien (Heuristiken) 31
2.5.1 Heuristische Hilfsmittel 34
2.5.1.1 Informative Figuren 34
2.5.1.2 Tabellen 34
2.5.1.3 Wissensspeicher 35
2.5.1.4 Lösungsgraphen 36
2.5.1.5 Gleichungen 36
2.5.2 Heuristische Prinzipien 37
2.5.2.1 Das Analogieprinzip 37
2.5.2.2 Das Rückführungsprinzip 38
2.5.2.3 Das Transformationsprinzip 38
2.5.2.4 Das Invarianzprinzip 38
2.5.2.5 Das Symmetrieprinzip 38
2.5.2.6 Das Extremalprinzip 39
2.5.2.7 Das Zerlegungsprinzip 39
2.5.2.8 Die Fallunterscheidung 39
2.5.2.9 Das Schubfachprinzip 39
2.5.3 Heuristische Strategien 40
2.5.3.1 Systematisches Probieren 40
2.5.3.2 Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten 40
2.5.3.3 Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes 42
2.5.3.4 Analogiebildung 42
2.5.3.5 Umstrukturieren eines Problems 42
2.6 Zusammenfassung 43
Literatur 43
3: Voraussetzungen erfolgreichen Problemlösenlernens 46
3.1 Übungseffekte 47
3.2 Problemisomorphe 47
3.3 Heuristiken anwenden und Transferleistungen erbringen können 47
3.4 Handlungsorientierter Unterricht 49
3.5 Training 52
3.6 Persönlichkeit und Problemlösekompetenz 53
3.7 Intelligenz und Problemlösekompetenz 54
3.8 Expertise und Problemlösekompetenz 55
3.9 Motivation, Emotion und Problemlösekompetenz 55
3.10 Planungsfähigkeit und Problemlösekompetenz 59
3.11 Hintergrundmerkmale und Problemlösekompetenz 60
3.12 Zusammenfassung 61
3.13 Storyboard 61
3.14 Abgeleitete Fragestellungen 62
3.15 Überlegungen zu den Forschungsfragen 63
3.16 Abgeleitete Modelle zu den Einflussgrößen 66
3.17 Abgeleitete Modelle zur Strategienutzung 68
Literatur 69
4: Die Problemlösekompetenzen der österreichischen Schüler 77
4.1 Die Erhebung von Problemlösekompetenzen in Large Scale Assessments 78
4.2 Allgemeine Informationen zur PISA-Studie 79
4.3 Die PISA-Problemlöseaufgaben 80
4.3.1 Beispiel 1 – Anschlusszüge 80
4.3.2 Beispiel 2 – Bewässerung 80
4.3.3 Beispiel 3 – Ferienlager 80
4.3.4 Beispiel 4 – Bibliothekensystem 80
4.4 Allgemeines zur Auswertung und Interpretation der PISA-Daten 83
4.4.1 Metrik 83
4.4.2 Zuteilung zu den Kompetenzstufen 86
4.4.2.1 Level 1 88
4.4.2.2 Level 2 89
4.4.2.3 Level 3 89
4.4.2.4 Level 4 91
4.4.2.5 Level 5 91
4.4.2.6 Level 6 92
4.4.3 Die Gewichtung bei PISA 92
4.4.4 Die Plausible Values bei PISA 95
4.4.5 Die Standardfehlerberechnung bei PISA 95
4.5 Die Problemlösekompetenzen der österreichischen Schüler im Ländervergleich 97
4.6 Die Verteilung der Schüler auf die Kompetenzstufen im Ländervergleich 98
4.7 Geschlechtsunterschiede im Problemlösen 99
4.8 Sozioökonomischer Hintergrund und Problemlösekompetenzen 100
4.8.1 Operationalisierung der Variablen 101
4.8.1.1 Elternbildung 101
4.8.1.2 Anzahl der Bücher zu Hause 101
4.8.1.3 Lernressourcen zu Hause 101
4.8.1.4 Wohlstand 102
4.8.1.5 Häusliche Besitztümer 102
4.8.2 Analysen 102
4.8.3 Ergebnisse 104
4.9 Emotionale Faktoren (Selbstkonzept, Motivation …) und Problemlösekompetenzen 105
4.9.1 Operationalisierung der Variablen 106
4.9.1.1 Mathematics Behaviour 106
4.9.1.2 Mathematics Self-Efficacy (Selbstwirksamkeit in Mathematik) 106
4.9.1.3 Mathematics Intentions (Präferenzen für Mathematik) 107
4.9.1.4 Mathematics Work Ethic (Arbeitsmoral in Mathematik) 107
4.9.1.5 Openness for Problem Solving (Offenheit für Problemfragestellungen) 107
4.9.1.6 Mathematics Self-Concept (Selbstkonzept in Mathematik) 108
4.9.1.7 Mathematics Interest (Interesse an Mathematik) 108
4.9.1.8 Subjective Norms in Mathematics (subjektive Normen in Mathematik) 109
4.9.2 Analysen 109
4.9.3 Ergebnisse 110
4.9.3.1 Item- und Skalenanalysen 110
4.9.3.2 Inhaltliche Analysen 111
4.10 Kombinationen aus Hintergrundmerkmalen und Persönlichkeitsmerkmalen 114
4.11 Zusammenfassung 116
Literatur 118
5: IQ und EQ – ist der Mix entscheidend und macht der Problemtyp einen Unterschied? 119
5.1 Allgemeines 120
5.2 Erhobene Konstrukte 120
5.2.1 Emotionale Selbstwirksamkeit 121
5.2.2 Allgemeine Selbstwirksamkeit 122
5.2.3 Proaktive Einstellung 122
5.2.4 Coping 122
5.2.5 Selbstregulation 123
5.2.6 Intelligenz 123
5.2.7 Problemlösekompetenz 124
5.3 Analysen 124
5.4 Ergebnisse 125
5.4.1 Skaleninformationen 125
5.4.2 Inhaltliche Analysen 125
5.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 131
Literatur 132
6: Kombinatorik und Problemlösen? 133
6.1 Was ist Kombinatorik? 134
6.1.1 Allgemeines Zählprinzip 135
6.1.2 Permutation ohne Wiederholung 136
6.1.3 Permutation mit Wiederholung 136
6.1.4 Variation ohne Wiederholung 137
6.1.5 Variation mit Wiederholung 138
6.1.6 Kombination ohne Wiederholung 139
6.1.7 Kombination mit Wiederholung 139
6.2 Kombinatorik zum Problemlösenlernen? 140
6.2.1 Lösungen mit Baumdiagrammen (Skizzen) 141
6.2.2 Lösungen mit Gleichungen 141
6.2.3 Lösungen mit Lösungsgraphen 141
6.2.4 Lösungen mithilfe von Tabellen 142
6.3 Wahrscheinlichkeiten und Kombinatorik 144
6.4 Zusammenfassung 144
Literatur 145
7: Einflussfaktoren auf die Leistung in Kombinatorik 146
7.1 Allgemeines 147
7.2 Operationalisierung der Konstrukte 147
7.2.1 Sozialer Hintergrund 147
7.2.2 Mathematische Fähigkeiten 147
7.2.3 Mathematisches Interesse 148
7.2.4 Note in Mathematik 148
7.2.5 Lesekompetenz 148
7.2.6 Intelligenz 148
7.2.7 Kombinatorikfähigkeiten 148
7.2.7.1 Aufgabe zur Kombination 148
7.2.7.2 Aufgabe zum allgemeinen Zählprinzip 148
7.2.7.3 Aufgabe zur Permutation 149
7.2.7.4 Aufgabe zum synthetischen Problemlösen 150
7.3 Analysen 150
7.4 Ergebnisse 152
7.5 Zusammenfassung 157
Literatur 157
8: Strategien zur Lösung von Kombinatorikaufgaben 158
8.1 Allgemeines 158
8.2 Operationalisierung der Strategien 160
8.3 Vorgegebene Aufgaben 161
8.4 Analysen 162
8.5 Ergebnisse 163
8.5.1 Kombination und Variation mit den Eiskugeln 163
8.5.2 Variation und Kombination mit den Autos 165
8.5.3 Permutation mit den Tieren (3 und 4 Elemente) 166
8.5.4 Vergleich Papier-Bleistift-Lösungen vs. Einzelsetting mit Materialien 168
8.6 Exkurs: Lösungsstrategien bei Erwachsenen 168
8.6.1 Kombination und Variation mit den Eiskugeln (Erwachsene) 169
8.6.2 Kombination mit den Autos (Erwachsene) 171
8.6.3 Permutation mit den Tieren (3 und 4 Elemente) 171
8.7 Vergleich Lösungshäufigkeiten und Strategien 172
8.8 Zusammenfassung 174
Literatur 175
9: Wie kann man die Kombinatorikleistung verbessern? 176
9.1 Allgemeines 177
9.2 Analysen 179
9.3 Ergebnisse 179
9.3.1 Voranalysen 179
9.3.1.1 ICC 179
9.3.1.2 Kombinatorikleistung vor der Intervention 179
9.3.2 Leistungszuwachs 180
9.3.2.1 Handlungsorientierter Unterricht 180
9.3.2.2 Arbeitsblattunterricht 181
9.3.3 Tiefergehende Analysen 181
9.3.3.1 Interaktionen 181
9.3.3.2 Geschlecht und Leistungsverbesserung 182
9.3.3.3 Alter und Leistungsverbesserung 182
9.3.3.4 Sozioökonomischer Hintergrund und Leistungsverbesserung 183
9.3.3.5 Mathematische Fähigkeiten und Leistungsverbesserung 183
9.3.3.6 Mathematisches Interesse und Leistungsverbesserung 183
9.4 Zusammenfassung 184
Literatur 184
10: Stochastische Fähigkeiten bei Spitzenschülern im Grundschulalter 185
10.1 Allgemeines 185
10.2 Analysen 186
10.3 Ergebnisse 186
10.4 Zusammenfassung 187
11: Spielen und dabei Problemlösen lernen? Spiele zur Förderung von Problemlösekompetenzen 188
11.1 Allgemeines 188
11.2 Brettspiele zur Kompetenzerweiterung im Bereich Problemlösen 189
11.2.1 Uluru 189
11.2.1.1 Kurzbeschreibung des Brettspiels „Uluru“ 189
11.2.1.2 Beispiel 190
11.2.1.3 Zusatzinformationen 191
11.2.1.4 Problemlöseanspruch 191
11.2.2 Dimension 191
11.2.2.1 Kurzbeschreibung 192
11.2.2.2 Zusatzinformationen 193
11.2.2.3 Problemlöseanspruch 193
11.2.3 Der bunte Hund 193
11.2.3.1 Kurzbeschreibung 195
11.2.3.2 Beispiel 195
11.2.3.3 Zusatzinformationen 195
11.2.3.4 Problemlöseanspruch 195
11.2.4 Corona 195
11.2.4.1 Kurzbeschreibung 196
11.2.4.2 Beispiel 196
11.2.4.3 Zusatzinformationen 198
11.2.4.4 Problemlöseanspruch 198
11.2.5 Scotland Yard (Master) 198
11.2.5.1 Kurzbeschreibung 199
11.2.5.2 Beispiel 200
11.2.5.3 Zusatzinformationen 201
11.2.5.4 Problemlöseanspruch 201
11.2.6 Rush Hour 201
11.2.6.1 Kurzbeschreibung 202
11.2.6.2 Beispiel 202
11.2.6.3 Zusatzinformationen 202
11.2.6.4 Problemlöseanspruch 203
11.2.7 Master Mind 203
11.2.7.1 Kurzbeschreibung 203
11.2.7.2 Beispiel 204
11.2.7.3 Zusatzinformationen 205
11.2.7.4 Problemlöseanspruch 205
11.2.8 Big Band 205
11.2.8.1 Kurzbeschreibung 205
11.2.8.2 Beispiel 206
11.2.8.3 Zusatzinformationen 208
11.2.8.4 Problemlöseanspruch 208
11.2.9 Pinguintanz 209
11.2.9.1 Kurzbeschreibung 209
11.2.9.2 Beispiel 210
11.2.9.3 Zusatzinformationen 210
11.2.9.4 Problemlöseanspruch 210
11.2.10 Allein im Drachenlabyrinth 211
11.2.10.1 Kurzbeschreibung 211
11.2.10.2 Zusatzinformationen 211
11.2.10.3 Problemlöseanspruch 212
11.2.11 Tatort Nachtexpress 212
11.2.11.1 Kurzbeschreibung 212
11.2.11.2 Beispiel 213
11.2.11.3 Zusatzinformationen 213
11.2.11.4 Problemlöseanspruch 213
11.2.12 EXIT 214
11.2.12.1 Kurzbeschreibung 214
11.2.12.2 Beispiel 214
11.2.12.3 Zusatzinformationen 214
11.2.12.4 Problemlöseanspruch 215
11.2.13 Metro Ville 215
11.2.13.1 Kurzbeschreibung 216
11.2.13.2 Beispiel 216
11.2.13.3 Zusatzinformationen 217
11.2.13.4 Problemlöseanspruch 217
11.2.14 Captain Sonar 217
11.2.14.1 Kurzbeschreibung 217
11.2.14.2 Beispiel 219
11.2.14.3 Zusatzinformationen 219
11.2.14.4 Problemlöseanspruch 220
11.2.15 Robo Rally 220
11.2.15.1 Kurzbeschreibung 220
11.2.15.2 Beispiel 222
11.2.15.3 Zusatzinformationen 223
11.2.15.4 Problemlöseanspruch 223
11.2.16 Wave Breaker 223
11.2.16.1 Kurzbeschreibung 224
11.2.16.2 Beispiel 224
11.2.16.3 Zusatzinformationen 224
11.2.16.4 Problemlöseanspruch 224
11.2.17 Onitama 225
11.2.17.1 Kurzbeschreibung 227
11.2.17.2 Beispiel 227
11.2.17.3 Zusatzinformationen 227
11.2.17.4 Problemlöseanspruch 227
11.2.18 Weitere Spiele zum Problemlösenlernen 227
11.2.18.1 Room Escape Games 227
11.2.18.2 Black Stories 229
11.3 Zusammenfassung 229
Literatur 229
12: Handlungsorientierte Kombinatorikaufgaben für den Unterricht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I 231
12.1 Allgemeines 231
12.2 Problemlöseaufgaben aus der Kombinatorik für den Unterricht 232
12.2.1 Bälle in Schachteln sortieren 232
12.2.2 Stifte im Federpennal 232
12.2.3 Autos 233
12.2.4 Haus mit Lift und Treppen 233
12.2.5 Restaurant 234
12.2.6 Test 234
12.2.7 Schüler kommen in die Klasse 235
12.2.8 Tresor 235
12.2.9 Licht 236
12.2.10 Badematten 236
12.2.11 Skilager 237
12.2.12 Snowboarden 237
12.2.13 Spielplatz 238
12.2.14 M& Ms
12.2.15 Zug 239
12.2.16 Auto 239
12.2.17 Fototermin 240
Literatur 240
13: Zusammenfassung und Resümee 241
13.1 Zu den Hintergrundvariablen 247
13.2 Zu den Persönlichkeitsvariablen und zur Kognition 249
13.3 Zu den kombinierten Merkmalen 251
13.4 Weitere interessante Ergebnisse 252
Literatur 253
14: Ein neues dynamisches Modell zum Problemlösen/Ausblick 256
14.1 Vorschlag für ein dynamisches Modell 256
14.2 Ausblick 260
| Erscheint lt. Verlag | 11.11.2019 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XIV, 256 S. 175 Abb., 136 Abb. in Farbe. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Erwachsenenbildung | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Projektmanagement | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Wirtschaftsinformatik | |
| Schlagworte | combinatorics • Handlungsorientierter Unterricht • Heurismen • Kombinatorik • Learning and Instruction • Problemlösekompetenz • Problemlösen |
| ISBN-10 | 3-658-26804-2 / 3658268042 |
| ISBN-13 | 978-3-658-26804-6 / 9783658268046 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 13,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich