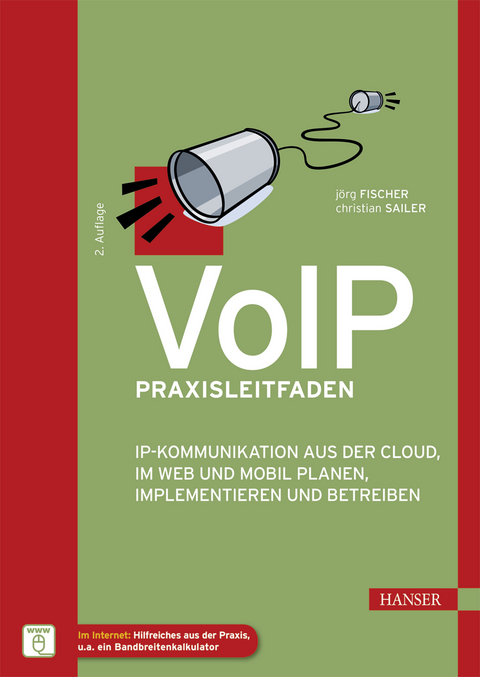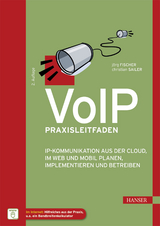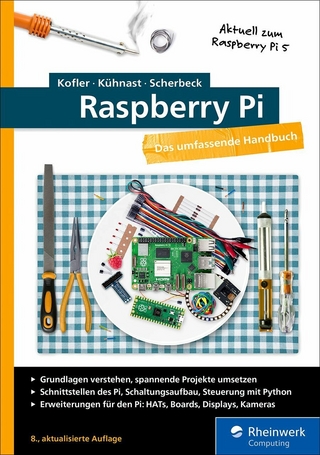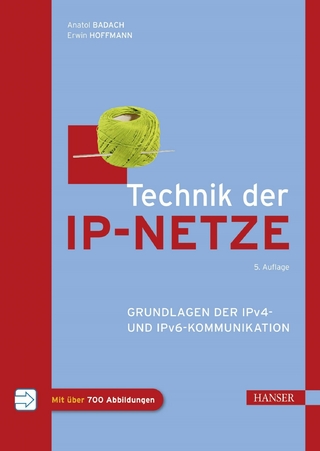VoIP Praxisleitfaden (eBook)
543 Seiten
Hanser, Carl (Verlag)
978-3-446-44814-8 (ISBN)
Dieser Praxisleitfaden vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick über die praxisrelevanten Aspekte von VoIP-Lösungen: von der Infrastruktur über Nummern, Namen, Adressen und Protokolle, VoIP-Architekturen und Applikationen bis hin zu Sicherheitsaspekten sowie Gedanken bezüglich des Betriebes, der Betriebsmodelle, Fehlerbehebung, VoIP-Analyse und Dokumentation.
Weit mehr als nur Sprache über das IP-Netz
- Optimaler Begleiter bei der Umsetzung von VoIP-Projekten
- Umfasst Sprach-, Daten- und Videokommunikation
- Deckt die praktischen Aspekte aus allen VoIP-Bereichen ab, von Applikation bis Zuverlässigkeit
VoIP umfasst eine Vielzahl von Kommunikationsdiensten und -anwendungen für Sprache, Daten und Video. So bietet VoIP den Anwendern einerseits einen völlig neuen Kommunikationskomfort sowie viele Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz und Effektivität im Kommunikationsalltag.
Dr. Jörg Fischer beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit dem Design, der Implementierung und dem Betrieb von VoIP-Umgebungen und IP-Kommunikationsnetzen. Er ist bei Alcatel-Lucent verantwortlich für den Bereich Beratung und Vertrieb von professionellen Kommunikationslösungen und -diensten.Christian Sailer führt als Domain Specialist Voice & UCC bei Alcatel-Lucent beratende Tätigkeiten in Form von Problemanalysen, Darstellung von Lösungskonzepten und Bewertung von ITK-Lösungen durch. Die Portfolio Außen-Darstellung erfolgt durch ihn auf Basis von Vorträgen auf Fachmessen, Webinaren, Seminaren und Publikationen in der Fachpresse. Zudem steht die Erstellung von Wettbewerbsanalysen und der Themenbereich Market-Intelligence im Fokus.
Inhalt 6
Vorwort 18
1 Einleitung 24
1.1 Telefonie im Sinne dieses Buchs 24
1.2 Das Phänomen der menschlichen Sprache 25
1.2.1 Am Anfang steht die Signalisierung 25
1.2.2 Sprechen sie dieselbe Sprache? 25
1.2.3 Gut gebrüllt, „Löwe“! 26
1.3 „Echtzeit“-Kommunikation 27
1.4 Fernmeldetechnik – gestern und heute 28
1.4.1 Wer war der Erfinder der Telefonie? 28
1.4.2 Alles hat seinen Preis 29
1.4.3 Telefonie wird zur Privatsache 29
1.5 Thesen zu VoIP – worum geht es den Benutzern? 30
1.5.1 THESE 1: Effektivität (Zeit) und Effizienz (Geld) 30
1.5.2 THESE 2: die fünf „S“ der Benutzererwartungen 31
1.5.3 THESE 3: Profile für Prozesse, Dienste und Benutzer 32
1.5.4 THESE 4: intelligente Büroumgebungen 34
1.5.5 THESE 5: IP-Transformation der Kommunikation 35
1.5.6 THESE 6: Konvergenz der Kommunikation und „Cloud“ 35
1.5.7 THESE 7: Paradigmenwechsel 37
1.6 VoIP wird Realität 37
1.6.1 IP-fähige Telekommunikation 37
1.6.2 Telefonierendes IP 38
1.6.3 Der lange Weg von der PBX zum SoftSwitch und zur Cloud 38
1.7 Die Businesstreiber für VoIP 39
1.8 Die IP-Transformation der Sprache 41
1.8.1 Wozu braucht man eine ganzheitliche Betrachtung? 41
1.8.2 Das Modell der IP-Transformation 42
1.9 VoIP im praktischen Einsatz 52
1.9.1 Einsatzgebiete für VoIP 53
1.9.2 Ist VoIP billiger als klassische Telefonie? 55
1.10 VoIP und das OSI-Modell 56
1.10.1 Die Bedeutung von TCP und IP für VoIP 57
1.10.2 Geht Sprache auch auf Schicht zwei? 59
1.10.3 VoIP und das ISO/OSI-Modell 60
1.11 Essenz 63
2 Infrastrukturen im VoIP-Umfeld 66
2.1 Was gehört zur Infrastruktur? 66
2.2 Kabel, Leitungen und Drähte 67
2.2.1 Klassische Telefonkabel 68
2.2.2 Kabelkategorien 69
2.2.3 Verdrillung der Adernpaare 72
2.2.4 Schirmung der Adernpaare und der Kabel 73
2.2.5 Erdung und/oder Schirmung 74
2.2.6 Verkabelungsarten und Längenbeschränkungen 76
2.2.7 Lichtwellenleiter (LWL) 78
2.3 Kabel- und Leitungsarchitekturen 79
2.3.1 Ringförmige Verkabelungsarchitekturen 79
2.3.2 Sternförmige Verkabelungsarchitekturen 80
2.3.3 Strukturierte Verkabelungsarchitekturen 81
2.3.4 Redundante Verkabelungsarchitekturen 82
2.4 Endgeräte für die Kommunikation 83
2.4.1 Akustikdesign der TEG 84
2.4.2 Das Telefonendgerät (TEG) 84
2.4.3 Anschaltung bei klassischer Telefonie 85
2.4.4 IP-Endgeräte/-Telefone (IP-TEG) 87
2.5 Anschlüsse für Verkabelungssysteme 89
2.5.1 Stecker und Buchsen 89
2.5.2 Auflegeverfahren 92
2.6 Stromversorgung 93
2.6.1 Power over Ethernet 93
2.6.2 Zusätzlicher Betriebsstrom an den Komponenten 96
2.6.3 Zusätzlicher Betriebsstrom für IP-TEG 97
2.6.4 Versorgung mit Notstrom 97
2.7 Die Luft als Infrastruktur 98
2.8 Kommunikation ohne Drähte, Leitungen und Kabel 99
2.9 Aktive Netzwerkkomponenten für VoIP 100
2.9.1 Anschlussvervielfacher – HUB 101
2.9.2 Anschlussverteiler – Switch 101
2.9.3 Kommunikationsflussverteiler – Router 103
2.9.4 Gateways 106
2.9.5 Firewalls 107
2.9.6 SBC – Session Border Controller 109
2.10 Essenz 109
3 Netze, QoS, Pakete und Bandbreite 112
3.1 Festnetze für VoIP 113
3.1.1 Geografische und funktionale Differenzierung 113
3.1.2 Technologische Differenzierung der Netze 114
3.1.3 IP-Netze 116
3.1.4 Breitbandnetze 120
3.2 Mobilnetze für VoIP 121
3.2.1 WLAN IEEE 802.11 und seine Komponenten 122
3.2.2 WLAN-Architekturen 123
3.2.3 Planung und Implementierung von WLANs 127
3.2.4 Voice over WLAN (VoWLAN) 129
3.2.5 Praktischer Einsatz von VoWLAN 133
3.3 Qualitätsanforderungen der Dienste (QoS) 136
3.3.1 Subjektive Güte der Sprache – ohne MOS nichts los 136
3.3.2 Die Kodierung der Sprache 138
3.4 Parameter der QoS im VoIP-Umfeld 140
3.4.1 Laufzeit, Laufzeitschwankungen und Paketverluste 140
3.4.2 Die IP-Paketgröße für Sprachdaten 143
3.4.3 Paketmarkierungen für VoIP 144
3.5 IP-Pakete im VoIP-Umfeld 147
3.5.1 UDP und TCP 147
3.5.2 IPSec – IP Security 148
3.5.3 Die Paketstruktur im VPN-Tunnel 150
3.5.4 RTP – Real-Time Transport Protocol 151
3.5.5 RTCP – Real Time Control Protocol 152
3.6 QoS für die Signalisierung 155
3.7 Bandbreite und Komprimierung 157
3.7.1 Was ist ERLANG? 157
3.7.2 Bandbreitenkalkulation für VoIP 158
3.7.3 Bandbreitenkalkulation für Fax und Modem over IP 159
3.7.4 Komprimierung 159
3.7.5 Bandbreitenbedarf der Signalisierung 160
3.8 Essenz 161
4 Nummern, Adressen und Namen 164
4.1 Nummern in der Telefonie 165
4.1.1 Das internationale Rufnummernformat E.164 165
4.1.2 Notruf- und andere Sondernummern 167
4.1.3 Der interne Rufnummernplan 168
4.1.4 Übersetzung zwischen internem und externem RNP 171
4.2 Adressen in der IP-Welt 172
4.3 Die MAC-Adresse 172
4.3.1 Aufbau der MAC-Adresse 173
4.3.2 Die Funktion der MAC-Adresse im VoIP-Umfeld 174
4.4 Die IP-Adresse 174
4.4.1 Struktur und Funktion der IP-Adressen 175
4.4.2 Vergabe der IP-Adressen 178
4.4.3 DHCP für VLAN-Zuordnung 180
4.4.4 Probleme mit DHCP 180
4.4.5 LLDP 182
4.4.6 VoIP und IP-Routing 182
4.5 Nummern und Namen im Telefonieumfeld 184
4.5.1 Mit Namen wählen 184
4.5.2 Das Telefonbuch 185
4.5.3 Verzeichnisdienst und Telefonbuch 186
4.6 Namen in der IP-Welt 189
4.6.1 DNS – der Namensdienst im IP 189
4.6.2 Suche im DNS 190
4.6.3 DNS im VoIP-Umfeld 191
4.7 ENUM – Nummern im Namenformat 192
4.8 Essenz 193
5 Protokolle und Dienste für VoIP 194
5.1 Protokolle der klassischen Telefonie 196
5.1.1 Protokolle und Dienste des ISDN 196
5.1.2 Digitale Anschlüsse zum ISDN und zu Teilnehmern 197
5.1.3 Standardprotokolle für die digitale Vernetzung 199
5.1.4 Herstellereigene Protokolle für die digitale Vernetzung 201
5.1.5 Protokolle und Dienste für analoge Kommunikation 201
5.2 Protokolle der IP-Telefonie 202
5.3 IP-Protokolle für Management und Konfiguration 203
5.3.1 Klassische, ungesicherte Managementprotokolle 204
5.3.2 Gesicherte Managementprotokolle 206
5.4 IP-Protokolle für die Steuerung und Signalisierung 207
5.4.1 H.323 zum Teilnehmer 208
5.4.2 H.323 zur Vernetzung 208
5.4.3 Weitere wichtige Steuerungs- und Signalisierungsprotokolle 209
5.5 Protokolle für VoIP-Medienübertragung 211
5.5.1 Protokolle für Sprache im VoIP-Umfeld 211
5.5.2 Protokolle für Fax- und Modemdienste 211
5.6 SIP – das IP-Protokoll für Multimedia und Mobilität 218
5.6.1 Wozu dient SIP? 219
5.6.2 Was unterscheidet SIP von anderen Protokollen? 219
5.6.3 Wie funktioniert SIP? 220
5.6.4 SIP als Protokoll zu den Endgeräten 223
5.6.5 SIP als Trunk-Anschluss (Private/Public) 225
5.6.6 SIP und Sicherheit 229
5.7 WebRTC – Echtzeitkommunikation Browser 232
5.7.1 Wozu dient WebRTC? 232
5.7.2 Was unterscheidet WebRTC von anderen Protokollen? 233
5.7.3 Wie funktioniert WebRTC? 234
5.7.4 Überwindung von Netzwerkbarrieren 237
5.7.5 Zusammenspiel von WebRTC und SIP 239
5.7.6 WebRTC und Sicherheit 240
5.8 Essenz 241
6 Leistungsmerkmale 242
6.1 Standardisierte Leistungsmerkmale 242
6.1.1 Leistungsmerkmale für die Teilnehmeridentifikation 243
6.1.2 Leistungsmerkmale für den Aufbau von Anrufen 251
6.1.3 Leistungsmerkmale während des Anrufs 256
6.1.4 Leistungsmerkmale für mehrere Teilnehmer 260
6.1.5 Weitere standardisierte Leistungsmerkmale 262
6.2 Nicht standardisierte Leistungsmerkmale 265
6.2.1 Spezielle Konferenzvarianten 266
6.2.2 Teamfunktionen 268
6.2.3 Chef/Sekretär-Funktionen 272
6.2.4 Präferenzfunktionen 273
6.2.5 ACD – Automatische Anrufverteilung 274
6.2.6 Vermittlungsplatz 277
6.2.7 DISA – Direct Inward System Access 279
6.3 Essenz 280
7 Ports, Kanäle und Bündel 282
7.1 Kanäle und Bündel 282
7.2 Ports in der IP-Welt 283
7.2.1 Einsatz der IP-Ports 283
7.2.2 „Well known“ IP-Ports 285
7.2.3 Standard-IP-Ports für VoIP 286
7.2.4 Dynamische IP-Ports 287
7.3 Essenz 288
8 Applikationen im VoIP-Umfeld 290
8.1 Applikationsschnittstellen und Funktionen 292
8.1.1 CSTA: „Computer sieht TelefonAnlage“ 292
8.1.2 TAPI – Telephony Application Programming Interface 293
8.1.3 XML – eXtensible Markup Language 294
8.1.4 SOAP – Simple Object Access Protocol 297
8.2 Anwendungen mit Kommunikationsfunktionen 298
8.2.1 CTI (Computer Telephony Integration) 299
8.2.2 Design einer CTI-Umgebung 302
8.3 UMS – Unified Messaging System 305
8.3.1 Nur noch einen „Briefkasten“ 305
8.3.2 Faxnachrichten 306
8.3.3 SMS-Nachrichten 308
8.3.4 Abhören und Lesen der Nachrichten im UMS 308
8.4 Präsenzinformationssysteme 310
8.4.1 Die Telefonpräsenz 311
8.4.2 Das Präsenzsystem 311
8.5 Sprach-Konferenzsysteme 312
8.5.1 Konferenzvarianten 312
8.5.2 VoIP und Konferenzfunktionen 313
8.6 Webkonferenzsysteme 314
8.6.1 Das Prinzip der Webkonferenzen 314
8.6.2 Die Funktionsweise von Webkonferenzen 315
8.6.3 Praktischer Einsatz von Webkonferenzen 315
8.7 Kollaborationsapplikationen 316
8.8 Alarmierungs- und Evakuierungssysteme 318
8.8.1 Alarmierung 318
8.8.2 Automatische Mitteilungsverteilungen 319
8.8.3 Evakuation 320
8.9 Notruf im VoIP-Umfeld 321
8.9.1 Rechtliche und regulatorische Aspekte des Notrufs 321
8.9.2 Notruf und Standortinformationen 321
8.9.3 Anruferlokalisierung auf Basis von E911 322
8.9.4 Technologische Aspekte des Notrufs im VoIP-Umfeld 322
8.10 Die Vermittlung 323
8.10.1 Das Fräulein vom Amt 324
8.10.2 Der moderne Vermittlungsplatz 324
8.10.3 Die automatische Vermittlung 325
8.10.4 Persönlicher Assistent 325
8.10.5 Routing-Profile 326
8.11 Anwendungen für die Kundeninteraktion 327
8.11.1 Von der Vermittlung zum CallCenter 327
8.11.2 Das moderne CallCenter 327
8.11.3 Vorteile von VoIP-CallCentern 328
8.11.4 Multimediale CallCenter 329
8.11.5 Interne Interaktion 329
8.11.6 Vom KIZ zum „Business Process Routing“ 330
8.12 Essenz 331
9 Klassische VoIP-Architekturen 332
9.1 Als die Telekommunikationssysteme VoIP „lernten“ 332
9.1.1 Auf dem Weg zur VoIP-Architektur 332
9.1.2 Neu oder Migration? 332
9.1.3 Von der PBX zur IP-PCX 333
9.1.4 Von der IP-PCX zur VoIP-PCX 334
9.1.5 Von IP-enabled zu hybrid 336
9.1.6 Was ist besser: hybrid oder reines VoIP? 337
9.1.7 Von der VoIP-PCX zu Soft-VoIP 338
9.1.8 Zentral oder dezentral? 342
9.2 Komponenten von VoIP-Systemen 343
9.2.1 Die Steuereinheit 344
9.2.2 Redundanz der Steuerungen 346
9.2.3 Das Koppelfeld 348
9.2.4 VoIP-Mediagateways 349
9.2.5 Module für Sonderfunktionen 350
9.3 Sonderarchitekturen und Trends 350
9.3.1 Virtuelle Maschinen und Container-Virtualisierung 350
9.3.2 Offene VoIP-Systeme – „Open Source“-Lösungen 351
9.3.3 Ich gebe dir was und du gibst mir was 351
9.4 Essenz 352
10 VoIP-Cloud-Modelle 354
10.1 Grundsätzliches zum Thema Cloud 354
10.1.1 Akteure im Cloud-Umfeld 354
10.1.2 Von der VoIP-PCX zum CaaS CSP 355
10.1.3 Begriffsbestimmung „Cloud-Service“ 357
10.1.4 VoIP-Cloud-Modelle vs. klassische VoIP-Architekturen 357
10.1.5 Server-Virtualisierung als Grundlage von CaaS 359
10.1.6 Charakteristika von Cloud-Services 360
10.2 Cloud-Liefer- und -Servicemodelle 362
10.2.1 Cloud-Liefermodelle 363
10.2.2 Cloud-Servicemodelle 366
10.3 Communication as a Service 371
10.3.1 Chancen und Risiken 371
10.3.2 Die TK/IT-Abteilung im Wandel 379
10.3.3 Qualitätssicherung 380
10.3.4 Methode für eine erfolgreiche CaaS-Transformation 381
10.3.5 Exemplarische Darstellung einer CaaS-Architektur 383
10.4 Ökonomische Aspekte eines CaaS 385
10.4.1 Kostenblöcke eines CaaS-Servicemodells 386
10.4.2 Kostenvorteile eines CaaS-Servicemodells 387
10.4.3 Klassische- und Cloud-Lizenzmodelle im Vergleich 389
10.4.4 TCO-Betrachtung 389
10.4.5 ROI-Betrachtung 391
10.5 Essenz 392
11 Managementsysteme für VoIP 394
11.1 Die Managementpyramide 394
11.1.1 Ebene der Basismanagement-Anwendungen 396
11.1.2 Ebene des Applikationsmanagements 397
11.1.3 Ebene des allgemeinen Netzwerkmanagements 398
11.1.4 Ebene des zentralen Ressourcenmanagements 399
11.1.5 Ebene des übergreifenden Dienstmanagements 400
11.2 Anlagenbezogenes Basismanagement 401
11.2.1 Die Managementzentrale der VoIP-Anlage 402
11.2.2 Anlagenbezogenes Elementmanagement 402
11.2.3 Elementares Ressourcenmanagement 403
11.2.4 Nutzermanagement auf der Anlagenebene 404
11.2.5 Fehler- und Alarmmanagement 407
11.2.6 Anlagenbezogenes Berechtigungsmanagement 408
11.3 Management der VoIP-Funktionen 410
11.3.1 Das QoS-Management auf dem VoIP-System 411
11.3.2 Das QoS-Management im IP-Netz 412
11.3.3 Management der DSPs und Codecs 412
11.3.4 Administration von VoIP-Domains 413
11.3.5 VoIP-Statistiken 416
11.4 SNMP im VoIP-Umfeld 417
11.5 Management zentraler VoIP-Ressourcen und -dienste 418
11.6 Performancemanagement 419
11.7 Essenz 421
12 Sicherheit, Gefahren, Risiken 422
12.1 Das Verständnis für Sicherheit 422
12.2 Sicherheit 423
12.2.1 Das Gefühl von Sicherheit 423
12.2.2 Gefahren kennen und erkennen 423
12.2.3 Die Technik ist nur das Mittel 424
12.2.4 Drei Sicherheitsbereiche 424
12.3 Risiko 425
12.4 Gefahr 426
12.5 Bedrohung 427
12.6 Warum Sicherheit für VoIP? 428
12.6.1 BASELer Beschlüsse 429
12.6.2 Kontroll- und Transparenzgesetz 429
12.7 IT-Grundschutzkatalog 430
12.8 BSI – VoIPSec-Studie 431
12.8.1 Zu Grundlagen und Protokollen von VoIP 432
12.8.2 Zur Medienübertragung in VoIP 434
12.8.3 Zum VoIP-Routing – Wegefindung 435
12.8.4 Zum Routing – Wegefindung der Namen und Nummern 436
12.8.5 Zur Kodierung des VoIP-Stroms 437
12.8.6 Angriffspotenzial auf und im IP-Netz 439
12.9 Essenz 439
13 VoIP – aber mit Sicherheit 440
13.1 VoIP-Sicherheit – für was und für wen? 440
13.2 Bedrohungen der Vertraulichkeit 441
13.2.1 Nutzersicherheit 441
13.2.2 Administratorsicherheit 441
13.2.3 Absicherung für das Systemmanagement 444
13.3 Bedrohungen gegen die Integrität 447
13.3.1 Tunnelbildung 447
13.3.2 Verschlüsselung 448
13.4 Bedrohungen gegen die Verfügbarkeit 449
13.5 Authentisierung 450
13.5.1 Unberechtigte Personen 450
13.5.2 Authentisierung 802.1x 451
13.6 Sicherheitsfunktionen im VoIP-System 452
13.6.1 Trusted Host 453
13.6.2 TCP-Wrapper 453
13.6.3 ICMP Redirect 454
13.7 Zugangssicherheit im IP-Netz 454
13.7.1 „Lernende“ IP-Anschlusssicherheit (learned port security) 455
13.7.2 DHCP-Schutz 456
13.7.3 Zugangskontrolllisten – ACLs (access control lists) 456
13.8 Essenz 457
14 Betrieb und Zuverlässigkeit 458
14.1 Gesicherter Betrieb 458
14.2 Zuverlässigkeit und Ausfallzeit 458
14.2.1 Ausfallzeit 459
14.2.2 Zuverlässigkeit 459
14.2.3 Verfahren zur Zuverlässigkeitsbetrachtung 461
14.2.4 Berechnung der Zuverlässigkeit 462
14.2.5 Bewertung der Zuverlässigkeit eines Gesamtsystems 464
14.3 Betriebsdauer und Lebenszyklus 464
14.3.1 Softwarelebenszyklus 465
14.3.2 Hardwarelebenszyklus 466
14.4 Betriebsmodelle 467
14.4.1 OUT-Tasking und -Sourcing 467
14.4.2 Managed Communication Services 468
14.5 Essenz 468
15 Fehler- und Störungsbeseitigung 470
15.1 Ziele der Fehleranalyse und Störungsbeseitigung 470
15.1.1 Schnelligkeit ist keine Hexerei 471
15.1.2 Fehler erkannt – Gefahr gebannt! 471
15.1.3 Verhindern der Fehlerausbreitung 473
15.1.4 Ein guter Plan A hat immer einen besseren Plan B 474
15.1.5 Prävention – denn Vorbeugen ist besser als Heilen 475
15.1.6 Aus Schaden wird man klug 476
15.1.7 Wer schreibt, der bleibt 477
15.2 Fehler und Störungsbilder im VoIP-Umfeld 478
15.3 Das Telefon geht nicht 480
15.3.1 Steckt der Fehler in der Physik? 480
15.3.2 Steckt der Fehler im System? 482
15.4 Die Verbindung klappt nicht 483
15.5 Die Sprachqualität bei VoIP ist schlecht 484
15.5.1 Kriterien für die Sprachqualität 485
15.5.2 Schwankende und wechselnde Gesprächsqualität 485
15.5.3 Die Lautstärke ist ungenügend oder unpassend 486
15.5.4 Störende Echos und Hall während der Verbindung 489
15.5.5 Verstümmelte und bruchstückhafte Kommunikation 491
15.6 Essenz 493
16 VoIP-Analyse 494
16.1 Ziel und Methode der VoIP-Analyse 494
16.1.1 Ziele der VoIP-Analyse 494
16.1.2 Bestandteile der VoIP-Analyse 495
16.2 Gemessene QoS-Werte der VoIP-Analyse 496
16.3 MOS-Wert bei der VoIP-Analyse 497
16.4 Berechnung des MOS-Werts mittels E-Modell 497
16.4.1 Entwicklung und Ziel des E-Modells 497
16.4.2 Aufbau und Struktur des E-Modells 498
16.4.3 Parameter des E-Modells und deren Standardwerte 503
16.4.4 Der R-Faktor 504
16.4.5 Die Berechnung des R-Faktors 505
16.5 Werkzeuge für VoIP-Analysen 506
16.6 Durchführung der VoIP-Analyse 507
16.6.1 Planung der VoIP-Analyse 508
16.6.2 Konfiguration der VoIP-Analyse 511
16.6.3 Auswertung der VoIP-Analyse 517
16.6.4 Hilfreiche Sonderfunktionen 520
16.7 Essenz 523
Verzeichnis der Abkürzungen 524
Literatur 536
Index 538
| Erscheint lt. Verlag | 6.6.2016 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Informatik ► Netzwerke |
| Schlagworte | IP-Netze • IP-Telefonie • Voice Over IP • VoIP |
| ISBN-10 | 3-446-44814-4 / 3446448144 |
| ISBN-13 | 978-3-446-44814-8 / 9783446448148 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 20,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich