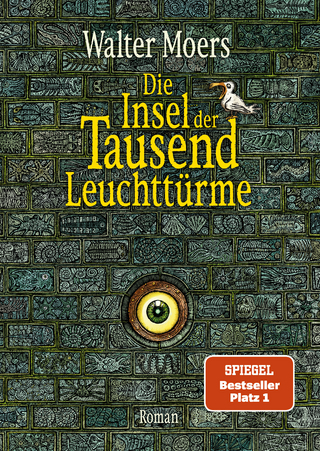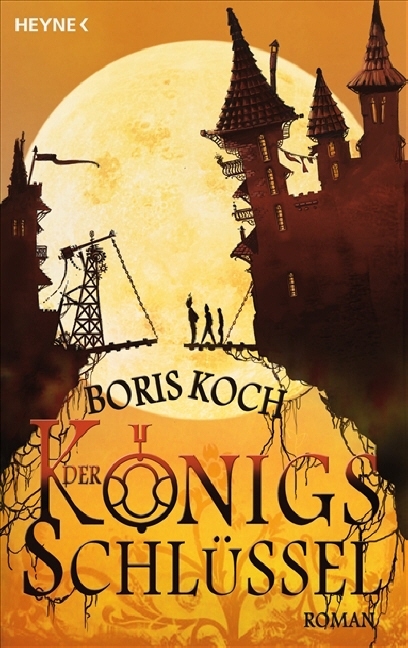
Der Königsschlüssel
Heyne, W (Verlag)
978-3-453-52534-4 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen, Neuauflage unbestimmt
- Artikel merken
Es ist der Tag des Königs. Der Tag, an dem der Herrscher mit dem Schlüssel aufgezogen wird, um für ein weiteres Jahr regieren zu können. Da geschieht das Unfassbare: Vor den Augen des versammelten Volks stürzen dunkle Vögel vom Himmel herab und stehlen den Königsschlüssel. Fortan steht der König still. Als man den Schlüsselbauer für die Tat verantwortlich macht und ihn in den Kerker wirft, macht sich seine Tochter auf, den wahren Schuldigen zu finden. Es wird eine Reise, die das Mädchen und ihr Land für immer verändern wird.
Boris Koch, Jahrgang 1973, wuchs auf dem Land südlich von Augsburg auf, studierte Alte Geschichte und Neuere Deutsche Literatur in München und lebt heute als freier Autor in Berlin. Er ist Mitveranstalter der phantastischen Lesereihe "Das StirnhirnhinterZimmer" und Redakteur des Magazins "Mephisto". Zu seinen Buchveröffentlichungen gehören „Der Drachenflüsterer“, die Fantasy-Parodie "Die Anderen" und der mit dem Hansjörg-Martin-Preis ausgezeichnete Jugendkrimi "Feuer im Blut" sowie der Shadowrun-Roman "Der Schattenlehrling".
Die frisch gewaschenen Banner des Mechanischen Königs flatterten im Frühlingswind über den beiden Türmen des Stadttors. Die Doppeldeckerkutsche der Nordlinie hielt an der Überlandstation direkt davor. Verschwitzte und mit Staub bedeckte Fahrgäste kletterten heraus, streckten sich und blinzelten in die Sonne. Sie alle waren nach Marinth gekommen, um der Schlüsselzeremonie und dem Turnier beizuwohnen. Vela, die oben am Fenster gesessen hatte, verließ die Kutsche als Letzte. Sie warf sich den verschlissenen Rucksack ihres Großvaters über die Schulter und kickte die Kutschentür schwungvoll zu. »Hey! Pass doch auf, du Rotzgöre!«, motzte der Kutscher, aber Vela achtete nicht auf ihn. Tief sog sie die frische Luft ein und atmete erleichtert durch. Weshalb in Linienkutschen so oft ein scharfer Zwiebel-Bohnen-Eintopf an die Reisenden verteilt wurde, würde sie nie verstehen. Gemächlich folgte sie den anderen Leuten in die Stadt. Gleich hinter dem Tor begann der jährliche Schlüsselmarkt; bunte Stände säumten die breite Hauptstraße, überall drängten sich Bürger und Gäste aus dem ganzen Land. Lachende Händler boten lauthals kandierte Früchte an. Es gab glasierte Nüsse, die wie fliegende Käfer geformt waren, und daneben die bittersüßen Sonnenschoten, deren grell gelbe Farbe weithin leuchtete, weil die Händler sie mit Öl einrieben. Bei einem alten Mann mit meerblauer Schürze erstand Vela eine Tüte mit gesalzenen Fingerfischen, die tatsächlich nur so groß waren wie ihr kleiner Finger. Darauf hatte sie sich schon die ganze Reise über gefreut, bei jeder Schale Eintopf hatte sie an die Leckereien der Stadt gedacht. Hastig stopfte sie sich im Weitergehen die getrockneten Fische in den Mund. Ein Jahr war vergangen, seit sie das letzte Mal hier gewesen war, aber es kam ihr vor, als verändere sich in Marinth nie etwas. Neugierig ließ sie den Blick über die überfüllten Buden und die Häuser in deren Rücken schweifen. Die Häuser bestanden allesamt aus dem gleichen roten Stein, der an Rost erinnerte und zu großen Quadern gehauen war. Die Mauern waren dick und die Fenster klein, damit im Sommer die große Hitze nicht ungehindert in die Räume eindringen konnte. Marinth hatte ihr gefehlt. Vela konnte nicht aufhören zu lächeln, selbst dann nicht, als ihr ein großer dünner Mann mit einem blau-weißen Wappen auf der Brust vor die Füße fiel, weil ihn ein Wirt aus dem Lokal geworfen hatte. Zu viel Wein am frühen Morgen. Hätte man den dünnen Mann gefragt, wahrscheinlich nur zu Ehren des Königs! Er erhob sich mühsam und schielte Vela über seine gewaltige Nase hinweg an. »Verzeihung, junge Dame«, lallte er und verbeugte sich schwankend. Dann wandte er sich ab und stolperte in das Lokal zurück. »Und ob ich diesen vermaledeiten Bären unter den Tisch trinken kann!«, rief er. Vela schüttelte lachend den Kopf und stopfte sich den letzten Fisch in den Mund. Hätte ihre Mutter das gesehen, hätte sie wieder gejammert: »Die Stadt ist groß und gefährlich und voller _ voller _ Fremder.« Dabei lebte Velas Vater hier. Außerdem konnte sie langsam wirklich auf sich selbst aufpassen. Sie hatte schon dreizehn Geburtstage hinter sich, und wenn es hart auf hart käme, konnte sie einem Angreifer immer noch den schweren Hammer gegen das Knie schmettern. Wozu schleppte sie das Ding denn sonst überall mit hin? Ihre Hand suchte nach dem glatten Griff des Werkzeugs, das an ihrem Gürtel hing, gut versteckt unter dem weiten Hemd. Auch der Hammer war ein Geschenk ihres Großvaters Rendo. Er hatte ihn in derselben Schmiede für sie angefertigt, in der auch ihr Vater gelernt hatte - bevor er nach Marinth gegangen war, um Königsmechaniker zu werden. Wenn sie den Hammer berührte oder ansah, erinnerte sie sich an den Geruch der Schmiede, und es war fast so, als höre sie Großvater Rendos hohe, kratzende Stimme. Sie fühlte sich sicher. Und die zwei Wochen bei ihrem Vater würden wie jedes Jahr viel zu schnell vergehen. Im Vorübergehen ließ sie die Hände über die ausgehängten weichen Tücher gleiten. Johlende Kinder stießen gegen ihre Beine und Hüfte und rannten weiter, eine verzweifelte Mutter eilte ihnen hinterher. Schließlich blieb Vela an einem weiteren Essensstand stehen und beobachtete, wie der dicke Verkäufer mit gewaltigem Schnauzbart dünnen Teig auf eine heiße Platte goss. Mit leisem Zischen färbte sich der Teig goldbraun. Der Mann gab eine Masse aus Feueräpfeln darauf, um dann erneut Teig darüberzugießen. Die ineinanderfließenden Schichten faltete er zu einem Dreieck, das fest und braun wurde. Zum Schluss legte er das Gebäck auf Silberpapier und reichte es einer wartenden Frau. Der stechend süße Duft der Feueräpfel war zu verlockend, und so reihte sich Vela hinter einer Handvoll Wartender ein und schwelgte im Geruch des warmen Teigs. Als sie endlich an der Reihe war, konnte sie es kaum erwarten, hineinzubeißen. Die Hälfte verschlang sie, noch bevor sie den nächsten Stand erreicht hatte. Es musste am Wetter liegen, sagte sie sich, zu Hause war sie nie so hungrig. Dort war es kühler und die Auswahl der Früchte begrenzt. Das Einzige, was es dort im Überfluss gab, war Wind. Wie sich das Wetter im Dorf ihrer Mutter und in der Stadt ihres Vaters unterschied, so unterschied sich auch das Leben darin. Es kam Vela vor, als laufe sie hier schneller, weil sie sich daheim ständig gegen den Wind stemmen musste. Aber eigentlich liefen alle Menschen in der Stadt schneller. Auf dem großen Marktplatz angekommen, ging Vela auf den massiven Steinbrunnen in der Mitte zu, umrundete ihn und setzte ihren Rucksack auf der anderen Seite ab. Sie schwang sich auf den Brunnenrand, ließ die Beine baumeln und sah zur Allee hinüber, die vom Marktplatz wegführte. Sie war mit Roststein gepflastert und von weiß blühenden Mammutzitronenbäumen gesäumt, die ihren Duft auf jeden ergossen, der zwischen ihnen entlangging. Am Ende der Allee erhob sich das Königsschloss auf einem Hügel, mit roten, silberverzierten Wänden, gelben Dächern und einem breiten Band aus quadratischen Fenstern in den Mauern, die alle von grünem Stoff verdeckt wurden. Der König war natürlich unermesslich reich. Bereits der schwere, weiche Stoff eines Vorhangs kostete mehr, als ein einfacher Knecht im Jahr verdiente. Vela hätte gern grüne Vorhänge vor ihrem Fenster zu Hause gehabt, aber das war unmöglich, denn der Wind hätte sie abgerissen. Deshalb hatte sie, wie alle im Dorf, Bretter davorgenagelt. Sie atmete tief durch und blieb einfach sitzen. Sie wollte noch nicht zu ihrem Vater gehen, auch wenn sie sich darauf freute, ihn zu sehen. Jedes Mal begrüßte er sie mit demselben Satz: »Himmel, wie groß du geworden bist!«, und Vela hasste diese Worte. Als sie noch ganz klein gewesen war, hatte er das Dorf verlassen, um der Gehilfe und Nachfolger des Königsmechanikers zu werden. Seitdem sah sie ihn immer nur diese zwei Wochen im Jahr, wenn der König feierlich aufgezogen wurde. Und von Mal zu Mal brachte sie es weniger über sich, ihn zu fragen, ob sie bei ihm in die Lehre gehen dürfe. Auch jetzt saß sie wieder hier und fand keine Worte und keinen Mut. Wie alle anderen rechnete auch er fest damit, dass sie in die Fußstapfen ihrer Mutter, Großmutter und Urgroßmutter treten und den Himmel, das Meer und die wilde Froststeppe am nördlichen Ende des Reiches beobachten würde. Ihre Mutter achtete auf die Wolken, um in ihrer Formation kommende Stürme zu lesen. Sie wartete auf die brennenden Flugwürmer, die seit über zweihundert Jahren nicht mehr gesehen worden waren, auf Piraten, auf die giftzahnigen Barbakatzen, die mit dem ersten Schnee auf der Suche nach Futter kamen, und sie wartete auf die Räuberbande des listigen Lyssu, der am liebsten die schwere Steuerkasse stahl, wenn die königlichen Geldsammler im Dorf waren. Ihre Mutter konnte das Wetter lesen wie keine Zweite. Sie kannte jedes Tier des Nordens, jede mögliche Bedrohung und wusste jede Bewegung am Horizont zu deuten. Vela bewunderte sie dafür, aber sie konnte sich das nicht vorstellen. Jeden Tag auf den alten Turm klettern, mehr als dreihundert ausgetretene Stufen empor, und aus den weit blickenden Fenstern starren, stundenlang, tagelang, ohne dass etwas passierte. Sie selbst würde das Warten und die unsägliche Langeweile auf dem Turm nicht ertragen. Sie wollte etwas mit ihren Händen tun, wirklich arbeiten, nicht immer nur warten. Ihre Mutter behauptete immer, Vela habe Wind anstelle von Blut in sich, und dass man dem nicht entkommen könne, doch Vela kam es vor, als habe sie eher Feuer im Blut - wie Großvater Rendo und ihr Vater. In der Schmiede hatte sie sich stets wohler gefühlt als auf dem Turm. Der starre Gesichtsausdruck und entrückte Blick ihrer Mutter, der die äußere Welt nach Feinden absuchte, erschreckte sie - anders als der Anblick ihres rüstigen Großvaters, der den Hammer schwang und aus Metall Waffen, Werkzeuge und Schmuck fertigte. Aber darüber sprach sie nicht mit ihren Eltern. Manchmal glaubte sie, Großvater Rendo ahnte, was in ihr vorging. Immerhin hatte er ihr den Hammer geschenkt, der sie nun begleitete wie ein treuer Freund. Leise Musik aus einer Seitengasse unterbrach Velas Gedanken, und sie roch das schäumende Bier, das am Rand des Platzes ausgeschenkt wurde. Sie blinzelte gegen das Licht der Mittagssonne und sah zum Schloss hinauf. Ihr Vater wartete sicher schon in der Werkstatt auf sie, nervös, weil die Zeremonie bevorstand. Noch einmal atmete sie tief durch. Endlich war sie wieder in Marinth. Hier und jetzt musste es doch möglich sein, das zu bekommen, was man sich wirklich wünschte. IN BEWEGUNG Cephei hasste und liebte diese Tage im Jahr. Er hasste sie, weil in der Gaststube am Morgen und am Abend das reinste Chaos herrschte und außer dem Wirt Dorado und Cephei selbst niemand mehr nüchtern war. Und er liebte sie, weil er am Nachmittag, wenn auch die letzten Gäste unterwegs waren, nach Marinth hineinrennen konnte, um sich die Wettkämpfe und bunt gekleideten Besucher aus allen Teilen des Landes anzusehen. Am meisten jedoch freute er sich auf das große Turnier, das der König stets mit seinen ersten Worten nach der Schlüsselzeremonie eröffnete. Aber noch war es nicht so weit, denn im Augenblick fegte Cephei noch die Scherben eines Suppentopfs zusammen. Dabei schmerzte sein Rücken, und Hunger hatte er auch. Während sich die Gäste die Bäuche vollschlugen, musste er mit dem Essen warten, bis die Mittagszeit vorbei war, nur um sie zu bedienen. »Kannst du nicht aufpassen, du Dummkopf!«, schimpfte Dorado, bevor es der feiste Gast tat, dem Cephei gerade mit dem schmutzigen Besen versehentlich über den Fuß gefegt hatte. Der Wirt sah ihn finster an, das Spültuch über die Schulter geschwungen und die Hände in die Hüfte gestützt. »Tut mir leid«, antwortete Cephei und bekam sogleich eine Backpfeife verpasst. »Dir werde ich deine frechen Antworten schon austreiben«, sagte der Wirt und hob die Hand erneut. Cephei sah zu, dass er einen freien Tisch zwischen sich und Dorado brachte, bevor er sich die Wange rieb. Der Wirt hatte nicht fest zugeschlagen, das Brennen ließ bereits nach. Wenigstens würde er keinen blauen Fleck davontragen, den letzten hatte man zwei Wochen lang sehen können. Da wollte er einmal keinen Ärger bekommen und entschuldigte sich sogar, und schon hielt Dorado ihn für frech! Stumm kehrte Cephei weiter und biss die Zähne aufeinander. Wenn es nach ihm ginge, könnte Dorado jederzeit tot umfallen, er würde dem Wirt keine Träne nachweinen. Aber so wie er das sah, würde der Alte ewig leben. »He, Kleiner, bring mir noch ein Bier!«, rief ein rotäugiger Gast, und Cephei stellte den Besen zur Seite. Er ging hinter die Theke, um vom Fass zu zapfen. In dem Moment ging die Tür auf, und die Schusterstochter Sarina kam herein, ihr Lachen schallte durch den ganzen Raum, wahrscheinlich hatte sie mit jemandem auf der Straße gescherzt. In der Hand hielt sie einen großen Tonkrug, und während sie auf Cephei zukam, folgten ihr nicht wenige Blicke. Cephei mochte die Schusterstochter, sie war zwar doppelt so alt wie er und auch doppelt so breit, aber sie besaß ein freundliches Lachen und einen langen, schwarzen Zopf, der fröhlich hin und her wippte, wenn sie die Straße hinabging. Schwungvoll setzte sie den Krug auf der Theke ab. »Mach mal voll, mein Süßer. Mein Vater hat heute besonderen Durst.« Sie zwinkerte ihm zu. »Er sagt, er wird noch wahnsinnig wegen der Schlüsselzeremonie. Nicht wegen dem König oder so, nur weil eben die ganzen Leute in letzter Minute kommen und die Löcher in ihren Sohlen gestopft haben wollen. Dabei sieht die doch sowieso niemand.« Sie lachte wieder und klopfte auf die Theke. »Ist doch gut fürs Geschäft.« »Ja, aber schlecht für den Durst.« Cephei grinste. Sarina zwinkerte noch einmal, und schon schien der Tag ein bisschen heller. Er schob ihr den vollen Krug über die Theke. Sie zählte die Geldstücke ab, dann hob sie den Krug vorsichtig hoch, um nichts zu verschütten, und trat den Rückweg an. Cephei hatte den Krug besonders hoch gefüllt, weil der Schuster doch so großen Durst hatte, und nun schien sie Mühe zu haben, alles heil nach Hause zu kriegen, ohne die Hälfte zu verschütten. Doch sie lachte nur wieder, und Cephei sah ihr nach, bis sie aus der Tür verschwunden war. Dorado unterhielt sich derweil mit dem blonden Holzhändler, in dessen Ohren wieder einmal Sägespäne steckten. Sie sprachen über das heiße Wetter und natürlich über das bevorstehende Fest. »Wird auch Zeit, dass die den alten Knaben mal wieder aufziehen«, stänkerte der Händler. »Ich warte schon seit sechs Wochen auf die Entscheidung. Wie soll man da vernünftig sein Geschäft führen, he?« Der Wirt nickte. »Du hättest den Kerl einfach abfackeln sollen. Hätte doch sowieso keinen interessiert.« Der Händler gluckste und sah in sein Bier, während er sich mit den Ellbogen auf der Theke abstützte. Cephei schüttelte den Kopf. Das war Dorados Antwort auf alles: Wenn ein Problem auftauchte, schlug man einfach so lange darauf ein, bis es verschwand. Cephei wusste nicht genau, worum es in dem Gespräch ging; anscheinend hatte sich ein zweiter Holzhändler an der Kreuzung niedergelassen, der jetzt das Geschäft verdarb. Der König sollte entscheiden, ob das rechtens war. »Ich bin froh, wenn das Fest vorbei ist«, beschwerte sich der Händler weiter. »Dann geht wieder alles seinen Gang. Die Tage, ja Wochen davor macht der König doch nichts mehr, und während der Feierlichkeiten sowieso nicht.« »Kann mich nicht übers Geschäft beschweren.« Dorado wischte über die Theke. »Nach dem Turnier wollen die Leute trinken. Und dieses Jahr kommen sogar die Ritter und werden ordentlich feiern. Hab einen guten Handel mit einem Mann gemacht, der die Ritter nach dem Turnier direkt hierherführen wird. Das lässt es klingeln.« Der andere winkte ab, aber Cephei bekam eine Gänsehaut vor Aufregung. Ritter hier in der Gaststube! Dann hätte er Gelegenheit, sie aus der Nähe zu beobachten und abenteuerliche Geschichten aufzuschnappen, die sie einander erzählen würden. O ja, er liebte diese Tage, ganz sicher. Lächelnd brachte er dem Rotäugigen das Bier und fegte die letzten Scherben zusammen. Dann stieg er die ausgetretenen Stufen hinauf und lief in seine Kammer. Hungrig schlang er das trockene Stück Brot und den Käse herunter, die Dorado ihm am Vorabend gegeben hatte. Endlich. »Mann, Mann, wenn das noch lange so weitergeht, bin ich krumm, bevor ich groß bin«, sagte sich Cephei, während er beobachtete, wie ein langbeiniger Weberknecht an der Wand emporkroch. Mit verschränkten Beinen saß Cephei auf dem Bett. Seine Schultern krümmten sich von selbst nach vorn, er zog den Kopf ein, wie immer in der Kammer. Sie war winzig, und manchmal hatte er den Eindruck, dass sie noch weiter schrumpfte, während er sich darin aufhielt. Als er sich anfangs den Raum noch mit Equu geteilt hatte, war es besonders schlimm gewesen. Außer zum Schlafen hatten sie sich nie gemeinsam in der Kammer aufhalten können, weil sie sich sonst ständig auf den Füßen herumgetrampelt wären. Doch dann war Equu Knappe bei Ritter Leppo geworden und hatte der Kammer ein für alle Mal den Rücken gekehrt. Cephei musste den Arm nicht einmal ganz ausstrecken, um den Weberknecht mit Daumen und Zeigefinger an einem der langen Beine von der Wand zu klauben. Langsam schwenkte er den Arm zum geöffneten Fenster und legte das Tier auf das äußere Fensterbrett. Der Weberknecht war so überrascht, dass er sich nicht bewegte, sondern einfach in der Sonne liegen blieb. Cephei stützte sich mit dem Ellbogen daneben ab, um ihn weiter zu beobachten. »Und jetzt? Willst du hier weiter rumgammeln?«, fragte er. »So wird das aber nichts mit dir. Man muss immer in Bewegung bleiben, klar?« Das hatte ihm Equu gesagt, wenn sie wieder einmal vor einem von Dorados Wutausbrüchen davongerannt waren. Equu war bereits fünfzehn und tat so, als unterscheide er sich deshalb gewaltig von Cephei. »Wegen zwei lächerlicher Jahre, stell dir vor«, sagte er zu dem reglosen Weberknecht. »Genau genommen: einem Jahr und elfeinhalb Monaten.« Equu war einer der zwei Freunde, die Cephei in der Stadt hatte. An manchen Tagen hatte Equu sein Essen mit ihm geteilt, wenn Dorado wieder einmal der Meinung gewesen war, Cephei sei zu frech, zu faul oder zu irgendwas gewesen, um sich ein Abendbrot verdient zu haben. Aber jetzt war Equu fort. Er diente in der Nähe des Schlosses als Knappe und bekam regelmäßig zu essen. Davon träumte Cephei. Noch ein Jahr musste er durchhalten, dann wäre er alt genug und würde sein Glück bei einem der Ritter versuchen. Wenn er erst mal aus diesem Loch hier raus war, würde sich einiges ändern. Und zwar zum Besseren, so viel stand fest. »Was meinst du?«, fragte er den Weberknecht, der endlich ein Bein hob, aber da war es schon zu spät. Vom Baum gegenüber kam Cepheis zweiter Freund angeflogen, stürzte sich auf das Spinnentier und schluckte es im Ganzen herunter. »Er hätte sich ja nur bewegen müssen, oder?« Cephei sah den Erdwühler an, und der Vogel blickte aufmerksam zurück. Mit einem Finger strich er dem Erdwühler über den Kopf. Die meisten Leute wussten nicht, wie weich das Gefieder am Kopf eines Erdwühlers war, es sah so struppig und schmutzig aus. Sie hielten den Vogel für hässlich und jagten ihn fort, sobald er sich in ihrer Nähe niederließ, weil er so schmutzig braun war und mit dem langen platten Schnabel in der Erde wühlte, auch in frisch ausgehobenen Gräbern, und das verschaffte ihm seinen schlechten Ruf. Doch Cephei fand ihn wunderschön. Es lag wohl an den dunklen Augen, die ihn groß und aufmerksam anschauten. Manchmal kam er sich selbst wie ein Erdwühler vor, nur dass er nicht im Boden wühlte, sondern im Dreck. Die Menschen jagten ihn auch fort, wenn er sich in ihre Nähe wagte, es sei denn, sie schickten ihn nach Essen oder Bier. Vielleicht lag es daran, dass er weder den Namen seiner Mutter noch den seines Vaters kannte. Sie hatten keinen Zettel hinterlassen, als sie ihn eines Nachts vor die Tür des Waisenhauses gelegt hatten. Der fehlende Name war ein Makel, den er nicht loswurde. Also hatten sie ihm im Waisenhaus einfach den nächstbesten Namen gegeben. Doch die Menschen blieben misstrauisch, als mache es einen Unterschied, von wem man seinen Namen bekam. »Du hast doch auch keinen. Mögen dich die anderen Vögel deswegen weniger?«, fragte er den Erdwühler, der mit dem Schnabel klapperte. »Siehst du.« Als Dorado ihn vor vier Jahren aus dem Heim geholt hatte, hatte Cephei geglaubt, jetzt würde er endlich ein Zuhause finden, und irgendwie hatte er das ja auch. Es war nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte, aber es war das einzige Zuhause, das er kannte. Aber all das würde sich ändern, wenn er erst Knappe wäre. Equu erzählte, seine Kammer im Haus des Ritters sei dreimal so groß wie diese hier, und Cephei glaubte ihm. Dreimal so groß, und auch die Decke sei nicht so niedrig. »Tja«, sagte er zu dem Vogel. »Langsam sollten wir los zur Zeremonie und zum Turnier, was?« Der Erdwühler legte den Kopf schief, und Cephei nickte. »Wenn ich wissen will, was von einem Knappen alles erwartet wird, muss ich sie doch beobachten, oder?« Wieder einmal bekam er von dem Vogel keine Antwort, das war das Schwierige an ihrer Freundschaft. »Wenn ich erst mal Knappe bin, esse ich auch Kuchen, bestimmt. Und natürlich Fingerfische. Tütenweise Fingerfische. Dann kann ich dir davon abgeben. Wäre doch mal was anderes als immer nur Brot für mich und Weberknechte für dich, oder?« Es würde eine tolle Zeit werden. Auch Equu sah besser aus, seit er nicht mehr für Dorado schuftete. Cephei musste einfach durchhalten, irgendwann würde sich auch ihm eine Chance bieten, er musste nur in Bewegung bleiben, immer in Bewegung. Er klopfte sich auf die Schenkel und kletterte aus dem kleinen Fenster, um in die Stadt zu laufen. DER KANZLER Das Zimmer sah noch genauso aus, wie sie es in Erinnerung hatte. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber das konnte auch daran liegen, dass Vela wieder ein Stück gewachsen war. Die Dielen waren dunkel gestrichen. An den Wänden hingen Strohbilder, für die die Stadt berühmt war, und die einen schwachen Duft nach Feldern verbreiteten. In den Rahmen posierten frühere Würdenträger vor beeindruckenden Landschaften, auch der Mechanische König selbst war abgebildet: ein freundlicher Sieger über die Feinde des Reichs. Zwei seiner größten Siege erkannte Vela auf den Darstellungen: Vor dreihundert Jahren hatte er die kannibalischen und plündernden Horden der gescheckten Wolfsreiter zurückgeschlagen, und kurz vor Velas Geburt hatte er die kahlköpfigen Seefahrer mit den goldenen Ohren zurück ins Meer getrieben, so dass diese selbsternannten Herren aller Küsten gedemütigt und dezimiert zu den Schlangeninseln heimkehren mussten. Der Mechanische König hatte in beiden Fällen gesiegt, ohne Rache zu nehmen. Vela saß auf dem Bett und drehte die Kurbel am Fußende. Das eingerostete Ding bewegte sich nur langsam und quietschend, erst mit beiden Händen konnte Vela den Hebel eine halbe Drehung vorwärtsbewegen. Das Bettgestell hob sich zitternd in die Höhe. Jedes Jahr schob sie das Bett ein Stück nach oben, weil ihre Beine länger geworden waren und sie so besser sitzen konnte.
| Erscheint lt. Verlag | 11.5.2009 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 135 x 215 mm |
| Gewicht | 605 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Literatur ► Fantasy / Science Fiction ► Fantasy |
| Schlagworte | Antolin (ab 7. Klasse) • Fantasy |
| ISBN-10 | 3-453-52534-5 / 3453525345 |
| ISBN-13 | 978-3-453-52534-4 / 9783453525344 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich