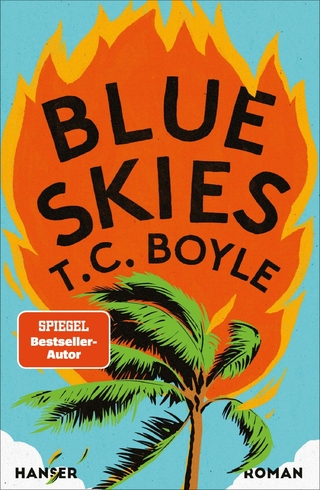Friedhofsgemüse (eBook)
180 Seiten
BoD - Books on Demand (Verlag)
978-3-7597-2842-5 (ISBN)
Hugo Baboons lebt mit seiner Frau, seinen zwei Kindern, sieben Hühnern und einer Katze in Sachsen, wo er als Hausarzt arbeitet.
15. Frieden und Unfrieden
Dunkelheit lag noch über der Stadt. Am westlichen Horizont sank Orion, der himmlische Jäger, mit seiner blutigen Schulter langsam in die Tannen der Anhöhe. Ein Schal bedeckte meinen Hals, an den Händen schützten Fäustlinge vor der schneidenden Kälte. Ich klopfte das Eis vom Sitz meines Fahrrads und stieg in die Pedale. Hinter den Fenstern der Häuser, die an mir vorüberflogen, sah ich keine Anzeichen von Leben, die Straßen waren verlassen und menschenleer. In der Stille hörte ich bloß den eigenen Atem, der kleine Nebel bildete, die sich rasch wieder auflösten.
Um nicht zu schlittern, zog ich vorsichtig die Rückbremse. Trocken knirschte der Schnee unter dem Profil meiner Reifen. Wenn ich morgens zum Heim fuhr, hielt ich oft an dieser Stelle, auf einer Kuppe, als könnte der Ausblick meine Seele reinigen. Gestern hatte mich ein Brief erreicht, der mir nicht aus dem Kopf ging. Es war die Zusage zu einem Studienplatz. Ja, ich freute mich. Aber trotz der Freude war mir klar, dass der Dienst im Heim dann zu einem nahtlosen Übergang führte. Die wenigen Tage, die zwischen Heim und Studium lägen, waren zu kurz für einen Urlaub. Mit meinem Strand am Indischen Ozean würde es wieder nichts werden. Ich gab mir Mühe, nicht zu seufzen, und blickte nach vorne. Weit unten in der Talsenke stand eine bedachte Bushaltestelle, zu deren Seiten sich Felder erstreckten, auf denen im Sommer Kartoffeln wuchsen und wilder Mohn. Darüber dehnte sich der Horizont aus, dann kam das All. Ich setzte mich in den Sattel und ließ mich treiben.
Auf der schneebedeckten Hecke vor dem Heim entzündete die Straßenlaterne einen Bogen aus matten Farben. Ich schloss das Fahrrad ab, als plötzlich eine weibliche Stimme die Stille durchbrach.
„Hallo!“, rief sie schwach und dünn, trotzdem hörte ich, wie in dem Wort Verzweiflung mitklang. „Kommen Sie doch bitte mal hierhin …“
Ich wandte mich um. Mein Blick streifte die oberen Fensterreihen. Ich suchte nach einer verdächtigen Bewegung, bis ich an einem offenen Fenster in der ersten Etage, die Haare von hinten beleuchtet, Helene Rose stehen sah. „Können Sie nicht die Polizei rufen?“ Flüchtig blickte sie über ihre Schulter nach hinten, dann wieder ungeduldig auf die Straße. „Man hält uns Frauen hier gefangen.“ Dabei lehnte sie sich so weit vor, dass ich Angst hatte, sie könnte gleich aus dem Fenster kippen.
„Soll ich zu dir hochkommen?“
„Bitte erlösen Sie uns“, stöhnte sie, ohne mich zu erkennen. „Es ist einfach schrecklich.“
Die Pforte war nicht besetzt. Ich schloss den Haupteingang auf, stampfte den Schnee von meinen Schuhen ab und durchmaß das Foyer. Zu meiner Überraschung traf ich oben vor dem Dienstzimmer eine völlig entspannte Mannschaft an. Sie wussten es bereits.
Romina trank Kaffee, die Schwarze Schwester liftete sorgsam ihre Wimpern und Lottchen versuchte, mich zu beruhigen. Dieser Zustand der Verwirrung, wie sie ihn bezeichnete, konnte Tage andauern oder in den nächsten Stunden einfach verfliegen. Niemand, sagte die Stationsschwester, könne Helene Rose jetzt da herausholen.
Aber ich hatte es versprochen. Ich wollte es wenigstens versuchen.
Die Nachttischlampe tauchte das Zimmer in ein fahles, gelbes Licht. Mit Entsetzen nahm ich unzählige, am Boden verstreute Scherben wahr - eine vom Tisch gefallene Colaflasche. Helene Rose stand barfuß am offenen Fenster. Nervös fuhr sie herum.
„Nicht bewegen!“, rief ich. „Vorsicht!“ Ein Windstoß schlug die Fenster nach innen. Der Vorhang streifte ihr verschrecktes Gesicht, über das Strähnen weißer Haare fielen. „Zum Glück bist du nicht ins Glas getreten.“ Ich nahm sie schützend in den Arm, um sie aus dem Gefahrenbereich herauszuschaffen. Hinter sich schliff sie ihren vollen Katheterbeutel achtlos über den Boden.
„Ich … ich weiß nicht“, stotterte sie aufgewühlt. „Kannst du mir nicht sagen, warum man uns alte Leute so behandelt. Warum man uns quält?“
„Quält?“
„Was haben die Schwestern davon, uns unter Drogen zu setzen und hier einzusperren?“
„Niemand sperrt dich ein“, wehrte ich ab. „Du kannst doch gehen, wohin du willst.“
Für Helene Rose traf das tatsächlich zu. Sie hätte das Heim stundenweise oder länger verlassen dürfen, sie hätte sich nur abmelden müssen, was sie nie tat. Aber das wollte sie nicht hören.
„Wenn es so weit ist, lässt man mich nicht raus, ich kenne das doch.“ Sie fixierte die weiße Hose auf meiner Haut, mein weißes Hemd. „Ihr steckt alle unter einer Decke“, sagte sie überzeugt. „Versuch nicht, mir was anderes zu erzählen, das kannst du dir sparen.“ Sie wurde böse. „Was findet Ihr dabei, so was mit uns alten Menschen bloß zu tun?“
Unsicher merkte ich, wie mir die Argumente fehlten.
Die ganze Situation war verworren.
„Meinst du die Medikamente?“, fragte ich ratlos.
„Als ob du das nicht genau weißt.“
„Die Schwestern müssen euch Medikamente geben, das sind ärztliche Anordnungen.“
„Ich denke, du solltest besser gehen!“
„Aber ich bin extra gekommen, um dir zu helfen.“
„Dann lass mich zufrieden. Hast du nicht gehört.“
Das letzte Wort spuckte sie förmlich aus: „Verschwinde!“
Ich solle zu meinen Freundinnen gehen, schob sie abfällig hinterher, den Schwestern, und denen ruhig erzählen, wie verwirrt die Frau Rose doch sei. Und einen Augenblick lang dachte ich tatsächlich darüber nach, wie hellsichtig ihr Urteil war. Setzte man die Bewohner hier etwa nicht unter Drogen, waren sie nicht eingesperrt? Und ja, natürlich steckten die Schwestern alle unter einer Decke.
Was ich schließlich tat, war das Einfachste, ich kehrte die Scherben zusammen und ließ Helene Rose ihrem Wunsch entsprechend allein. Wieder einmal behielten die Schwestern recht.
16. Leihgabe
Schwester Romina reichte mir am Pausentisch ein Glas Mineralwasser. Niemand musste fragen, wie es gelaufen war.
„Sie denkt“, meinte Lottchen tröstend, während sie nach einem Messer für ihr Frühstücksei suchte, „man habe sie und alle übrigen Bewohner ausquartiert.“
„Ausquartiert? Sie ist doch in ihrem Zimmer.“
„Richtig. Sie nimmt aber an, wir hätten alle Leute betäubt und in einer Nacht- und Nebelaktion in ein anderes Heim verlegt.“
„Damit den Bewohnern nichts auffällt“, fügte die Schwarze Schwester erläuternd hinzu, „hat man am neuen Ort eine exakte Kopie von unserem Heim angelegt.“ Ich zog die Augenbrauen hoch. „Ja. Alle Habseligkeiten wurden mitgenommen, jedes Deckchen kam wieder an seinen Platz. Man hat an alles gedacht, nur wollte man die Bewohner offenkundig über den Umzug nicht informieren.“
„Das ist ja irre“, sagte ich.
„Genau.“
Mit einem derben Messerschlag köpfte Lottchen ihr Ei. Das Innere war sehr flüssig. Den Dotter kippte sie auf eine Brötchenhälfte. Zu meiner Verwunderung tröpfelte sie großzügig Maggiwürze hinzu. Dann verrührte sie den schwarzgelben Belag mit einem Löffel Margarine. Wäre ich hungrig gewesen, hätte ich den Appetit verloren.
„Dahinter vermutet Helene einen Plan“, sagte sie.
„Was für einen Plan denn?“
„Das, mein Lieber, will sie ja von uns wissen. Und wir können ihr keine glaubhafte Erklärung anbieten.“
„Ich verstehe nicht, wie sie überhaupt darauf kommt.“
„Vielleicht Schlafentzug“, bot Romina an.
„Oder ein schlechter Traum, den sie nicht von der Realität trennen kann“, gab die Schwarze Schwester zu bedenken.
„Irgendwas, das sie längere Zeit bedrückt und aus ihr herausbricht“, meinte Lottchen. „So was passiert zwei- oder dreimal pro Jahr. Besonders erstaunlich ist, dass Helene sich nachher genau an ihre Verwirrung erinnern kann, was ihr so peinlich wird, dass sie nicht mehr aufhört, sich bei wirklich allen für ihr Verhalten zu entschuldigen. Niemand kann sie da jetzt herausholen.“
„Okay“, sagte ich, „dann warten wir ab.“
Ich trank aus meinem Glas. Die Art, wie Lottchen aufblickte und mich anschließend angrinste, ließ nichts Gutes erwarten.
„Ich habe eine andere Aufgabe für dich“, meinte sie zwinkernd. „Oben auf der Station ist jemand krank geworden. Wärst du so lieb, Toni zu unterstützen und uns allen damit eine große Freude zu bereiten?“ Grübelnd wandte ich mich ab. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Lottchen genussvoll in ihr tropfendes Brötchen biss. Mit dem Handrücken wischte sie sich die Dottersoße vom Kinn. „Danach kannst du ja wieder...
| Erscheint lt. Verlag | 1.10.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Biografien & Erinnerungen • Biografischer Roman über Freundschaft • Deutsche Literatur • Erinnerungen Pflege • Freundschaftsgeschichten Altenheim • Gegenwartsliteratur Unterhaltung • Geschichten Altenheim • Geschichten über das Altern • humorvoller Roman • Roman Generationenkonflikte • Roman Medizin • Tatsachenroman Pflegeheim • Wahre Geschichten • Zeitgenössische Lebensgeschichten • Zivildienst Erfahrungen |
| ISBN-10 | 3-7597-2842-1 / 3759728421 |
| ISBN-13 | 978-3-7597-2842-5 / 9783759728425 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 312 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich