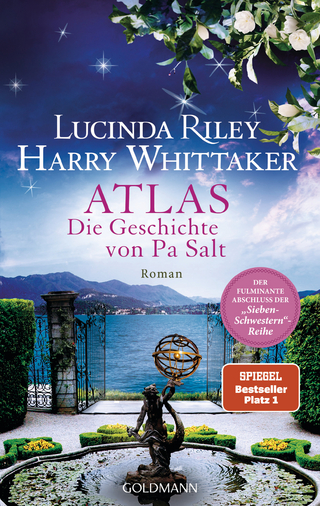Das falsche Bild
Ohetaler Verlag
978-3-95511-186-1 (ISBN)
»... Eine Hauptstärke dieses ›Kriminalhistorienromans‹ liegt in der psychologisch stimmigen, messerscharfen Beobachtungsgabe, mit der hier Menschen dargestellt werden. Und das geschieht oft auf ganz indirekte Weise, mit wenigen, perfekt gewählten Worten: Eine kleine Körperbewegung wird gezeigt, ein spontaner Ausspruch – oft auch auf Tschechisch – zitiert, die Berührung einer Hand nachfühlbar gemacht. So werden alle Akteure lebendig, steigen aus dem doppelt historischen Rahmen und erhalten ihr eigenes, zeitgenössisches Portrait. Und so gelingt dem Buch auch der Absprung in eine andere, zusätzliche Gattung: Denn ›Das falsche Bild‹ ist auch und vor allem ein echter und echt guter Liebesroman.«
Sudetendeutsche Zeitung, München
»... Das falsche Bild spiegelt die großen politischen Ereignisse in einem nur vermeintlich unspektakulären Familienkreis.« Hessische Allgemeine, Kassel »... Der Roman behandelt das große Thema der Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen.« Freies Wort, Suhl »... Die Stadt und die Zeit der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wird sehr genau beschrieben, auch die Zusammenhänge und die Gefühle beider Bevölkerungen, der ursprünglichen sowie der neuzeitigen. Melancholie und Zuversicht erwecken eine Spannung, die den Leser bis zur letzten Seite begleitet.« Z. Mrázková, Museum Fotoatelier Seidel, Český Krumlov
Das goldbraune Wasser der Moldau schwappt gegen die Sandsteine der Uferbe¬festigung. In den Schaumkronen treiben Pappbecher, Plastiktüten, Äste und Papierfetzen dem nahen Wehr entgegen, von dem das Geschrei wetteifernder Kanufahrer herüberschallt. Das monotone Brausen des Wassers scheint anzuschwellen, drängt sich drohend ins Bewusstsein. Vera starrt hinüber. Starrt und lauscht und bemerkt plötzlich, dass sich ihre Hände zu Fäusten geballt haben. Sie spreizt die schweißigen Finger, bis der Krampf sich löst. Sie wendet sich ab und steigt die fünf ausgetretenen Stufen hinauf, die sie wieder zur Straße mit ihren vertrauten Geräuschen bringen. Von hier aus wirkt der Fluss behäbig, man übersieht auch die Verschmutzung. Über seinen tanzenden, blinkenden Schuppen erhebt sich die schwungvolle Stadtsil¬houette – auf dem Felsensporn hoch oben der mächtige Rundturm, in seinem Rücken das Schlossareal, in der Senke der Fluss, am jenseitigen Ufer verschachtelte Häuserfronten, graue und ziegelrote Dä¬cher, die sich hinaufziehen bis zur stolz aufragenden gotischen Kirche. Vera überlegt kurz, ob sie nicht gleich die Fischergasse suchen soll, das Haus der Großeltern väterli-cherseits. Aber nein, erst einmal nur herumschlendern wie eine neugierige Touristin, im Allgemeinen bleiben, nichts Konkretes planen, vielleicht Schmerzliches erleben. Über die Brücke schlägt Vera den Weg in die Altstadt ein. Die Breite Gasse gleicht einem Acker. Die Pflastersteine sind bis auf einen schmalen Rand für die Fußgänger entfernt. Stahlrohre, mannshohe Beton¬ringe und anderes Baumaterial warten auf die Weiterverarbeitung, eine vorsint-flutliche Teermaschine auf ihren Einsatz. Aber Straßenarbeiter sind nicht zu sehen. Einer¬lei, welche Farbe einst die aneinander gedrängten, zwei- bis dreistöckigen Häu¬serfassaden hatten – ihr Ockergelb, Weiß oder Rostrot ist von einer grauen Schicht wie Schimmel überzogen. Von den Renaissancegiebeln ist der Putz in großen Fla¬den herabgestürzt, und die Ziegelsteine verraten, dass sie schon seit Jahren schutzlos jeder Wetterlage ausgesetzt sind. Am Ende der Gasse fasst Vera ein kompaktes Gebäude mit frisch gedecktem Schieferdach ins Auge, die schmucklose Front ist von klei¬nen Fenstern und einem mächtigen Torbogen unterbrochen. Das muss das ehemalige ›Fürstli¬che Bräuhaus‹ sein. Vera drückt vergeblich gegen das Tor, durch das einmal die Kutschen und die mit Bierfäs¬sern beladenen Fuhrwerke in den Innenhof gerumpelt sind. »Geschlossen! Man kann nicht hinein, da wird umgebaut. Das wird ein Mu¬seum!«, ruft jemand auf Tschechisch. Es ist der Wirt aus der gegenüberliegenden Kneipe, der gerade ein Schild neben seinem Lokal aufstellt. Goulasch mit Semmel¬knödel. Gute böhmische Küche. »Muzeum? k čemu? Was für ein Museum?«, fragt Vera zurück. Sie ver¬steht Tschechisch so einigermaßen, aber mit dem Sprechen hapert es. »Ah, Deutsche?« Er schlendert heran und mustert Vera eingehend. »Ja, Museum, das Ludwig-Welke-Malerzentrum. Sie kennen den Maler Welke?« Vera nickt. Natür¬lich kennt sie ihn. Ihr Gegenüber fährt fort: »Ein berühmter Maler aus unserer Stadt, aber ich persönlich verstehe das Theater um ihn nicht. Seine Bilder, sie sind dreckig und ge¬mein, Sie entschul¬digen. Die armen Mädchen, seine Modelle, wie entstellt sie sind. Diese Hände! Dabei sind die Frauen aus dem Böhmerwald bekannt für ihre Schönheit!« »Oh, danke für das Kompliment! Ich stamme nämlich auch von hier«, flirtet Vera gesprächsbereit. Aber die unbefangene Freundlichkeit des Mannes verflüch-tigt sich. »Sie stam¬men von hier?« Und schnell auf Deutsch: »Sudetendeitsche?« Als sie eifrig bejaht, wird sein Blick abweisend. Er zieht noch einmal an der Zigarette und schleu¬dert sie in den Graben. »Soso, von hier.« Er tippt mit zwei Fingern grüßend an die Schläfe und geht, rückt noch einmal an seinem Reklameschild und verschwin¬det in der Kneipe. Sieh an, dem passt mein Kommen nicht, wundert sich Vera kurz und wendet sich wieder zum Bräuhaus. Sie selbst hat es in den Kindertagen nie betre¬ten, kennt es nur aus den Erzählungen ihrer Mutter, die in diesem mächtigen Ge¬mäuer aufgewachsen ist. Durch einen Spalt zwischen den verwitterten Eichenbret¬tern des Tores kann sie in den Innen¬hof spähen. Zwischen Bauschutt, Kanalisationsröhren und einer Zementmaschine erdenkt sie sich ihre Großmutter, die gebeugt, mit schweren Brüsten und von den vielen Schwangerschaften trommel-förmigem Bauch, in Holzschuhen hin und her schlurft. Vera sieht ihre Mutter, achtjährig, die steile Treppe an der gegenüberliegenden Wand herunterhopsen, niedlich herausgeputzt und die viel zitierte Schleife im wilden Haar. Und in irgendeiner Stube dieser imposanten Brauhausanlage ist Veras Großvater ge¬stor¬ben. Jetzt also soll hier dem berühmten Gast dieser Stadt, Ludwig Welke, ein Mu¬seum eingerichtet werden. Ein überraschendes Zusammen¬treffen. Der strahlende Mai hatte sich vorgestern beim Erreichen des Böhmerwaldes jäh in ei¬nen nassgrauen März verwandelt. Während Vera durch die Gassen streift, die heute Soukenička und Dlouhá heißen, an deren deutsche Straßennamen sie sich nicht mehr erinnert, setzt wieder Regen ein, in den sich sogar Schneeflocken mi¬schen. Ein un¬vorteilhaftes Wetter für eine alte Stadt. Krumau, die schon von Adalbert Stifter besungene ›Graue Witwe‹ präsentiert sich bei Veras erstem Besuch der alten Hei¬mat in ihrer ganzen Melancholie. Diesen Eindruck erzeugt aber nicht nur der Verfall des Ortes allein. Es dau¬ert eine Weile, bis Vera klar wird, was noch fehlt: Schaufenster, Reklame, flanierende Menschen. Erst auf den zweiten Blick, zufällig, man ist schon fast vorbeigelaufen, entdeckt man zum Beispiel einen Schallplatten- bzw. CD-Laden, einen Tabak- und Zeit-schriften¬kiosk oder dieses Lebensmittellädchen, bei dem hinter zwei nor¬malen Fensterscheiben, die auch zu einem Wohnzimmerchen gehören könnten, nur die auf dem Fensterbrett zur Pyramide aufgebauten Konservendosen mit Erbsen und Karotten auf seine Existenz hinweist. An der Tür hängt ein kaum noch lesbares Schild: Nachmittags geschlossen. Nirgendwo locken hin¬ter blitzen¬den Scheiben hübsche Klamotten, keine Parfümerie, kein Blumenladen, keine Bä¬ckerei mit speziellen Düften. Nichts wirbt, nichts reizt, nichts springt grellbunt ins Auge, nichts verführt. Deshalb fällt der kleine Laden sofort auf, vor dem in einer Tonschale dunkelrote Tulpen und weiße Hyazinthen leuch-ten. Die beiden Flügel eines Holztores sind an die Hauswand zurückgeklappt und geben den Blick auf einen Sand¬steinbogen frei, den eine Glastür und ein Schaufensterchen ausfüllen. Ein Regal darin präsentiert geschliffene Kristallgläser, – Sektkelche, Likörschalen, Weinglä¬ser. Der winzige Laden ist durch drei Kunden fast überfüllt. Vera, sofort entschlos¬sen, die scheinbar frischgebackenen Unternehmer durch einen Einkauf beim Start in die Selbständigkeit zu unterstützen, will hineingehen, aber auf den zwei Stufen des Eingangs bleibt sie verblüfft stehen. Im oberen Teil der Glastür prangt unüber¬sehbar ein Aufkleber mit der Überschrift ›Großdeutschlands Winterhilfswerk 1939/40‹. Ein die Sammelbüchse schwingender, kerniger SA-Mann ist noch gut zu erkennen, ebenso links oben der Reichsadler mit Hakenkreuz. Ein bisschen ist an allem herumgekratzt wor¬den, aber ohne viel Erfolg. Der Mann hinter der Kasse beobachtet sie amüsiert und blinzelt ihr zu, als sich die Blicke treffen. Vera tritt ein. Während sie die Ausstellungstücke begutach-tet, leert sich der La¬den. »Deutsche, nicht wahr? No, Naziklebstoff hält sehr gut«, ent¬schuldigt sich der Händler unbekümmert, mit einer Kopfbewegung zu dem Naziemblem. Sein Deutsch klingt so musikalisch, wie Vera es von ihren tschechischen Verwandten in Erinnerung hat. »Ja, der klebt«, bestätigt sie nachdenklich, viel mehr am Klang seiner Sätze interessiert, als an der Antwort. »Pokud je mi známo – also, soweit ich weiß, diese Holztüren, sie waren verschlossen, bis ich vorletzte Woche den Raum übernommen habe. Hier«, er deutet auf die Wand in seinem Rücken, »hier sogar noch ein Bild von Hitler hat gehan¬gen.« Sein Lachen, in seinem rotbraunen, kurzgeschorenen Bart kaum zu sehen, klingt weich und sym¬pathisch. Der schmale Verkaufstresen mit der messingbeschlagenen Registrierkasse scheint ebenfalls ein Relikt aus jenen Zeiten zu sein. Die Wände sind frisch ge¬weißt, es riecht nach Farbe und dem Fichtenholz der roh gezimmerten Regale. »Und was war vorher hier?« Die Lachfalten glätten sich. Der Mann fährt sich mit einer Hand durch das Kraus¬haar und blickt fort auf die Straße. »Ein – ein Zuckerlgeschäft. Pralinen, Bon¬bons und so etwas. Der Besitzer ist schon ’42 weg, sagt man. Heim ins Reich, kann sein. Je¬den¬falls weg. Ich weiß nichts darüber.« Er breitet die Arme aus. »Eines Tages wo¬möglich das hier ist zu eng, aber für Anfang – člověk nikdy neví – äh, man weiß ja nicht, was Zukunft bringen wird.« Ein Zuckerlgeschäft. Das löst bei Vera eine vage Erinnerung aus, die sie nicht gleich fassen kann. Sie nimmt einen Sektkelch in die Hand und lässt das Licht durch den kunstvollen Schliff blitzen. »Machen Sie das selbst?« »Ano! Freilich! Unten an der Moldau, ich habe kleinen Be-trieb. Zwei Mitarbei¬ter. Sie haben Interesse? Bitte, hier ist Anschrift, ganz leicht zu finden. Ich mache gerne Vorfüh-rung.« Beflissen überreicht er Vera ein Werbeblättchen. Milan Pálka, erstklas¬sige Glasschleiferei, beste Qualität, 24% Blei-kristall, fertige nach Ihren Wün¬schen. Vera lässt das Blatt sinken, durchforscht mit den Augen den Raum. »Alle Achtung, dass Sie das riskieren. Die erste Zeit ist ein bisschen schwierig, ja. Ich weiß das, weil ich auch vor ein paar Jahren… Also, ich denke, hier bei Ihnen, wo so vieles im Um¬schwung ist, wird es wahrscheinlich noch viel schwerer sein als bei uns im Westen.« Sie schaut auf die Gasse hinaus zu den gegenüber verlaufen¬den Arkaden mit dem bröckelnden Putz. »Wie konnte man das nur alles so herunterkommen las¬sen!« Der Mann stößt ein kurzes, unfrohes Lachen aus. »No, wissen Sie, vielleicht wir hatten andere Sorgen?« »Nein! Nein, das lasse ich nicht gelten! Ich weiß, dass es hier in den letzten Jah¬ren ein immenses Problem war, an einfachste Dinge wie Farbe, Nägel, Klebstoff und so was zu kommen. Die Schwester meiner Mutter, die hier geblieben ist, hat oft genug in ihren Briefen um so etwas gebeten. Aber dass es niemanden geküm¬mert hat, wenn ein Fensterladen schief in den Angeln hängt, dass der Gartenzaun umkippt oder – Na, jedenfalls, das hat doch nichts mit Materialmangel zu tun. Das ist Ignoranz!« Milan Pálka mustert sie fast mitleidig. »Možná, že – Möglicher¬weise, Sie haben recht. Aber können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn dem Men¬schen fast ein halbes Jahrhundert eingehämmert wird, dass Sozialismus wichtig ist und nicht diese – diese Sehnsucht von Bourgeoisie nach schöne Garten?« »Tja, ich weiß nicht.« Vera resigniert. Das kann sie sich tatsächlich nicht vor¬stel-len. Sie wendet sich wieder den Kristallgegenständen zu. Schön, wie sie fun¬keln. Zuhause in ihrem Gläserschrank stapeln sich zurzeit zwar nur ganz schlichte, klare Formen, wie sie halt jetzt im Westen ›in‹ sind, aber diese gleißenden, das Licht vielfach widerspiegelnden Pokale und Schalen sind faszinierend. Sie greift nach der größten Kristallschüssel und ist überrascht, wie schwer sie ist. »Die nehme ich, bitte.« Milan Pálka kommt ihr entgegen, nimmt sie ihr ab. Mit Obstsalat gefüllt auf dem Kalten Buffet ihrer nächsten Party zu Hause ... Toll wird das aussehen, ein ech¬ter Hingu-cker, freut sich Vera im Stillen, während er die Schale um-ständlich in Zeitungspapier wickelt. Als der Mann ihr das Wech¬selgeld reicht, treffen sich ihre Augen. Vera kann das irisierende Feuer in den seinen nicht lang aushalten, hastig wendet sie sich ab und han¬tiert mit ihrer Geldbörse und der Handtasche herum. »Ja, also dann, Herr Pálka, tschüss! Nur Geduld, Sie schaffen es. Ihr Verkaufsraum hier hat was. Flair, Atmosphäre. Mein Kompliment!« Sie hält einen Moment inne, überschaut den kleinen Raum. »Aber hier, hier links an der Wand, ja, da fehlt was. Zum Beispiel ein Bild. – Ja, ein Bild, ein schönes Plakat. Oder ein Poster, wie man bei uns sagt. Die Wand ist so zu kahl.« Die Galeristin in ihr kann den kleinen Mangel nicht ignorieren. »Vielleicht ich könnte den Hitler holen, da aus der Kam-mer?«, schlägt er schmun¬zelnd vor. Vera lässt sich einen Moment verwirren. »Wie? Unsinn! Nein, etwas Farbiges, ein Poster von Mirò vielleicht, oder – nein! Ein Druck von Ludwig Welke, das wär’s!« Sie starrt die leere Wand neben dem hölzernen Regal an und hängt in Ge¬danken die eine oder andere Kreidezeichnung auf. »Hat das Hitlerbild vielleicht einen schönen Rahmen?« Veras Pragmatismus verblüfft Milan Pálka für Sekunden, doch ehe er etwas sa¬gen kann, wird von außen heftig an die Schaufensterscheibe geklopft, und ein Mäd¬chen steckt den Kopf zur Tür herein. »Milan, du musst kommen! Schnell! Wegen Anna!« Die Kleine streift Vera mit einem schnellen Seitenblick, sieht den Mann wieder beschwörend an. »Verdammt! Ausgerechnet jetzt. Wissen Sie, ich hab gehört, es ist ein Bus ange¬kommen aus Holland! Holland! Das könnt was bringen. – Zatračeně!« Wütend zieht er den Schlüssel aus der Kasse, bedeutet Vera zu gehen, hält dann aber wieder ein. »Äh, prosím, haben Sie vielleicht bisschen Zeit? Könnten Sie halbe Stunde auf meinen Laden aufpassen? Bitte!« »Was? Ich?«’ »Ich bitte sehr! Preise stehen am Boden von Sachen. Mehr Ware steht in Kammer nebenan. Ich danke Ihnen sehr. Ich bin sofort wieder da. Ein paar Minuten nur!« Das gibt’s doch nicht. Immerhin hat er die Registrierkasse abgeschlossen, sein Vertrauen hält sich also in vernünftigen Grenzen, denkt Vera, während sie durch die Schaufenster-scheibe dem davonlaufenden Mann und dem Kind nach-sieht. Das gibt’s doch nicht! Jetzt stehe ich hier als deut¬sche Verkäuferin in einem tschechi¬schen Gläser-Shop, der einmal ein deutscher Bonbonladen war, dessen Besitzer verschwunden ist und der nicht mal das Bild von seinem ver¬ehrten Führer mitnehmen konnte, so schnell musste alles gehen ... Ein Bonbonladen. Sie sieht sich mit einem Tütchen voll herrlich gestreifter Bonbons, weiß-rosa, grün-weiß, über die Brücke am Bud¬weiser Tor glücklich nach Hause rennen. Sie glaubt, noch den kühlen Pfeffer¬minz¬geschmack im Mund zu spüren. Hat sie sie vielleicht hier gekauft? Aber auch etwas Unangenehmes begleitet diese Erinnerung. War es nicht verboten, in die¬sem Laden zu kaufen? Gehört jenes Bild von einem Men¬schenauflauf, zwei finster blickenden Männern in braunen Uniformen, breitbeinig, mit vor der Brust ver¬schränkten Armen links und rechts der Tür und von einem großen weißen, auf eine Fensterscheibe geschmierten Stern hierher? Ähnlich wie in ihrer Galerie in Heidelberg hat Vera in ihrem Vertretungsjob kaum etwas zu tun. Als Milan Pálka nach einer halben Stunde wieder auftaucht, hat Vera nur zwei relativ billige Vasen verkauft. Der erwartete Schwarm hol-ländischer Touristen hat Pálkas Laden scheinbar noch nicht gefunden. Milan sortiert die Kro¬nen in die Kasse. Sein Adamsapfel rutscht einige Male auf und ab. »Jedenfalls, vielen Dank. Wissen Sie, man hat mir gesagt, es ist schlecht, wenn Laden nicht regelmäßig geöffnet ist, gleich in erste Tage. Das hat mir ein Bekannter aus dem Westen, aus Stuttgart, geraten: Keine Unregelmäßigkeit von Öffnungs¬zeiten. Das ärgert die Kunden.« Vera gibt dem erfahrenen Bekannten lachend Recht. Sie greift nach ihrem Paket, hält dann doch wieder inne. »Darf ich fragen – ist etwas passiert?« »Meine Schwester. Anna. Sie trinkt. Sie hat gerade Nachbarin verprügelt.« Er hebt die Hände kurz an die Stelle zwischen Kiefer und Ohr und lässt sie wieder fallen. Eine Geste, die sie noch oft bei ihm sehen wird. »Kein schönes Thema. Sprechen wir lieber von Ihnen. Wie kann ich Ihnen danken? Darf ich Ihnen etwas schenken von meinen Gläsern?« Er nimmt zwei von den Sektkelchen, die sie vorhin bewun¬dert hat, und wickelt sie in Zeitungspapier. »Sie machen Urlaub hier?« »Ja, Urlaub. Na ja, nicht direkt. Eine – Familienangelegen-heit. Ich will ein Bild suchen, ein Portrait von meiner Mut-ter.« Vera bricht ab, weil sie es auf einmal für unangebracht hält, diesem Fremden Privates zu erzählen. »So? Ein Bild wollen Sie finden?« In Milan Pálkas Stimme klingt Vorsicht. »Hier? Von Ihrer Mutter? Sie – Sie sind von hier? Sudetendeutsche?« Plötzlich herrscht gespannte Stille, während der sie sich anstar¬ren. »Ja, von hier, aus dieser Stadt. Vor vierundvierzig Jahren, fast auf den heutigen Tag genau, mussten wir gehen.« Der Händler senkt den Blick zu dem Paket auf dem Tisch, kontrolliert, ob die Gläser gut gepolstert sind. »No, Sie werden nicht mehr viel wissen von damals, so klein wie Sie waren...« Es klingt versöhnlich, ist wohl als Kompliment gedacht. »Klein? Acht Jahre immerhin. Ich weiß noch allerhand.« Noch immer ist die feindselige Stimmung zwischen ihnen fast mit den Händen zu greifen, und Vera fragt sich verwirrt, wie sie so unvermittelt entstehen konnte. Wieder ist es Milan Pálka, der sie beenden will. »Und wo wohnen Sie, wenn Sie erlauben?«, fragt er. Vera nennt ihr Hotel. »Oho! Das beste Hotel hier, natürlich. Aber teuer. Viel zu teuer! – Ich wüsste sehr schönes Pri-vatzimmer für Sie. Billig und sauber, natürlich mit Bad. Eigenes Bad und WC muss sein bei Westdeutschen, das weiß ich.« In seinem ernsten Apostelgesicht hat sich allmählich wieder Freundlichkeit aus¬gebreitet, obwohl Vera sein Angebot ablehnt. Die beiden Gläser jedoch lässt sie sich schenken als Erinnerung an ihren kurzen Job in der Tschechoslowa-kei. »Ahoj, ich wünsche noch einen schönen Tag.« Der unruhige Schimmer seiner Augen und seine mit Grandezza vollführte Ver¬neigung, wobei seine Hand kurz seine linke Brust berührt, schmeicheln Vera, ver¬anlassen sie aber gleichzeitig, sich in ihr Schneckenhaus zurückzuziehen. Sie ¬greift nach dem großen Packen mit der Salatschüssel und den Gläsern und stöhnt. »Mein Gott, ist das schwer! – Sagen Sie, können Sie mir das ins Hotel bringen las¬sen? Ich wollte noch ein bisschen herumlaufen, aber damit wird’s schwierig!« Milan Pálka grinst. Ja, natürlich, er wird das Paket von sei-nem Laufburschen ins Hotel bringen lassen, gleich heute noch. Erst später wird Vera klar werden, dass der Laufbur-sche er selbst ist. Sie kramt in ihrer Handtasche und legt ihre Visi¬tenkarte auf den Tresen. »Vielen Dank also. Ahoj, pane Pálka.« »Auf Wiedersehen, Frau – Jakobi. Páni Jakobová!«, ruft der Mann ihr nach, ihre Visitenkarte in der Hand. Ein Kinderlied summend spaziert Vera an die Moldau hin-unter, die dreifach ge¬staffelten Bögen der Mantelbrücke des Schlosses, die hoch oben eine steile, enge Schlucht über-spannt, vor Augen. Aus einem unerfindlichen Grund hat man an die¬sem Verbindungsstück mit der Renovierung des Schlosses be¬gonnen, durch den frischen weißen Putz sitzt es jetzt wie ein leuchtender Fremdkörper zwischen den sich beidseitig anschließenden Gebäuden mit ihrer verrußten, geplatzten Schimmelhaut, die typisch für die ganze Stadt ist. Auf der Latránbrücke über dem Fluss angekommen, erstirbt das Lied, und ihre Füße werden schwer. Dort vorn braust das Wehr, die vergessenen Bilder steigen aufs Neue aus den Was¬sern. »Wenn sie uns nach Sibirien deportieren, nehm’ ich euch zwei und spring in die Moldau!«, hatte Mutter damals ge-schrien. Die aufgerissenen Augen der beiden kleinen Mäd-chen beachtete sie nicht. Die Locken ihres Bubikopfs flo-gen, die grünen Augen sprühten, der kräftige Körper bebte. Hier, genau an dieser Stelle, wo das Wasser tief und schäumend vom Wehr heranschießt, hatte sich Vera angstvoll ausgemalt, würde die Mutter ihr mörderisches Vorhaben aus¬führen. Aber nein, schwor sie sich damals, sie würde nicht in diesem stinkenden Fluss enden! Sie würde rechtzeitig der Mutter entkom¬men. Aber sie entkam ihr nicht. Mit gesenktem Kopf macht Vera kehrt. Ein Spaziergang am Ufer entlang zurück zur vertrauten Fischergasse reizt sie nicht mehr. Ohne noch einmal in die Tiefe zu blicken oder – wie in Kindertagen – hinunter zu spucken, verkriecht sie sich in den Gassen der Altstadt.
| Erscheinungsdatum | 23.02.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Grafenau |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 125 x 190 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Schlagworte | Brabetz Gerti • Das falsche Bild • Ohetaler Verlag |
| ISBN-10 | 3-95511-186-5 / 3955111865 |
| ISBN-13 | 978-3-95511-186-1 / 9783955111861 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich