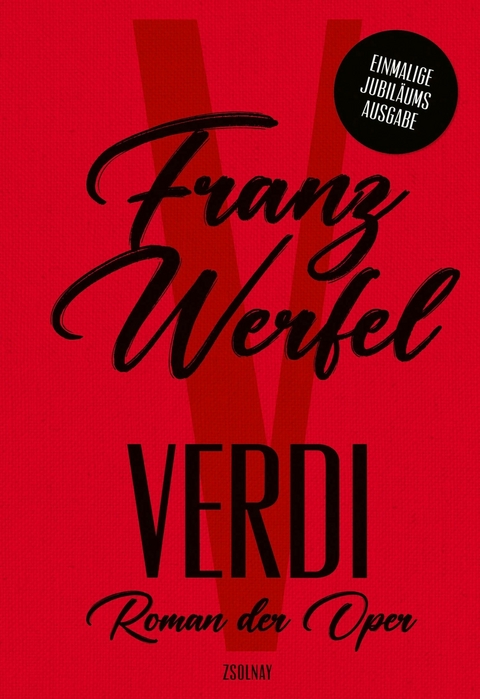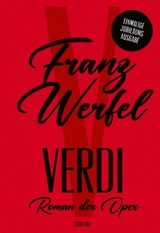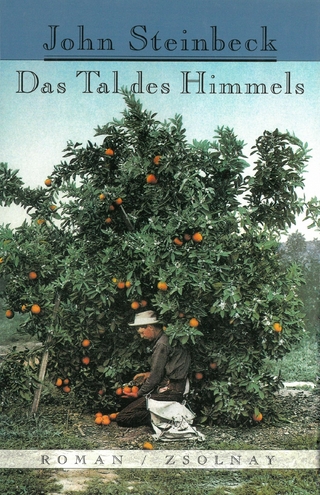Verdi (eBook)
480 Seiten
Paul Zsolnay Verlag
978-3-552-07420-0 (ISBN)
Mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit Verdis Oper 'Aida' Der Maestro steckt in einer Schaffenskrise, während dem gleichaltrigen Richard Wagner von Bayreuth bis Italien das Publikum zujubelt. Den Konflikt zwischen den beiden Großmeistern, die einander in Wirklichkeit nie begegnet sind, wählt Franz Werfel als Thema für seinen ersten großen Roman, den er in Venedig unmittelbar vor Wagners Tod im Februar 1883 ansiedelt.
Seine Leidenschaft für das Südliche, für Italien, seine Verachtung für das kühle Nördliche lässt Werfel in diesem Künstlerroman, den er innerhalb weniger Monate 1923/24 niederschreibt, deutlich spüren. 'Verdi' begründete letztlich seinen Ruhm als einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Generation. Im April 1924 erscheint es als erstes Buch des neuen Zsolnay Verlags und wird prompt zu einem Bestseller.
Franz Werfel wurde 1890 in Prag geboren und starb 1945 im Exil in Los Angeles. Er trat zuerst als Lyriker (u.a. in der 'Fackel') hervor, ehe er sich dem Drama und der Prosa zuwandte. 1917 begegnete er Alma Mahler-Gropius, die er 1929 heiratete. 1933 wurden seine Bücher von Nationalsozialisten verbrannt, nach dem 'Anschluss' Österreichs begann seine Emigration, die ihn 1940 über die Pyrenäen nach Spanien und weiter in die USA führte. Sein Werk umfasst alle Gattungen, zu seinen bekanntesten Büchern zählen 'Der Abituriententag' (1928), 'Die vierzig Tage des Musa Dagh' (1933) und 'Das Lied von Bernadette' (1941).
Glockengeläute hatte unsre Gondeln zum Saal begleitet, in der Stille glitten wir zurück …
Aus Glasenapps Wagner-Biographie
Der unirdische Monddunst dieser lau-bezaubernden Weihnacht drang durch das Wasserportal des Fenicetheaters und verklärte die finstere Mündung des langen Ganges, der vorwärts zum erleuchteten Foyer führte. An der grünspanigen Mauer, unbewegt in der Schwärze des Kanals, ein wenig abseits von Treppe und Pflöcken, ruhten einige Gondeln entlang des Fondamento.
Die Ruderer, die zuerst meinten, es gebe eine Oper zu hören, und die ihren Herrschaften nachgeschlichen kamen, um durch einen Türspalt oder gar auf unbezahlten Stehplätzen den Gesang zu genießen, waren enttäuscht worden. Das Orchester da drinnen — alle Musiker in schwarzer Parade — machte eine endlose, langweilige Musik. Und diese Musik wurde vor nicht mehr als fünfzehn Menschen gelärmt. Wusste man nichts Besseres aufzuführen, jetzt, im Dezember, zur Zeit der Stagione?
Die Gondelführer saßen längst schon in einer der Tavernen auf dem Campo del Teatro. Einer von ihnen stand von Zeit zu Zeit immer auf, um nachzusehen, ob die Geschichte nicht schon zu Ende sei. Im übrigen waren sie nicht um Musik betrogen. In der offenen Tür der Nachbarschenke hatte ein Invalide in vergilbter vergessener Uniform Platz genommen und ein kleines Cello mit hohem Stachel zwischen die Knie gestemmt. Unter seinem Bogen beklagte dieses mittelalterliche Bettel-Instrument, das sich auf irgendeinem geheimnisvollen Wege in unsere Zeit verirrt hatte, sein trübes Schicksal. In der Taverne, wo die Wartenden lachten und stritten, produzierte sich ein Paar von Straßensängern: der Knabe mit seiner Mandoline und eine blinde Alte mit schrecklichen Augenhöhlen und einer hellstechenden Tenorstimme. Dazu kam, dass fast alle Leute, die über den Platz gingen, einen Melodieteil sangen, summten, grölten, pfiffen, dass liederliche Aufschreie, Rufe, Gelächter aus plötzlich sich öffnenden und zuschlagenden Türen brachen und dass jede Viertelstunde von allen Türmen herab die in dieser Nacht heilig erregten Glockenfluten auf die Stadt Venedig stürzten.
Über dem Hauptportal des so großen, so reizenden Theaters, das in Blau und Gold das Wappen des singenden Schwanes schmückt, brannten die Gasflammen in den beiden gewaltigen Milchglaskugeln. Das goldene Gitter war halb geschlossen. Kein Betresster stand davor, und auch die Kolporteure der Textbücher, die sonst wütend zu Beginn der Vorstellung und während der Pausen ihr »Libri dell’ opera! Libri dell’ opera!« der ungerührten Kirche gegenüber an den Kopf werfen, fehlten bei der heutigen Veranstaltung.
Das große Foyer mit seiner zu den Logengängen emporsteigenden Marmorfreitreppe strahlte in den vielfachen Lichtgraden der offenen, in Schalen und hinter Gitterkäfigen brennenden Flammen.
Übertriebenes Schlagschattendunkel war über die beiden Nischen geworfen, in denen rechts ein weißer Empireofen, links der gutmütig-höhnische Riesenkopf G. Rossinis (»von der Gesellschaft im Jahre 1869 gestiftet«) die Dinge und Zeiten ertrugen.
Zwei Damen in höchster Eleganz, mit einem mantilleartigen Schleier über dem auffrisierten Kopf — als gelte es die Papstmesse zu besuchen —, standen verwirrt und unschlüssig im Raum. Oh, wie ruhig betraten sie sonst dieses Haus, wenn der erste Akt schon seinem Ende zuging, da Verspätung doch gute Manier der Vornehmen ist. Heute aber flüsterten sie erregt und pressiert miteinander, drängten sich gegenseitig vom Spiegel weg, zupften die Locken, tupften die Wangen, wiegten sich in den Hüften und verschwanden, da niemand sie hinderte, ihre weitläufigen Röcke raffend, über die Treppen im ersten Stockwerk der Logen.
Jetzt war das feierlich-lichte Foyer ganz leer, das Büfett im Hintergrund unbewacht, obwohl man darauf eine ziemliche Reihe von Champagnergläsern und einige Schüsseln mit glanzvoll ausgebotenen Speisen bemerken konnte. Deutlich durchfauchte das Gaslicht die tiefe Stille. Nur dann und wann drang durch die dickgepolsterten Türen des Saals das Tutti des Orchesters: einzelne grimmige Akkorde, wie wenn in einem Nebenraum ein unhörbares Gespräch plötzlich zum Streit wird und aufbegehrend trotzige Worte fallen.
Der lange Gang hingegen, der vom Vestibül des Theaters zum Canal la Fenice führt, war nur von drei Petroleumlampen über den Notausgängen erhellt. Er lief dunkel den Riesenkörper des Zuschauer- und Bühnensaals entlang, der wie ein Meerschiff im Dock zu hängen schien. Zwei kleine Stiegen führten zu Eingangstüren empor, aus deren runden Fensterchen das grünlich-gelbe Festlicht mit den Strahlen eines Sommernachmittags ins Dunkel lugte. Durch Gucklöcher konnte man auch die Konstruktion der Unterbühne betrachten, wo beim Schein einer abgeblendeten Laterne der Feuerwächter der apathischen Trauer seines Berufs nachhing.
In dem dämmrigen Gang patrouillierte mit tönendem Schritt ein alter Mensch in der dunkelgrünen Livree des Theaterbediensteten. Er trug den weißen ausgeschnittenen Bart der kaiserköniglich österreichischen Zeit, der eigens erfunden worden war, um ein Stück Brust für gewisse Orden und Ehrenzeichen frei zu lassen. Diese Barttracht war hier unter alten Leuten keine Seltenheit, denn man schrieb das Jahr 1882, und nicht viel mehr als ein Jahrzehnt seit Befreiung Venetiens und seit der Einigung des Königsreichs war vergangen.
Der Alte hielt ein erregt düsteres Selbstgespräch. Er schien mit seinem heutigen Dienst übel zufrieden zu sein. Immer wieder schritt er schallend auf und ab, als hätte er es darauf angelegt, sich durch Widerspruch zur Geltung zu bringen, den Leuten im Saal zu zeigen, dass er auf seinem Posten sei, und übrigens in uneingestandener Bosheit das Spiel zu stören. Plötzlich hob er den Kopf, seine schon etwas gebeugte Gestalt bekam Gewicht, er ging mit jener Amtslangsamkeit, mit der sich der Polizist ruhig an die Stätte eines Vergehens begibt, einem Herrn entgegen, der den Gang gemächlich herankam.
»Kein Zugang heute! Der Eintritt verboten! Es findet hier eine private Feierlichkeit statt!«
Der also abgefertigte Herr trug einen dunkelbraunen Überrock und hielt seinen schwarzen Schlapphut in der Hand. Er blieb ruhig vor dem Livrierten stehn und sah ihn mit langsamen, sehr blauen, etwas feuchten Augen an, deren Blick erst aus der Ferne zurückgeholt werden musste. Dieser Augen abwesendverträumte Kühnheit war von der stark vorspringenden Stirnwölbung überdunkelt und drückte nicht Ärger, sondern nur eine leichte Verwunderung aus, dass jemand diesen Einspruch gewagt hatte. Obgleich der natürlich gewachsene, kurze Bart fast schon durchwegs weiß, das weiche, noch jünglingshaft-dichte Haar — es fiel in schöner Locke über ein großes, gleichsam gierig geöffnetes Ohr —, obgleich dieses Haar schon mehr als grau war, wäre es doch niemandem eingefallen, zu sagen, der Mann sei alt.
Dem widersprach die nicht allzu kleine, ökonomisch wie ein Geigenkörper gebaute Gestalt mit ihren kräftigen und dabei fast zierlichen Gliedern. Sie stak mit ruhig atmender Gelassenheit in den Kleidern und bewies dadurch zehnfach mehr des alten Mannes Jugend, als es jede aufgereckte Straffheit vermocht hätte. Eine große, sehr gebogene sonnverbrannte Nase, ein ganzes System von Falten und Fältchen um die Augen, die von Zeit zu Zeit auch im Dunkel wie von einer unsichtbaren Sonnenblendung zusammengekniffen wurden, gaben diesem Gesicht die wechselnde Miene eines Bauern, der im weiten Abendstrahl sein Land betrachtet, den großen Ausdruck eines verwegenen Piraten, der von seiner Klippe aufs Meer hinausblickt, meist aber die Ruhe eines vornehmen Mannes, der alle Zweifel überwunden und keine Mühe mehr hat, seines Wertes sich bewusst zu sein.
Die Götter, deren Attribut die ewige Jugend ist, wurden keineswegs immer als Jünglinge, viel öfter als reife, ältere Menschen dargestellt: Jupiter, Neptun und Vulkan! Auch auf diesem Gesicht war das Alter nichts als eine schön verwandelte Form der göttlichen Jugend und Zeitlosigkeit.
Der Herr, nachdem er in seiner abwesenden Art den Bediensteten lange und langsam betrachtet hatte, schickte sich an, weiterzugehen.
Der andere wurde strenger: »Der Eintritt ist verboten! Es findet im Theater eine Feierlichkeit statt!«
Der Herr lächelte mit den fein ausstrahlenden Fältchen um seinen Aug ein reizendes ...
| Erscheint lt. Verlag | 18.3.2024 |
|---|---|
| Nachwort | Jens Malte Fischer |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Klassiker / Moderne Klassiker |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | 19. Jahrhundert • Alma Mahler • Bayreuth • Bestseller • Bibliophil • Italien • Jens Malte Fischer • Klassiker • Österreich • Richard Wagner • Sonderausgabe • Venedig |
| ISBN-10 | 3-552-07420-1 / 3552074201 |
| ISBN-13 | 978-3-552-07420-0 / 9783552074200 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich