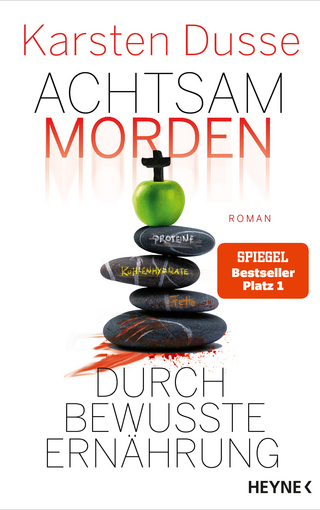Die Erben des Medicus
Goldmann Verlag
978-3-442-45929-2 (ISBN)
- Titel erscheint in neuer Auflage
- Artikel merken
Noah Gordon wurde 1926 in Massachusetts geboren. Nach dem Studium wandte er sich dem Journalismus zu und arbeitete als wissenschaftlicher Redakteur beim Bostoner "Herald". Er hat drei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in Brookline, Massachusetts.
Klaus Berr, geb. 1957 in Schongau, Studium der Germanistik und Anglistik in München, einjähriger Aufenthalt in Wales als 'Assistant Teacher', ist der Übersetzer von u.a. Lawrence Ferlinghetti, Tony Parsons, William Owen Roberts, Will Self.
Der Rückschlag Eine Unterredung R. J. wachte auf. Ihr Leben lang würde sie immer wieder mitten in der Nacht die Augen aufschlagen und mit der beklemmenden Gewißheit in die Dunkelheit starren, noch eine überarbeitete Assistenzärztin am Lemuel Grace Hospital in Boston zu sein, die sich während einer Sechsunddreißig-Stunden-Schicht in einem leeren Krankenzimmer ein kurzes Nickerchen erschlichen hat. Sie gähnte, während die Gegenwart in ihr Bewußtsein sickerte und ihr zu ihrer großen Erleichterung dämmerte, daß die Assistenzzeit schon Jahre zurücklag. Aber sie verschloß sich vor der Wirklichkeit, denn die Leuchtzeiger ihres Weckers sagten ihr, daß sie noch zwei Stunden liegenbleiben durfte, und in dieser längst vergangenen Assistenzzeit hatte sie gelernt, jede Minute Schlaf zu nutzen. Zwei Stunden später wurde sie, bei grauer Morgendämmerung und diesmal ohne Schrecken, wieder wach und schaltete den Wecker aus. Sie wachte immer auf, kurz bevor er klingelte, trotzdem stellte sie ihn regelmäßig am Abend zuvor, für alle Fälle. Aus dem Massageduschkopf trommelte ihr das Wasser fast schmerzhaft auf den Schädel, was so belebend war wie eine zusätzliche Stunde Schlaf. Die Seife glitt über einen Körper, der ein wenig fülliger war, als sie es für erstrebenswert hielt, und sie wünschte sich, sie hätte Zeit zum Joggen, doch die hatte sie nicht. Während sie sich die halblangen schwarzen, noch immer dichten und kräftigen Haare fönte, begutachtete sie ihr Gesicht. Ihre Haut war glatt und rein, die Nase schmal und etwas lang, der Mund groß und voll. Sinnlich? Groß, voll und seit langem ungeküßt. Sie hatte Ringe unter den Augen. »Also, was willst du, R. J.?« fragte sie barsch die Frau im Spiegel. Tom Kendricks auf jeden Fall nicht mehr, sagte sie sich. Da war sie ganz sicher. Was sie anziehen wollte, hatte sie sich schon vor dem Zubettgehen überlegt, und die Sachen hingen nun an der einen Seite des Schranks: eine Bluse und eine maßgeschneiderte Bundfaltenhose, darunter standen attraktive, aber bequeme Schuhe. Vom Gang aus sah sie durch die offene Tür zu Toms Schlafzimmer, daß der Anzug, den er tags zuvor getragen hatte, noch immer am Boden lag, wie er ihn am Abend hingeworfen hatte. Er war früher aufgestanden als sie und hatte das Haus schon lange verlassen, denn er mußte bereits um sechs Uhr fünfundvierzig mit desinfizierten Händen im Operationssaal sein. Unten goß sie sich ein Glas Orangensaft ein und zwang sich, es langsam zu trinken. Dann zog sie ihren Mantel an, nahm ihre Aktentasche und ging durch die unbenutzte Küche zur Garage. Der kleine rote BMW war ihre Schwäche, so, wie das herrschaftliche alte Haus die von Tom war. Sie mochte das Schnurren des Motors und die reaktionsfreudige Präzision des Lenkrads. Während der Nacht hatte es leicht geschneit, aber die Räumkolonnen von Cambridge hatten gute Arbeit geleistet, und nachdem sie den Harvard Square und den JFK Boulevard passiert hatte, kam sie problemlos vorwärts. Sie schaltete das Radio an und hörte Mozart, während sie sich von der Flut des Verkehrs den Memorial Drive hinuntertreiben ließ, dann überquerte sie auf der University Bridge den Charles River zur Bostoner Seite. Trotz der frühen Morgenstunde war der Personalparkplatz des Krankenhauses schon fast voll besetzt. Sie stellte den BMW neben einer Wand ab, um das Risiko einer Beschädigung durch die nachlässig geöffnete Tür eines Nachbarn zu verringern, und betrat mit raschen Schritten das Gebäude. Der Wachmann nickte. »Mor’n, Dokta Cole!« »Hallo, Louie!« Im Aufzug grüßte sie einige Leute. Im dritten Stock stieg sie aus und ging schnell zu Zimmer 308. Wenn sie morgens zur Arbeit kam, war sie immer sehr hungrig. Sie und Tom aßen höchst selten mittags oder abends zu Hause, und gefrühstückt wurde nie; der Kühlschrank war leer bis auf Saft, Bier und Limonade. Vier Jahre lang war R. J. jeden Morgen in die überfüllte Cafeteria gegangen, aber dann war Tessa Martula ihre Sekretärin geworden und hatte darauf bestanden, für R. J. das zu tun, was sie für einen Mann mit Sicherheit nie getan hätte. »Ich gehe mir ohnedies meinen Kaffee holen, da wäre es doch unsinnig, wenn ich Ihnen keinen mitbringe!« hatte Tessa gesagt. So zog R. J. jetzt nur einen frischen weißen Mantel an und begann sofort, die Krankengeschichten zu lesen, die auf ihrem Schreibtisch lagen. Sieben Minuten später wurde sie dafür belohnt mit dem Anblick Tessas, die ihr auf einem Tablett ein getoastetes Brötchen mit Frischkäse und starken schwarzen Kaffee brachte. Während sie ihr Frühstück verdrückte, kam Tessa mit dem Terminkalender zu ihr, und sie gingen ihn gemeinsam durch. »Dr. Ringgold hat angerufen. Er will Sie sehen, bevor Sie mit der Arbeit anfangen.« Der medizinische Direktor hatte ein Eckbüro im vierten Stock. »Gehen Sie gleich durch, Dr. Cole! Er erwartet Sie«, sagte seine Sekretärin. Dr. Sidney Ringgold nickte, als sie eintrat, deutete auf einen Stuhl und schloß dann die Tür. »Max Roseman hatte gestern während der Konferenz über Infektionskrankheiten an der Columbia einen Schlaganfall. Er liegt im New York Hospital.« »Ach, Sidney, der arme Max! Wie geht es ihm?« Er zuckte die Achseln. »Er wird’s überleben, aber es könnte ihm bessergehen. Zunächst einmal Lähmung und Gefühlsstörung in der kontralateralen Gesichtshälfte, im Arm und im Bein. Wir werden sehen, was die nächsten Stunden bringen. Jim Jeffers war eben so freundlich, mich aus New York anzurufen. Er meinte, er werde mich auf dem laufenden halten, aber es wird wohl lange dauern, bis Max wieder zum Dienst kommt. Und offen gesagt, bei seinem Alter bezweifle ich, ob er je wieder zurückkommt.« Plötzlich hellhörig geworden, nickte R. J. Max Roseman war stellvertretender medizinischer Direktor. »Jemand wie Sie, eine gute Ärztin mit diesem juristischen Hintergrund, würde als Max’ Nachfolgerin dem Fachbereich neue Dimensionen eröffnen.« Sie hatte nicht den Ehrgeiz, stellvertretender Direktor zu werden, war das doch ein Posten, der trotz großer Verantwortung nur begrenzte Macht bot. Es war, als hätte Sidney Ringgold ihre Gedanken gelesen. »In drei Jahren bin ich fünfundsechzig, dann schicken sie mich in Pension. Der stellvertretende medizinische Direktor wird bei der Nachfolge gegenüber allen anderen Kandidaten einen enormen Vorteil haben.« »Sidney, bieten Sie mir den Posten an?« »Nein, das tue ich nicht, R. J. Ich werde noch mit einigen anderen über die Stelle reden. Aber Sie wären eine aussichtsreiche Kandidatin.« R. J. nickte. »Das ist fair. Danke, daß Sie es mir gesagt haben.« Sein Blick hielt sie in ihrem Stuhl fest. »Noch etwas anderes«, sagte er. »Ich trage mich schon lange mit dem Gedanken, daß wir einen Publikationsausschuß haben sollten, der unsere Ärzte ermutigt, mehr zu schreiben und zu publizieren. Ich hätte es gern, wenn Sie ihn einrichten und den Vorsitz führen würden.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann wirklich nicht«, erwiderte sie bestimmt. »Ich muß jetzt schon kämpfen, um mit all meinen Terminen zurechtzukommen.« Es stimmte; und er müßte das eigentlich wissen, dachte sie leicht verstimmt. Montags, dienstags, mittwochs und freitags kümmerte sie sich um ihre Patienten hier im Krankenhaus. Dienstag vormittags hielt sie im Massachusetts College auf der anderen Straßenseite einen zweistündigen Kurs über die Vermeidung iatrogener Leiden, also Krankheiten oder Verletzungen, die von einem Arzt oder im Krankenhaus verursacht werden. Mittwoch nachmittags hielt sie an der Medical School eine Vorlesung über die Vermeidung von und das Verhalten bei Kunstfehlerprozessen. Donnerstags führte sie an der Family Planning Clinic in Jamaica Plain Ersttrimester-Abtreibungen durch. Freitag nachmittags arbeitete sie in der PMS-Clinic, einer Ambulanz zur Behandlung des prämenstruellen Syndroms, die wie der Kurs über iatrogene Leiden auf ihr Drängen hin und gegen den Widerstand einiger konservativerer Kollegen ins Leben gerufen worden war. Ihr und Sidney war klar, daß sie in seiner Schuld stand. Der medizinische Direktor hatte ihre Projekte und ihre Karriere trotz politischer Opposition gefördert. Anfangs hatte er ihre Aktivitäten mit leichtem Argwohn verfolgt – eine Anwältin, die Ärztin geworden war, Expertin für Krankheiten, die durch Fehler von Ärzten und in Krankenhäusern verursacht wurden, jemand, der die Arbeit von Kollegen begutachtete und bewertete und diese oft viel Geld kostete. Am Anfang hatten einige Ärzte sie »Doktor Petze« genannt, doch diesen Spitznamen trug sie mit Stolz. Der medizinische Direktor hatte beobachtet, wie Dr. Petze sich behauptete und vorwärtskam und schließlich zu Dr. Cole wurde, einer Ärztin, die man akzeptierte, weil sie ehrlich und zäh war. Inzwischen waren sowohl ihre Vorlesungen als auch ihre Übungen politisch korrekt, ja Einrichtungen von solchem Ruf, daß Sidney Ringgold viel Lob für sie einstecken konnte. »Vielleicht könnten Sie bei etwas anderem kürzertreten?« Beide wußten, daß er die Donnerstage in der Family Planning Clinic meinte. Er beugte sich vor. »Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das übernehmen würden.« »Ich werde gründlich darüber nachdenken, Sidney.« Diesmal schaffte sie es, vom Stuhl aufzustehen. Auf dem Weg hinaus ärgerte sie sich über sich selbst, weil sie merkte, daß sie schon jetzt überlegte, wer wohl die anderen auf seiner Kandidatenliste sein könnten. Das Haus an der Brattle Street Schon vor ihrer Heirat hatte Tom versucht, R. J. zu überreden, die Kombination von Jura und Medizin zur Optimierung ihres Jahreseinkommens auszunutzen. Als sie sich gegen seinen Rat von der Jurisprudenz abwandte und sich ganz auf die Medizin konzentrierte, hatte er sie gedrängt, in einem wohlhabenden Vorort eine Privatpraxis zu eröffnen. Während sie dann über den Kauf des Hauses verhandelten, hatte er über ihr Krankenhausgehalt gemeckert, das fast fünfundzwanzig Prozent niedriger war als der Ertrag, den eine Privatpraxis gebracht hätte. Für ihre Hochzeitsreise hatten sie sich die Virgin Islands ausgesucht, eine Woche auf einer kleinen Insel in der Nähe von St. Thomas. Schon zwei Tage nach ihrer Rückkehr fingen sie an, sich nach einem Haus umzusehen, und am fünften Tag ihrer Suche führte sie eine Immobilienmaklerin zu einem vornehmen, aber heruntergekommenen Haus an der Brattle Street im Stadtteil Cambridge. R. J. zeigte nur geringes Interesse. Das Haus war zu groß, zu teuer, zu renovierungsbedürftig, und die Straße war viel zu befahren. »Es wäre verrückt.« »Nein, nein, nein«, murmelte er. Wie sie sich später erinnerte, sah er an diesem Tag sehr attraktiv aus in seinem wunderbar geschnittenen neuen Anzug und mit den strohblonden Haaren im Designerschnitt. »Es wäre überhaupt nicht verrückt.« Tom Kendricks sah ein stattliches georgianisches Haus an einer anmutigen, geschichtsträchtigen Straße mit ziegelgepflasterten Bürgersteigen, über die Dichter und Philosophen geschritten waren, Männer, von denen man in den Schulbüchern liest. Eine halbe Meile nördlich an dieser Straße stand das herrschaftliche Anwesen, in dem Henry Wadsworth Longfellow gewohnt hatte. Kurz dahinter kam die Divinity School. Tom war bereits »bostonerischer« als Boston selbst, sein Akzent stimmte haargenau, seine Kleidung ließ er sich bei »Brooks Brothers« schneidern. Tatsächlich aber war er ein Farmerjunge aus dem Mittleren Westen, der die Bowling Green University und die Ohio State besucht hatte und den der Gedanke, in der Nachbarschaft von Harvard zu leben, ja beinahe Teil von Harvard zu sein, faszinierte. Und dieses Haus hatte es ihm angetan: die Backsteinfassade mit Verzierungen aus Vermont-Marmor, die hübschen schlanken Säulen neben den Türen, die geschliffenen Glasscheiben neben und über dem Portal und die zu allem passende Ziegelmauer um das Grundstück. Erst dachte sie, er mache nur Spaß. Als deutlich wurde, daß er es ernst meinte, war sie entsetzt, und sie versuchte, ihm das Ganze auszureden. »Das wird doch viel zu teuer! Haus und Mauer müssen neu verfugt, Dach und Fundament saniert werden. Und das Maklerbüro gibt unumwunden zu, daß ein neuer Heizkessel benötigt wird. Es ist Unsinn, Tom.« »Aber ganz im Gegenteil. Das Haus ist wie geschaffen für zwei erfolgreiche Ärzte. Als Ausdruck ihres Selbstbewußtseins.« Weder er noch sie hatten viel gespart. Da R. J. einen Juraabschluß gemacht hatte, bevor sie das Medizinstudium begann, konnte sie nebenbei etwas Geld verdienen, und zwar so viel, daß sie ihre medizinische Ausbildung abschließen konnte, ohne große Schulden machen zu müssen. Aber Tom hatte bereits Schulden in beängstigender Höhe. Trotzdem argumentierte er hartnäckig, daß sie das Haus kaufen sollten. Er erinnerte sie daran, daß er als Chirurg inzwischen sehr gut verdiente, und beharrte darauf, daß sie sich das Haus leicht würden leisten können, wenn sie ihr geringeres Gehalt zu dem seinen rechneten. Er wiederholte es immer und immer wieder. Sie waren frisch verheiratet, und sie war noch vernarrt in ihn. Er war als Mensch nicht so gut wie als Liebhaber, aber das wußte sie damals noch nicht, und sie hörte ihm ernst und beeindruckt zu. Schließlich gab sie verwirrt nach. Sie gaben eine stattliche Summe für die Einrichtung aus, darunter Antiquitäten und Beinaheantiquitäten. Auf Toms Drängen kauften sie einen Stutzflügel, weniger, weil R. J. Klavier spielte, sondern weil er perfekt ins Musikzimmer paßte. Ungefähr einmal im Monat kam R. J.s Vater mit dem Taxi in die Brattle Street und gab dem Fahrer ein großzügiges Trinkgeld, damit er ihm seine sperrige Gambe ins Haus trug. R. J.s Vater war froh, daß sie etabliert war, und sie spielten lange, gefühlvolle Duette. Die Musik überdeckte viele Schrammen, die von Anfang an da waren, und ließ das große Haus weniger leer erscheinen. Da sie und Tom fast immer außer Haus aßen, hatten sie keine feste Hausangestellte. Eine schweigsame schwarze Frau namens Beatrix Johnson kam montags und donnerstags und hielt das Haus sauber, wobei sie nur selten etwas zerbrach. Ein Gärtnerservice kümmerte sich um Rasen und Bepflanzung. Sie hatten kaum Gäste. Kein Schild an der Mauer ermutigte Patienten, durch das Gartentor zu treten. Der einzige Hinweis auf die Bewohner waren zwei kleine Kupferschildchen, die Tom am rechten Pfosten des hölzernen Türstocks befestigt hatte. THOMAS ALLEN KENDRICKS, M. D. UND ROBERTA J. COLE, M. D. Damals nannte sie ihn noch Tommy. Nach ihrer Unterredung mit Dr. Ringgold machte sie ihre Morgenvisite. Leider hatte sie nie mehr als ein oder zwei Patienten auf den Stationen. Sie war Allgemeinärztin mit einem speziellen Interesse für hausärztliche Belange in einem Krankenhaus, das keine allgemeine Abteilung hatte. Das machte sie zu einem Hansdampf in allen Gassen, einem Allroundspieler ohne spezielle Klassifikation. Ihre Tätigkeit für das Krankenhaus und die Medical School war keiner speziellen Abteilung zuzuordnen; so untersuchte sie zwar Schwangere, doch jemand aus der Geburtshilfeabteilung brachte die Babys zur Welt, und ebenso überwies sie ihre Patienten fast immer an einen Chirurgen, einen Gastroenterologen oder an einen anderen der mehr als ein Dutzend Fachärzte. Meistens sah sie den Patienten nie wieder, denn die Nachfolgebehandlung wurde von dem Spezialisten oder dem jeweiligen Hausarzt übernommen, und normalerweise kamen ins Krankenhaus ohnedies nur Patienten mit Problemen, die eine hochentwickelte Technik erforderten. Früher hatten Oppositionsgeist und das Gefühl, Neuland zu erschließen, ihren Aktivitäten am Lemuel Grace Hospital Würze verliehen, aber inzwischen hatte sie keine rechte Freude mehr an ihrer ärztlichen Arbeit. Sie verschwendete viel zuviel Zeit damit, Versicherungsformulare zu prüfen und auszufüllen – ein spezielles Formular, wenn jemand Sauerstoff brauchte, ein spezielles Formular für dies, ein spezielles Kurzformular für das, in zweifacher, in dreifacher Ausfertigung, und von jeder Versicherungsgesellschaft ein anderes Formular. Ihre Patientengespräche waren beinahe zwangsläufig unpersönlich und kurz. Gesichtslose Effizienzexperten bei den einzelnen Versicherungsgesellschaften hatten festgelegt, wieviel Zeit und wie viele Besuche den Patienten zustanden, die ohnehin schnell weitergeschickt wurden zu Laboruntersuchungen, zum Röntgen, zum Ultraschall, zur Kernspintomographie, zu all jenen Prozeduren, die den Großteil der diagnostischen Arbeit leisten und den Behandelnden vor Kunstfehlerprozessen schützen. Oft fragte sie sich, wer diese Patienten eigentlich waren, die bei ihr Hilfe suchten. Welche Umstände in ihrem Leben, die den mehr oder weniger flüchtigen Blicken des Arztes verborgen blieben, führten zu ihrer Krankheit? Was würde aus ihnen werden? Sie hatte weder die Zeit noch die Gelegenheit, ihnen als Menschen zu begegnen, für sie wirklich Ärztin zu sein. An diesem Abend traf sie sich mit Gwen Gabler in »Alex’s Gymnasium«, einem gehobenen Fitneßstudio am Kenmore Square. Gwen hatte mit R. J. die Medical School besucht und war ihre beste Freundin. Die Unbeschwertheit und das lockere Mundwerk der Gynäkologin an der Family Planning Clinic täuschten darüber hinweg, daß sie mit ihrem Leben nur mühsam zu Rande kam. Sie hatte zwei Kinder, einen Immobilienmakler zum Mann, der geschäftlich in eine Talsohle gerutscht war, dazu einen übervollen Terminkalender, beschädigte Ideale und Depressionen. Sie und R. J. kamen zweimal pro Woche ins »Alex’s«, um sich mit einer langen Aerobic-Session zu bestrafen, törichte Sehnsüchte in der Sauna herauszuschwitzen, sich fruchtlosen Frust im Whirlpool herausmassieren zu lassen, im Foyer ein Glas Wein zu trinken und den ganzen Abend zu plaudern und zu fachsimpeln. Ihr bevorzugtes Laster war das Taxieren der Männer im Club und die Beurteilung ihrer Attraktivität rein nach dem Äußeren. R. J. fand heraus, daß für ihren Geschmack ein Gesicht den Anflug von Geist verraten mußte, den Hauch von Selbstkritik, während Gwen animalischere Qualitäten bevorzugte. Sie bewunderte den Besitzer des Clubs, einen knackigen Griechen namens Alexander Manakos.
| Erscheint lt. Verlag | 11.8.2005 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Goldmann Taschenbücher | Medicus |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Matters of Choice |
| Maße | 125 x 183 mm |
| Gewicht | 342 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Literatur |
| Schlagworte | Arzt (Mediziner); Romane/Erzählungen • Arzt; Romane/Erzählungen |
| ISBN-10 | 3-442-45929-X / 344245929X |
| ISBN-13 | 978-3-442-45929-2 / 9783442459292 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich