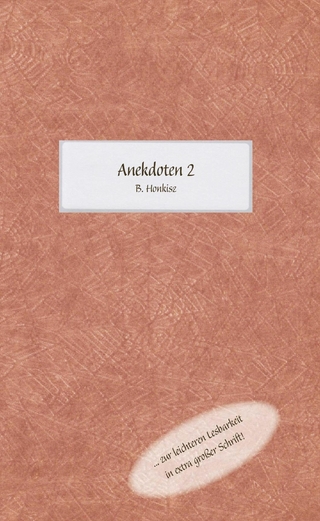Landeier (eBook)
336 Seiten
Aufbau Verlag
978-3-8412-3349-3 (ISBN)
Sebastian Kunze ist als Großstadtjournalist gescheitert. Er landet mit Frau und Tochter in der brandenburgischen Provinz, denn Melanie ist Psychotherapeutin, und auf dem Land gibt es, was sie braucht: Einen Kassensitz und therapiebedürftige Menschen. Doch die ländliche Realität zwischen Gurkenständen und Landgaststätten hält für das Paar einige Überraschungen bereit. Melanie traut sich bald kaum mehr auf die Straße - wegen all der «Bescheuerten». Sebastian hingegen lernt die Überschaubarkeit des neuen Lebens zu schätzen ...
Tom Liehr war Redakteur, Rundfunkproduzent und DJ. Seit 1998 Besitzer eines Software-Unternehmens. Er lebt in Berlin.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine Romane 'Radio Nights', 'Idiotentest', 'Stellungswechsel', 'Geisterfahrer', 'Pauschaltourist', 'Sommerhit', 'Leichtmatrosen' und 'Freitags bei Paolo' lieferbar.
Mehr zum Autor unter tomliehr.de.
Das Kruzifix schien mich zu beobachten. Es hing zwar in einer oberen Ecke des Wartezimmers und war nicht einmal besonders groß, aber der gekreuzigte Messias, der an den Händen und Füßen karmesinrot blutete, starrte mich an, als wäre er nur für mich dort angenagelt worden. Ich verspürte ein irritierendes Zwicken im Genitalbereich – das allerdings ständig, seitdem ich mich zu diesem Schritt entschlossen hatte – und versuchte, Blicke in Richtung Kreuz zu vermeiden. Religiöse Symbole interessierten mich durchaus, wenn auch nur, weil ich permanent von ihnen umgeben war. Doch dieses Ding verströmte eine unangenehme Präsenz, formulierte eine Botschaft. Ich nahm die Sonnenbrille ab – hier, in Prag, würde mich ohnehin niemand erkennen – , zog zur Ablenkung mein Smartphone aus der Tasche und checkte den aktuellen Stand meiner Facebook-Fans (sechstausendzweihundertzehn, fünfundzwanzig mehr als vor einer Woche, aber immer noch fast fünfhundert weniger als am Jahresanfang), dann die Reaktionen auf meine letzte Kolumne (Hass, Beleidigungen und Morddrohungen, Beifall von offenbar Hirntoten), konnte mich aber kaum konzentrieren und sah schließlich doch wieder in diese Ecke, die anders als die drei anderen frei von Staubfäden und abblätternder Raufasertapete war.
Dieser Jesus grinste fies.
Er grinste mich fies an.
Die Arzthelferin, eine Sechzigjährige in Birkenstocks und fleckigem Kittel, kam herein und nickte mir zu, unfreundlich und herablassend, wie der Beamte im Amtsgericht Schöneberg vor fünfundzwanzig Jahren, als ich dort gewartet hatte, um meinen Austritt aus der evangelischen Kirche zu erklären. Ich schaltete das Telefon mit zitternden Fingern auf Stand-by und folgte ihr. Es ging durch einen muffigen Flur in ein Behandlungszimmer, das, vorsichtig ausgedrückt, etwas mittelalterlich wirkte und von einem ebenfalls Sechzigjährigen beherrscht wurde, der weißhaarig und -bärtig neben einem mit braunem Kunstleder bezogenen Behandlungstisch stand, die Hände hinter dem Rücken gefaltet hatte und mich mit einer machohaften Mischung aus Desinteresse, Amüsement und Ablehnung zu betrachten schien: ein Mario-Adorf-Double für Fußgänger.
»Herr Kunze, nehmen Sie Platz«, sagte er in akzentfreiem Englisch, ohne aber meinen Namen entsprechend zu schleifen.
Ich setzte mich auf das Kunstleder und hatte plötzlich Angst, die sich zu meinem überraschend schlechten Gewissen gesellte. Schließlich war ich im Begriff, meine Frau auf eine deutlich handfestere Weise zu hintergehen, als ich das bislang je gewagt hatte.
»Wir nehmen eine örtliche Betäubung vor, der Eingriff dauert nur ein paar Minuten. Sie werden nichts davon spüren. Ich schneide in den« – für den folgenden Begriff fehlten mir die Englischkenntnisse – »und durchtrenne anschließende die« – ich vermutete, das Wort bezeichnete die Samenleiter – , »dann vernähe ich. Die Wunde wird schnell verheilen, die Fäden fallen von selbst ab. In einer Woche können Sie wieder kopulieren.« Obwohl er in einer Fremdsprache redete, in der Betonungen selten so ausfallen, wie sie in der Muttersprache ausgefallen wären, erkannte ich Geringschätzung und wiederum Ablehnung. Okay, was sollte man auch von Leuten halten, die nach Tschechien reisten, um sich für ein paar lumpige Euro sterilisieren zu lassen, während die Angetraute daheim dachte, man sei auf einer Konferenz (wie in meinem Fall), einer Kumpelstour oder Ähnlichem?
»In einer Woche«, wiederholte ich ungläubig, denn ich hatte mich über die Operation informiert und auch in einigen Internet-Foren gestöbert, was mir normalerweise fernlag, denn in Internet-Foren traf man mehr Dumme als vor Fernsehern, auf denen RTL lief. Patienten erzählten davon, noch über Monate Schmerzen verspürt zu haben, und die Lektüre von Bruno Preisendörfers Roman »Manneswehen«, der ebendiesen Eingriff thematisierte, hatte mich auf wochenlange Abstinenz und unangenehme Folgen eingestimmt. »Meine Methode ist einzigartig«, sagte der alte Arzt. Ich hatte ihn im Netz gefunden.
»Aha.« Alles hier und heute war einzigartig. Immerhin erfolgte der Eingriff nach dieser »einzigartigen« Methode ohne jede Voruntersuchung. Der Gedanke daran, irgendwo in dieser kuriosen Wohnung eine Spermaprobe abzugeben, kam mir äußerst absurd vor.
»Und billig.«
»Prima«, erklärte ich, obwohl dieser Aspekt für mich kaum von Belang war, und lauschte in den etwas zittrigen Nachhall meiner eigenen Stimme. In diesem Augenblick sah ich das Gesicht meiner Frau vor mir: das von schwarzen Haaren umrahmte, von dunkelbraunen Augen beherrschte, immer leicht – aber nie künstlich – gebräunte Gesicht von Melanie, die ich, was sie nicht mochte, gerne und durchaus liebevoll »Pocahontas« nannte. Normalerweise gelang es mir nicht, sie zu visualisieren. Jetzt schon.
»Also dann«, sagte der Mann und nickte seiner Helferin auf die gleiche Weise zu, wie die das vorher bei mir getan hatte. Vielleicht eine tschechische Eigenart. Ich sah zum Fenster, durch dessen staubgraue Gardinen ein Blick auf die Prager Burg zu erhaschen war. Die Frau zog eine Spritze auf und sah mich dann herausfordernd an, aber auch nicht eben sonderlich interessiert. Ich zog die Hosen herab, dann die Unterhosen, hob das T-Shirt über den Bauchnabel und manövrierte mich in die Rückenlage. Das Kunstleder verklebte mit meiner Gesäßhaut – legte man nicht normalerweise Abdeckungen auf die Behandlungstische?
»Rasieren Sie mich nicht?«, fragte ich. Diese Frage hatte mich im Vorfeld tatsächlich beunruhigt, weil es nur wenige plausible Erklärungen für plötzliche Schamhaarglatzen gab. Pocahontas war vielleicht manchmal ein bisschen naiv, aber sie war keineswegs dumm.
»Nicht nötig«, sagte der Arzt, während er seine Fingernägel musterte. Ich tat das auch und konnte erhebliche Verschmutzungen erkennen. Als er meinen Blick sah, lächelte er seltsam.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, murmelte er.
Darauf fiel mir keine Antwort ein. Denken Sie nicht an rosa Elefanten – das gehörte in die gleiche Kategorie. Es blieb einem nichts übrig, als intensiv an rosa Elefanten zu denken. Ich machte mir Sorgen, dachte an horrormäßige Komplikationen, abfallende Körperteile etwa oder den Verlust aller Gefühle und Funktionen im unteren Körperbereich. Plötzlich schwitzte ich, obwohl es in dieser Altbauwohnung angenehm kühl war, was nicht mit den absonderlichen Gerüchen korrelierte.
Die Helferin stach zu, in der Leistengegend, quasi direkt neben den Kronjuwelen. Ich kiekste, niemand reagierte. Kurz darauf spürte ich, wie ich nichts mehr spürte. In meinem Schrittbereich breitete sich eine Lähmung aus, von der ich wieder kurz befürchtete, sie würde meinen gesamten Körper ergreifen, aber das geschah nicht. Die Frau zog eine Art Tuch aus Krepppapier aus einer Schublade. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie das Loch im Papier so angeordnet hatte, dass sich mein Gehänge in dessen Mitte befand. Sicher gab es Leute, die bei solchen Gelegenheiten ihr Handy zückten und die Fotos in den vermeintlich sozialen Netzwerken präsentierten. Es gab in dieser Hinsicht längst nichts mehr, das es nicht gab.
»Entspannen Sie sich«, sagte der Arzt und griff nach einem Skalpell.
Ich sah zur Decke. Styroporplatten, wie man sie in den Siebzigern in Deutschland an viele Wohnzimmerdecken geklebt hatte, hier allerdings wenig fachmännisch und seit Jahren ungereinigt. Ich versuchte, versteckte Muster zu erkennen, während der alte weißbärtige Mann an mir herumschnippelte. Noch bevor ich eines fand, sagte er: »Fertig. Das war’s.« Done. That was it.
»Wie?«, fragte ich auf Deutsch, was mir im unnarkotisierten Zustand im Leben nicht eingefallen wäre. Ich verachtete Leute, die solche grammatikalisch und semantisch unkorrekten Ein-Wort-Fragesätze verwendeten. Und dann auch noch in der falschen Sprache.
»Noch zwei Stiche, und es ist erledigt.«
»Nicht zu fassen«, erklärte ich ehrlich, aber das blieb unkommentiert. Der Arzt fuhrwerkte noch einen Moment lang herum, ohne dass ich erkennen konnte oder wollte, was er genau tat, und sagte dann: »Sie können aufstehen.«
Die Helferin zog das Krepppapier weg. Ich richtete mich auf und sah mir selbst in den Schritt. Da war etwas Blut, umgeben von der rotbräunlichen Farbe, die offenbar von Jodtinktur oder Ähnlichem stammte, und ich erkannte mit etwas Mühe einen sehr kurzen Einschnitt, aus dem zwei Fädchen hervorlugten, die weißbraun und irgendwie unschuldig aussahen. Alles gut versteckt inmitten meines Schamhaars, das ich selbstverständlich nicht kappte. Wer nicht wusste, wonach er zu suchen hätte, würde das im Leben nicht entdecken.
»Das war wirklich alles?«
Er nickte völlig emotionslos. »Meine spezielle Methode. Keine Folgen, keine Komplikationen. Wie versprochen.«
»Unfassbar«, sagte ich.
»Wie so vieles«, erklärte er kryptisch und entließ mich mit einer merkwürdig endgültigen Geste. Im Wartezimmer saßen inzwischen vier Männer, die mich nur kurz zur Kenntnis nahmen, um gleich wieder das Kruzifix anzuglotzen. Ich schnappte mir meine Jacke, warf sie mir über die Schulter, setzte die Sonnenbrille wieder auf, passierte die quietschende Praxistür, sprang erstaunlich unbehindert die zwei Treppen herab und trat in die Prager Frühlingsluft. Es roch nach asiatischem Fastfood, hastig gerauchten Zigaretten und billigem Bier. Heerscharen von Touristen sahen sich suchend nach dem Weg zur Karlsbrücke um. Ich trottete zum Hotel, setzte mich an die Bar, bestellte ein Bier und wartete auf den...
| Erscheint lt. Verlag | 8.5.2023 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Comic / Humor / Manga |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Beziehungen • Brandenburg • Dorfleben • Freundschaft • Juli Zeh • Katastrophen • Konflikte • Landleben • Roman • Sommer • Unterhaltung • Unterleuten |
| ISBN-10 | 3-8412-3349-X / 384123349X |
| ISBN-13 | 978-3-8412-3349-3 / 9783841233493 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich