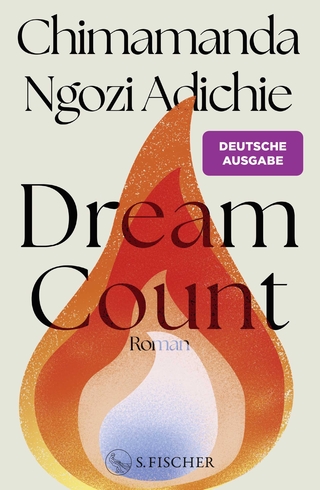Der Einundzwanzigjährige, der freiwillig in ein Pflegeheim zog und von seinen Mitbewohnern mit Demenz lernte, was Menschlichkeit bedeutet (eBook)
216 Seiten
Knaur eBook (Verlag)
978-3-426-46626-1 (ISBN)
Jeder fünfte von uns wird am Ende seines Lebens an Demenz erkranken – und womöglich in einem Pflegeheim landen. Wie aber werden wir dort leben? Dieser Gedanke trieb auch Teun Toebes, 22, um. Er ist gelernter Altenpfleger, der auf Demenzkranke spezialisiert ist. Seit er seinen Beruf gewählt hat, fragt er sich, wie alte Menschen möglichst würdevoll ihren Lebensabend verbringen können. Um noch genauer zu verstehen, wie es den Alten im Pflegeheim geht, zieht er kurzerhand dort ein und lebt mit ihnen Tür an Tür. Es entstehen wunderbare Freundschaften, aber auch Innenansichten aus dem Alltagsleben im Heim, von denen er in seinem Buch erzählt. Getragen wird Teun Toebes dabei von einer Vision, wie wir besser mit Demenzkranken umgehen und ihnen ein besseres Leben ermöglichen könnten. Denn eines Tages werden wir womöglich selbst betroffen sein.
Der inspirierende Erfahrungsbericht eines jungen Altenpflegers, der seinen Beruf leidenschaftlich lebt und liebt - und ein wertvoller Beitrag in der sich verschärfenden Pflegedebatte, auch in Deutschland
Teun Toebes (*1999) ist ausgebildeter Altenpfleger und Kämpfer für eine bessere Pflege für Menschen mit Demenz. Für sein Engagement hat er zahlreiche Preise erhalten. Er ist ein beliebter Speaker auf internationalen Konferenzen une gefragter Gesprächspartner der Medien.
| Erscheint lt. Verlag | 1.2.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Bärbel Jänicke |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Alte • Altenbetreuung • Altenhilfe • Altenpflege • Altenpflege Bücher • Altenpfleger • Altenpflegerin • Altern in Würde • Altersheim • Älter werden • Alzheimer • Alzheimer Buch • Alzheimer Demenz • Alzheimer Diagnose • Appell • bekannter Altenpfleger • Berühmt • berühmter Altenpfleger • Bestseller aus den Niederlanden • Bestseller Holland • Bestseller Niederlande • Buch • Debatte • Demenz • Demenz Betreuung • Demenz Buch • Demenz Erfahrung • Demenz Pflege • Erfahrungsberichte • Erinnerungen • Geriatrie • Gesellschaftskritische Bücher • In Würde alt werden • junger Altenpfleger • junger Pfleger • kommunikation mit demenzkranken • Medizinischer Dienst • Menschenwürde Demenz • Pflegeberufe • Pflegedienst • Pflegeheim • Pflege im Alter • Pflegekraft • Pflegekräfte • Pflegenotstand • Pfleger zieht in Pflegeheim • Pflegesystem • Sachbuch Gesellschaft • Senioren • Seniorenheim • sozialkritische Bücher • Teun Toebes • umgang mit demenzkranken • Wahre Begebenheit • Wahre GEschichte • wahre geschichten bücher • Wen kümmern die Alten • würdevoll altern • würdevoll leben • Zukunft Altenpflege • Zukunft Pflege |
| ISBN-10 | 3-426-46626-0 / 3426466260 |
| ISBN-13 | 978-3-426-46626-1 / 9783426466261 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich