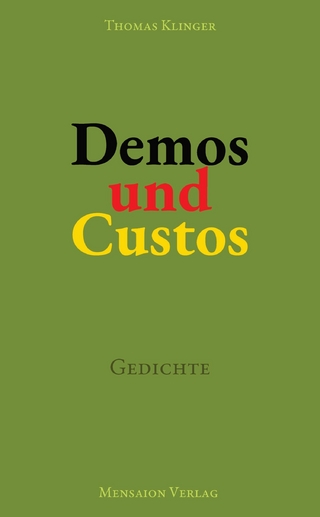Ich steh hier und bügle (eBook)
144 Seiten
Aufbau digital (Verlag)
978-3-8412-3064-5 (ISBN)
Eine Ikone der emanzipatorischen Literatur
»Bei Tillie Olsen gibt es kein Wort, das nicht an genau der richtigen Stelle sitzt.« Dorothy Parker
Die Gedanken einer Mutter gleiten gequält mit dem Bügeleisen hin und her: Was konnte sie ihrer halbwüchsigen Tochter bieten, was blieb dieser verwehrt? Lennie, Helen und ihre Kinder machen Platz für Whitey, einen gestrandeten Freund der Familie, doch er stellt ihre Geduld einmal mehr auf die Probe. Zwei Freundinnen, eine schwarz und eine weiß, merken, dass ihre Welten immer unvereinbarer scheinen. Ein Ehepaar streitet erbittert darüber, wie sie jetzt, wo Kindererziehung und Beruf hinter ihnen liegen, leben wollen, als sie eine fatale Diagnose ereilt. Die Geschichten verzahnen sich immer enger miteinander, wenn die Verbindungen der Protagonistinnen untereinander sichtbar werden.
Sprachlich brillante Einblicke in das Familienleben und die Gedankenwelt der sozial Benachteiligten. Vielfach ausgezeichnet, aufgenommen in die »Best American Short Stories« und heute aktueller denn je. Neu übersetzt von Adelheid und Jürgen Dormagen.
»Weitaus treffender und kraftvoller als all das, was man als >Realismus< bezeichnet.« The New York Times
»Seit ich >Ich steh hier und bügle< vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen habe, hat mich die Geschichte nicht wieder losgelassen. Jetzt, da ich selbst Mutter bin, berührt sie mich sogar noch mehr.« Julia Wolf
»Ich habe Tillie Olsens Story >Erzähl mir ein Rätsel< gelesen - und geweint. Und mich geschämt, dass meine eigene gedruckt wird. Sie ist ein Genie.« Anne Sexton
Tillie Olsen, 1912 in einer russisch-jüdischen Familie im Mittleren Westen der USA geboren, musste als vierfache Mutter ihre fortschrittlichen Ansichten und ihren künstlerischen Ehrgeiz mit Brotarbeit unter einen Hut bringen. Obwohl sie die Highschool ohne Abschluss verlassen hatte, erhielt sie für den vorliegenden Erzählungsband und ihre Essays, die auf Deutsch unter dem Titel 'Was fehlt. Unterdrückte Stimmen in der Literatur' erschienen, diverse Auszeichnungen sowie Stipendien, Ehrentitel und Gastprofessuren der großen amerikanischen Universitäten, darunter Stanford, Harvard und Amherst College. Sie starb 2007 in Oakland, Kalifornien.
Ich steh hier und bügle
Ich steh hier und bügle, und was Sie von mir hören wollen, gleitet gequält mit dem Bügeleisen hin und her.
»Schön wär’s, Sie fänden die Zeit, vorbeizukommen und mit mir über Ihre Tochter zu sprechen. Bestimmt können Sie mir helfen, sie zu verstehen. Sie ist eine Jugendliche, die Hilfe braucht, und mir liegt sehr daran, ihr zu helfen.«
»Die Hilfe braucht …« Selbst wenn ich vorbeikäme, was würde das bringen? Sie glauben, weil ich ihre Mutter bin, hätte ich einen Schlüssel oder Sie könnten mich als eine Art Schlüssel benutzen? Sie lebt seit neunzehn Jahren dieses Leben. So viel Leben, das sich fern von mir abgespielt hat, jenseits von mir.
Wann bleibt da Zeit, sich zu erinnern, zu sichten, zu prüfen, abzuwägen, ein Fazit zu ziehen? Ich lege los, und es gibt eine Unterbrechung, und ich muss wieder von vorne beginnen. Oder ich verheddere mich in all dem, was ich getan oder nicht getan habe oder was hätte sein sollen und was sich nicht ändern ließ.
Sie war ein schönes Baby. Das erste und einzige von unseren fünfen, das bei der Geburt schön war. Sie ahnen nicht, wie unbehaglich sie sich in der ihr neu zugewachsenen Lieblichkeit fühlt. Sie haben sie all die Jahre nicht gekannt, als man sie für unscheinbar hielt, und nicht gesehen, wie sie über ihren Babyfotos brütete und mich drängte, ihr wieder und wieder zu versichern, wie schön sie gewesen war – und es sein würde, wie ich ihr sagte – und es jetzt schon war für das sehende Auge. Doch sehende Augen gab es wenig, meist gar nicht. Meine inbegriffen.
Ich habe sie gestillt. Man glaubt ja heutzutage, das wäre wichtig. Ich habe alle meine Kinder gestillt, bei ihr habe ich allerdings mit der ganzen Rigidität der ersten Mutterschaft das getan, was die Bücher damals forderten. Auch wenn ihre Schreie mich attackierten, bis ich zitterte, und meine geschwollenen Brüste schmerzten, ließ ich die Uhr den Takt angeben.
Warum komme ich damit als Erstes? Ich weiß nicht einmal, ob es eine Rolle spielt oder irgendetwas erklärt.
Sie war ein schönes Baby. Sie machte schillernde Seifenblasen aus Lauten. Sie liebte Bewegung, liebte Licht, liebte Farbe und Stoffe. Sie lag in ihrem blauen Strampler auf dem Fußboden und patschte vor Wonne so rasend schnell darauf herum, dass Hände und Füße verschwammen. Sie war ein Wunder für mich, aber mit acht Monaten musste ich sie tagsüber der Frau einen Stock tiefer überlassen, für die sie überhaupt kein Wunder war, ich arbeitete nämlich oder suchte nach Arbeit und nach Emilys Vater, der es »nicht länger ertragen konnte« (schrieb er in seinem Abschiedsbrief), »die Armut mit uns zu teilen«.
Ich war neunzehn. Es war die Welt der Depression, noch vor der staatlichen Fürsorge, vor den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ich begann schon zu rennen, sobald ich aus der Straßenbahn heraus war, rannte die Treppe hoch im säuerlich riechenden Haus, und wach oder aus dem Schlaf aufschreckend, wenn sie mich sah, brach sie in krampfhaftes Weinen aus, das sich nicht beruhigen ließ, ein Weinen, das ich noch heute im Ohr habe.
Nach einer Weile fand ich einen Job als Bedienung nachts in einem Lokal, so dass ich am Tag mit ihr zusammen sein konnte, und es wurde besser. Schließlich musste ich sie aber zu seiner Familie bringen und sie verlassen.
Es brauchte lange Zeit, um das Geld für ihre Rückfahrt aufzubringen. Dann bekam sie Windpocken, und ich musste noch länger warten. Als sie endlich da war, erkannte ich sie kaum, sie bewegte sich rasch und nervös wie ihr Vater, sah wie ihr Vater aus, dünn und in schäbiges Rot gekleidet, das ihre Haut gelb machte und die Pockennarben hervorhob. Aller Babycharme verflogen.
Sie war zwei. Alt genug für den Kindergarten, hieß es, und ich wusste damals nicht, was ich jetzt weiß – die Erschöpfung eines langen Tages und die Wunden vom Gruppenleben in der Art von Tagesstätten, die nur ein Abstellplatz für Kinder sind.
Bloß dass es keinen Unterschied gemacht hätte, wenn ich es gewusst hätte. Er war der einzig mögliche Platz. Die einzige Möglichkeit, dass wir zusammen sein konnten, die einzige Möglichkeit für mich, einen Job zu behalten.
Und selbst ohne zu wissen, wusste ich es. Ich kannte die Erzieherin, die böse war, denn in all den Jahren hat es sich in mein Gedächtnis eingenistet, der kleine in der Ecke kauernde Junge, ihr Schnarren: »Warum bist du nicht draußen, etwa weil Alvin dich haut? Ist doch kein Grund, geh raus, du Angsthase.« Ich wusste, für Emily war es schlimm, auch wenn sie nicht klammerte und flehte: »Geh nicht, Mommy«, wie die anderen Kinder morgens.
Sie fand immer einen Grund, warum wir zu Hause bleiben sollten. Momma, du siehst krank aus. Momma, mir ist schlecht. Momma, die Tanten sind heute nicht da, die sind krank. Momma, wir können nicht hin, da war letzte Nacht ein Feuer. Momma, heute ist Feiertag, kein Kindergarten, haben die gesagt.
Aber nie direkter Protest, nie Auflehnung. Ich denke an unsere anderen Kinder im Alter von drei, vier Jahren – an Ausbrüche, Wutanfälle, Angriffe, Forderungen –, und ich fühle mich auf einmal elend. Ich stelle das Bügeleisen ab. Was in mir hat dieses Gutsein in ihr gefordert? Und was war der Preis, ihr Preis für solches Gutsein?
Der alte Mann, der hinten wohnt, hat einmal auf seine behutsame Art gesagt: »Sie sollten Emily mehr anlächeln, wenn Sie sie anschauen.« Was war denn in meinem Gesicht, wenn ich sie anschaute? Ich liebte sie. Die tätige Liebe war doch da.
Erst bei den anderen Kindern erinnerte ich mich an seine Worte, und es war das Gesicht der Freude und nicht des Kummers, der Anspannung oder Sorge, das ich ihnen zeigte – zu spät für Emily. Sie lächelt nicht leichthin, erst recht nicht immerzu wie ihre Geschwister. Ihr Gesicht ist verschlossen und düster, aber wenn sie es will, so beweglich. Sie müssen es bei ihren Pantomimen bemerkt haben, Sie erwähnten ihr seltenes Talent fürs Komödiantische auf der Bühne, das beim Publikum ein so herzhaftes Lachen auslöst, dass es applaudiert und applaudiert und sie nicht gehen lassen will.
Woher kommt dieses Komödiantische? Sie hatte nichts davon, als sie das zweite Mal zu mir zurückkam, nachdem ich sie wieder hatte fortschicken müssen. Jetzt war ein neuer Daddy da, den sie lieben lernen konnte, und vielleicht war es ja eine bessere Zeit.
Außer wenn wir sie nachts allein ließen und uns einredeten, sie sei alt genug.
»Könnt ihr nicht ein anderes Mal weggehen, Mommy, zum Beispiel morgen?«, fragte sie. »Dauert es bloß ein Weilchen, wenn ihr weg seid? Versprichst du’s mir?«
Als wir zurückkamen, stand die Eingangstür offen, der Wecker lag auf dem Boden im Flur. Sie hellwach. »Es war nicht bloß ein Weilchen. Ich hab nicht geweint. Dreimal hab ich euch gerufen, nur dreimal, dann bin ich runtergelaufen und hab die Tür aufgemacht, damit ihr schneller kommt. Der Wecker hat so laut geredet, ich hab ihn weggeworfen, mir hat Angst gemacht, was er geredet hat.«
Auch als ich für die Geburt von Susan ins Krankenhaus musste, sagte sie, der Wecker hätte in der Nacht wieder so laut geredet. Sie hatte das hohe Fieber, das vor dem Ausbruch von Masern kommt, aber sie war die ganze Woche während meiner Abwesenheit bei vollem Bewusstsein und auch die Woche danach, als wir zu Hause waren und sie sich weder dem Baby noch mir nähern durfte.
Sie wurde nicht gesund. Sie blieb spindeldürr, wollte nicht essen und hatte Nacht für Nacht Alpträume. Sie rief ständig nach mir, und ich raffte mich aus meiner Erschöpfung auf und rief schläfrig zurück: »Ist alles in Ordnung, Liebling, schlaf wieder ein, ist nur ein Traum«, und wenn sie immer noch rief, mit strengerer Stimme: »Schlaf jetzt, Emily, da ist nichts, wovor du dich fürchten musst.« Zweimal, nur zwei Mal, als ich sowieso wegen Susan aufstehen musste, bin ich in ihr Zimmer gegangen und habe mich zu ihr gesetzt.
Und nun, wo es zu spät ist (als ob sie zulassen würde, dass ich sie umarme und tröste wie die anderen), stehe ich sofort auf und gehe zu ihr, wenn sie stöhnt oder sich unruhig im Bett wälzt. »Bist du wach, Emily? Kann ich dir etwas bringen?« Und die Antwort ist immer die gleiche: »Nein, alles in Ordnung, geh wieder schlafen, Mutter.«
...| Erscheint lt. Verlag | 11.10.2022 |
|---|---|
| Nachwort | Jürgen Dormagen |
| Übersetzer | Adelheid Dormagen, Jürgen Dormagen |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Tell Me A Riddle |
| Themenwelt | Literatur ► Anthologien |
| Literatur ► Krimi / Thriller / Horror | |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Antisemitismus • Benachteiligte Milieus • »Best American Short Stories« • Familie • Feminismus • Frauen • Intersektionalität • Kurzgeschichten • Lucia Berlin • Migrationshintergrund • Neuübersetzung • Patriarchat • Rassismus • Realismus • russisch-jüdische Einwanderer • Storys • Virginia Woolf • Wiederentdeckung |
| ISBN-10 | 3-8412-3064-4 / 3841230644 |
| ISBN-13 | 978-3-8412-3064-5 / 9783841230645 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 727 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich