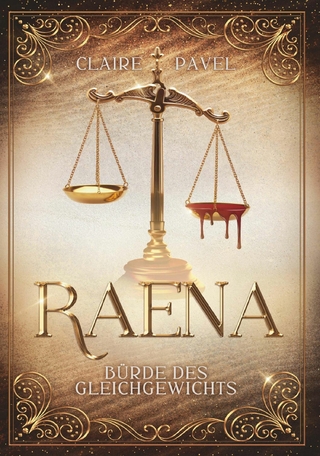Nur wenn ich lachen muss, tut es noch weh (eBook)
168 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7534-3856-6 (ISBN)
Christian Wicklein, geboren 1986 in Sonneberg, lebt in Südthüringen. Anfang 2017 veröffentlichte er seinen ersten Roman "Ich hab's geregelt. Es wird nix!" im Selbstverlag. Ende 2017 folgte "Schuster" sowie Mitte 2018 "Und die Spitalbesucher kamen in Engelskostümen". Anschließend erschien der Kurzgeschichtensammelband "Holt die Kuh vom Eis". Seine Kurzgeschichte "Niemandsland" wurde im Rahmen des Literaturwettbewerbs 2019 der Gruppe 48 in einer Anthologie veröffentlicht. 2020 erschien "Die Entfaltung realen Wahnsinns in Zeiten des Widerstands", eine Sammlung unterschiedlicher Kurzgeschichten.
2
Ich arbeitete als Journalist bei der NNZ, der Neuen Neunbrückener Zeitung. Und ob Sie es glauben oder nicht, das war tatsächlich mein Traumberuf. Allerdings gab es nicht wenige Tage, an denen ich mir wünschte, ich könnte ihn in einer Metropole ausüben. Einfach, weil es in Berlin, Hamburg oder München mehr zu erleben gab als in der Sechzigtausend-Seelen-Stadt Neunbrücken. Meine größten journalistischen Erfolge waren der Bericht über das Verschwinden eines Hundewelpen, der wenig später, auch dank meiner Recherchen, im Tierheim zwei Ortschaften weiter gefunden wurde, sowie der Wettskandal im örtlichen Fußballverein, als der Kapitän von Blau-Weiß Neunbrücken absichtlich mit Rot vom Platz flog und dafür Geld kassierte. Das klingt ziemlich unspektakulär, und um ehrlich zu sein, war es das auch.
Diese Stadt war ein Zwitter. Im Westen strahlte ein AKW vom Hügel herab, quasi der Vesuv der Region. Und trotz des Kinos, liebevoll »Kammerlichtspiele« genannt, des Schwimmbads, der Bibliothek oder des Weinbaumuseums fühlte sich das Leben hier wie eine Schlinge an, die verhinderte, dass man tief Luft holen konnte. Wir waren zu klein, um uns mit Großstädten zu messen, und zu groß, um als Dorf durchzugehen. Das spiegelte sich im Wesen der Einwohner wider, die mit einer Gleichgültigkeit durch die Straßen schritten, als könnte jeder Tag der letzte sein, was aber völlig in Ordnung wäre. Hier ein kurzes Beispiel:
Einmal war ich in der Fußgängerzone unterwegs, weil ich noch ein paar Besorgungen machen musste. Auf dem Nachhauseweg wollte ich mir einen Döner mitnehmen. Vor mir warteten zwei Männer auf ihre Bestellungen. Da sagte der kleinere der beiden: »Sag mal, Hans, wie geht’s eigentlich deiner Frau?« Und der andere, also Hans, antwortete: »Die ist doch vor einem halben Jahr gestorben.« Sein Gesprächspartner nahm die Nachricht unbeeindruckt auf. Ohne den Hauch einer Emotion sagte er: »Das höre ich gerade zum ersten Mal.« Und Hans erwiderte: »Ja, es ging alles ziemlich schnell.« Woraufhin der andere »Na, so was!« sagte und Hans nickte. Dann bekam er sein Essen in einem Beutel überreicht. Der Kleinere vermied eine Beileidsbekundung und sagte stattdessen: »Dann mach es mal gut und lass es dir schmecken.« Hans lachte und sagte »Danke«. Dieser Dialog zeigt den Stoizismus der Neunbrückener. Man hielt sich nicht lange an negativen Dingen auf. Alles wurde hingenommen mit dem Wissen, das meiste sowieso nicht ändern zu können. Es ist mit Sicherheit nicht das beste Beispiel. Aber vielleicht kann ich Ihnen damit wenigstens annähernd beschreiben, was ich meine.
Dieser Ort hatte alles und nichts zu bieten. Ich kann es nicht besser erklären. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht hatte, abgesehen von ein paar Urlauben. Während ehemalige Schulfreunde gleich nach dem Abi Neunbrücken den Rücken kehrten, blieb ich hier und hielt die Stellung, sozusagen. Das mag jetzt fürchterlich schwermütig klingen, aber wenn ich abends vor meinem Wohnhaus stand und rauchte, kam mir immer häufiger der Satz »Der Letzte macht das Licht aus« in den Sinn. Und irgendwie redete ich mir ein, dass ich dieser Letzte war.
Am Tag nach der Sprayer-Attacke verschlief ich. Das war mir seit Ewigkeiten nicht mehr passiert. Hektisch packte ich meinen Kram zusammen und verließ das Haus. Beim Blick auf die andere Straßenseite wunderte ich mich. Die Wand des Gebäudes war sauber. Nicht ein grüner Buchstabe oder ähnliches war zu sehen. Vielleicht hatte es der Regen abgewaschen. Ich machte mich zu Fuß auf den Weg zur Arbeit. Die Straßen waren immer noch feucht und in den Pfützen spiegelten sich die Wolken. Sonnenstrahlen huschten zwischen den Häusern hervor und verursachten breite Schatten auf den Gehwegen. Ich dachte, es könnte ein angenehmer Tag werden.
Die Zentrale der Neuen Neunbrückener Zeitung befand sich in einem Park am Stadtrand. Ein Rundweg führte an Rosskastanien und japanischen Lavendelheiden vorbei bis zu dem grauen Gebäude mit weißem Mörtel in den Fugen, auf dessen Dach ein Leuchtsignet mit den Initialen NNZ montiert war. Ich nahm an einem der freien Schreibtische Platz und startete meinen Laptop. Der Praktikant kam vorbei und fragte mich, ob es nicht langsam Zeit für einen neuen Desktop-Hintergrund wurde. »Nein«, sagte ich, »und jetzt verschwinde.« Ich hörte ihn noch »Weichei« sagen, bevor er im Kopierraum verschwand.
Jetzt möchten Sie sicherlich wissen, was da auf meinem Monitor zu sehen war, richtig? Nun, es war ein Foto von meiner Ex und mir aus unserem letzten gemeinsamen Urlaub auf Sylt. Wir standen Arm in Arm vor GOSCH in List. Ich hielt eine Flasche Jever in meiner rechten Hand und grinste dämlich, während Stella neben mir derart säuerlich in die Kamera blickte, dass man meinen konnte, dieser Moment wäre ihr unangenehm. Kurz zuvor hatten wir uns eine Portion Garnelen geteilt, als ich den schmächtigen Typen in seiner grünen Barbourjacke sah und ihn bat, ein Foto von uns zu machen. Eine Woche danach trennte sich Stella von mir. Als ich sie nach ihren Beweggründen fragte, beschränkte sie sich auf den Satz »Es gibt einen anderen«. Damit war alles gesagt. Trotzdem traf mich das Ende unserer Beziehung wie ein Schlag ins Gesicht, auf den ich nicht vorbereitet war. Heute glaube ich, dass es noch nicht einmal daran lag, dass sie Schluss machte, sondern vielmehr daran, dass ich völlig ahnungslos gewesen war. In den Monaten davor hatte ich nicht einmal ansatzweise gemerkt, dass sie unzufrieden war. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass sie fremdging oder unglücklich war. Umso schockierter war ich, als sie mich vor vollendete Tatsachen stellte. Ich hatte wochenlang an der Enttäuschung zu knabbern. Ein paar Monate später traf ich sie dann zufällig in der Innenstadt. Sie schob einen Kinderwagen, und es entstand einer dieser peinlichen Dialoge, die man nur führen konnte, wenn man eine gemeinsame Zeit zusammen verbracht hatte und es unschön auseinander gegangen war. Wir redeten über das Wetter und die Arbeit. Das war der unangenehmste Teil einer Trennung: Wenn man sich zufällig irgendwo traf und ein Gespräch zwischen Wehmut und Heuchelei entstand. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, rechnete ich anhand meines Schreibtischkalenders den Tag zurück, an dem das Baby gezeugt worden sein musste. Als wir vor GOSCH standen, war Stella in der fünften Schwangerschaftswoche gewesen. Vielleicht sollte ich das Bild wirklich löschen.
»Lessmann, in mein Büro!« Ich rief mein E-Mail-Programm auf den Schirm, damit niemand die Demütigung auf der Benutzeroberfläche sehen konnte, und schlenderte in das Büro meines Chefs. Sein Name war Peter Konstantin Blum. Aber alle nannten ihn Blum. Das war in dieser Firma eine Eigenheit. Obwohl sich alle bestens verstanden und auch abseits der Arbeit ihre Freundschaften pflegten, war es zu einem Running Gag geworden, sich zu siezen. Man redete sich mit dem Nachnamen an und wahrte so eine ganz eigene Form der Höflichkeit. Auf neue Mitarbeiter wirkte das zunächst verstörend. Die meisten gewöhnten sich aber schnell daran.
»Morgen, Blum, was gibt’s?«
»Setzen Sie sich, Lessmann. Wir haben ein paar Dinge zu besprechen.«
»Klingt ja ziemlich ernst.« Ich zog einen Stuhl heran und setzte mich Blum gegenüber. Er trug seine grüne Krawatte, was nichts Gutes bedeuten konnte. Das war den Damen in unserer Abteilung aufgefallen. Immer wenn Blum schlechte Laune hatte, hing ihm dieser Schlips um den Hals. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht tat oder unbewusst. Normalerweise gingen wir ihm an solchen Tagen aus dem Weg. Aber nun saß ich in der Falle. Wie hätte das ausgesehen, wenn ich beim Blick auf seinen Binder Hals über Kopf aus dem Büro gestürmt wäre? Ich versuchte, die Situation aufzulockern.
»Geht es etwa immer noch um den Schweinemettskandal? Hat man die übrigen Säue mittlerweile befragt?« Mein Witz prallte an Blums finsterer Miene ab wie ein Tennisball an einer Betonwand. Bei diesem Thema verstand er keinen Spaß, denn weder die Polizei mit ihrem amateurhaften Vorgehen noch wir mit unseren zu früh verkündeten Schlagzeilen hatten bei dieser Sache eine gute Figur abgegeben. Es war sogar so weit gegangen, dass sich die Landesregierung einschalten musste. Erst dann glätteten sich die Wogen wieder.
Ich lehnte mich zurück und hörte mir an, was er zu sagen hatte. »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie.« Er zog eine Schachtel Zigaretten aus der Schublade heraus und zündete sich eine an. Nur er durfte das, nur in diesem Zimmer. Im restlichen Gebäude herrschte Rauchverbot. Weil Blum kurz nach seiner Beförderung mit dem Antrag gescheitert war, die Rauchmelder in seinem Büro entfernen zu lassen, hatte er sie mit Panzertape abgeklebt. Von da an sah man ihn selten ohne Kippe im Mund in seinem Chefsessel sitzen. An manchen Tagen betrat man das Büro und redete mit einer grauen Dunstwolke, weil Blum von den...
| Erscheint lt. Verlag | 2.7.2021 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur |
| ISBN-10 | 3-7534-3856-1 / 3753438561 |
| ISBN-13 | 978-3-7534-3856-6 / 9783753438566 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 736 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich