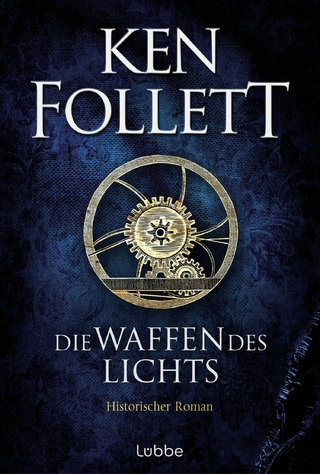Ruf des Lebens - Zeit des Aufbruchs (eBook)
322 Seiten
Aufbau Verlag
978-3-8412-2467-5 (ISBN)
'Ich bin nicht die geborene Krankenschwester. Nicht jede ist zur Krankenschwester berufen, egal, wie sehr sie sich auch in diese Arbeit stürzt. Passionierte Krankenschwestern dagegen sind leicht zu erkennen. Sie tragen eine Leidenschaft und Kraft in sich, die sie nie zu verlassen scheint - so verzweifelt die Umstände auch sein mögen.'
1934 beginnt die junge Evelyn Prentis im Krankenhaus von Nottingham ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Weniger weil es ihr Traum ist, sondern vielmehr auf Drängen ihrer Mutter, die ihre Tochter versorgt wissen möchte. Schon bald lernt Evelyn den rauen und harten Krankenhausalltag kennen. Sie muss kochen, putzen, waschen und dabei stets die strenge Hierarchie der Schwestern beachten. Doch zwischen all der Arbeit, der Schikane und den vielen traurigen Schicksalen, erlebt Evelyn auch immer wieder Momente der Hoffnung und des Glücks ...
Die ergreifenden Memoiren der englischen Krankenschwester Evelyn Prentis als deutsche Erstausgabe. Für alle Fans von Donna Douglas und der TV-Serie 'Call the Midwife'. Alle Titel der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Evelyn Prentis, geboren 1915, wuchs in Lincolnshire auf. Mit achtzehn Jahren verließ sie ihr Elternhaus, um eine Ausbildung zur Krankenschwester zu absolvieren. Während des Zweiten Weltkrieges zog sie nach London, heiratete und gründete eine Familie. Sie starb 2001 im Alter von fünfundachtzig Jahren. Über ihr Leben als Krankenschwester hat sie mehrere Bücher geschrieben.
Kapitel 2
Als auch die letzten Zuckerrüben an die Fabrik geliefert worden waren und gerade nichts Wichtiges anstand, widmete meine Mutter sich der Aufgabe, mich loszuwerden. Nachdem sie die Angelegenheit erst einmal in die Hand genommen hatte, packte sie der Ehrgeiz, und sie schien es plötzlich ebenso eilig zu haben wie die Schulleiterin. Sie widmete sich der Herausforderung, einen Ausbildungsplatz für mich zu finden, mit dem Eifer einer Lady, die den Debütantinnenball ihrer Tochter plant.
Wir lebten auf einer kleinen Farm in einem abgelegenen, windigen Teil von Lincolnshire. Unser Haus stand am Ende eines langen, schlammigen Weges. Es wurde eingerahmt von zwei Eichen auf der einen und einem uralten Gebäude auf der anderen Seite, das wir euphemistisch als Scheune bezeichneten. Gleich neben der Küchentür befand sich ein großer, stinkender Schweinestall. Es gab weit und breit kein anderes Haus und auch sonst nichts, was die Eintönigkeit der Landschaft unterbrochen hätte – abgesehen von der Eisenbahnstrecke, die am Garten vorbeiführte, was zur Folge hatte, dass jedes Mal, wenn Züge vorbeifuhren, im Schlafzimmer der Putz von der Decke rieselte.
Am Ende des Gartens befand sich auch das Klo, oder das »WC«, wie mein Vater es nannte, obwohl es nichts mit der amerikanischen Variante einer Toilette gemein hatte. Stattdessen handelte es sich nur um ein schiefes Holzhäuschen, das durch einen von Ratten bevölkerten Bach vom Haus getrennt war. Saß man auf dem Klo, wenn gerade ein Zug vorbeiratterte, schauten die Fahrgäste und der Heizer zu einem herüber und winkten, weil die Tür eines Tages aus den Angeln gekippt war und mein Vater sich nicht die Mühe gemacht hatte, sie zu reparieren, sodass sie nur lose am Wasserfass lehnte.
»Hinterm Haus«, wie meine Mutter das Klo nannte, war eigentlich nur im Sommer nutzbar. Dann wucherten lila Weidenröschen, Silberblatt und Brennnesseln um die Öffnung herum und sogar durch die Bodenbretter und die Risse im Donnerbalken, sodass man sehr vorsichtig sein musste, bevor man sich hinsetzte, aber wenigstens eine gewisse Privatsphäre genoss. Im Winter hingegen war es dort kalt und zugig, und man suchte das Klo nur auf, wenn es gar nicht anders ging und man für den Toilettengang entsprechende Vorkehrungen getroffen hatte. Bei schlechtem Wetter gingen wir nur warm angezogen mit Handschuhen, Schal und Mütze auf die Toilette, und wenn es regnete, kamen noch Gummistiefel und ein Regenschirm hinzu. Nach Einbruch der Dunkelheit war zudem eine Sturmlampe vonnöten, damit man nicht in den Bach fiel. Ein falscher Schritt, und man stand bis zu den Knien im Wasser, versank im Schlamm und scheuchte die Ratten auf, die nach allen Seiten davonstoben.
In dem windschiefen Häuschen gab es einen Sitz mit einem Loch in der Mitte über einem Zinkeimer. Der Eimer musste einmal wöchentlich geleert werden, manchmal auch zweimal, wenn wir Besuch hatten oder jemand in der Familie an einem Magen-Darm-Infekt litt. Mein Vater verrichtete diese Aufgabe immer am Samstagabend vor seinem Bad. Meine Mutter hatte bestimmt, dass er als Letzter badete.
Aber der größte Nachteil unseres Außenklos war wohl, dass es nur von jeweils einer Person genutzt werden konnte. Eine meiner Tanten, die im Dorf lebte, hatte ein Häuschen, in dem locker drei Personen gleichzeitig Platz hatten. Die Löcher waren sogar unterschiedlich groß. Ich habe nie erlebt, dass alle Plätze besetzt gewesen wären, doch das Ganze strahlte einen gewissen Komfort aus, der unserem Klo gänzlich fehlte. Gebaut war es aus solidem Mahagoniholz, und auf dem Boden lag immer eine Matte aus Kokosfasern. Meine Mutter bezeichnete es als Angeberei, aber mir gefiel es, und ich fand, dass es den Abort verschönerte und ihm einen Hauch von Gemütlichkeit verlieh.
Die Sturmlampe war im Übrigen nicht nur nützlich, um einen Sturz in den Bach zu vermeiden. Im Lichtschein konnte man auch die Artikel auf dem zerschnittenen Zeitungspapier lesen, das an einer Schnur an der Wand hing. Als ich von daheim fortging, waren diese Zeitungsquadrate die einzige richtige Lektüre, die mir je zur Verfügung gestanden hatte. Natürlich abgesehen von meinen Schulbüchern und Auszügen aus Groschenromanen wie Peg’s Paper.
Im Haus benutzten wir Öllampen und Kerzen, wenn wir Licht brauchten, und Herd und Ofen wurden mit Kohlen befeuert. Meine Mutter war die Tochter eines Grubenarbeiters und lebte in der ständigen Angst, dass uns eines Tages wegen eines Streiks oder eines sonstigen Unglücks die Kohlen ausgehen könnten, weshalb sie überall Vorräte anlegte: unter den Hecken, unter dem Apfelbaum im Vorgarten, vor dem Eingang zum Schweinestall, so dass man kaum noch hineinkam, im Waschhaus und in der Scheune. Einen Kohlenschuppen besaßen wir nicht, da der letzte schon lange in sich zusammengefallen war.
Die Kohlenvorräte waren allerdings nur zum Teil auf Panikkäufe im Sommer zurückzuführen, wenn die Preise niedriger waren. Als kleine Anerkennung für mein freundliches Winken, wenn ich auf dem Klo saß und sie vorbeifuhren, warfen die Zugführer mir große Brocken Kohle zu, die fast vor meinen Füßen landeten und unseren Vorrat nicht unerheblich mehrten. Für gewöhnlich war es Kohle bester Qualität, die das Freitagsgebäck noch mehr schwärzte und uns nachts den Schweiß aus allen Poren trieb.
Was unsere Ölvorräte betraf, sah es weniger gut aus. Der Öllieferant ließ sich nur blicken, wenn ihm danach war, aber auch dann führte er nur begrenzte Mengen mit sich, je nachdem, was sein Karren fasste und welches Gewicht sein Klepper zu ziehen geneigt war. Immerhin hatte er ein großes Gebiet mit vielen abgelegenen Höfen zu beliefern.
Da meiner Mutter diese Widrigkeiten nur zu vertraut waren, ging sie sehr sparsam mit Brennstoffen um und machte erst Licht, wenn man die Hand nicht mehr vor Augen sah. Bis es so weit war, war das Feuer unsere einzige Lichtquelle.
Ihre Knauserigkeit hängt mir bis heute nach. Sobald der Tag sich dem Ende neigt und die Dunkelheit ins Haus kriecht, mache ich überall Licht. Meine Stromrechnung ist dementsprechend hoch. Ich bin der Prototyp des Verbrauchers, an den sich alle Ermahnungen zum Energiesparen richten. Und ich gehöre auch zu denen, die oft erst bezahlen, wenn die letzte Mahnung ins Haus flattert. Die Abenddämmerung hat für mich nichts Romantisches, und ich kann auch dem Herbst nichts abgewinnen, egal wie sehr andere von den geisterhaften Nebelschwaden und der Erntezeit schwärmen mögen.
An einem Abend im Herbst nahm meine Mutter sich schließlich vor, die Suche nach einem Ausbildungsplatz in einem Krankenhaus für mich in Angriff zu nehmen. Nach dem Abendessen, als die Schweine schon gefüttert waren und meine Mutter die Kartoffelschalen und anderen Delikatessen für die Fütterung am nächsten Tag gekocht, die Hühner eingesperrt, am Brunnen einen Eimer Wasser für den kommenden Morgen geschöpft und das Feuer im Ofen angestochen hatte, nahm sie am Tisch Platz und setzte gleich mehrere Bewerbungsschreiben auf. Allerdings war das schwieriger, als man meinen sollte.
Über dem Tisch baumelte eine Lampe an einer Kette, die an einem Deckenbalken befestigt war. Ein plötzlicher Windstoß, der durch den Kamin fegte, oder eine zornig zugeschlagene Tür genügte, um die Lampe ins Pendeln oder sogar kreisförmig zum Schwingen zu bringen, je nachdem, wie heftig der Luftzug war. Wenn das geschah, machte das wechselhafte Spiel von Licht und Schatten alle Tätigkeiten fast unmöglich, die eine klare Sicht erforderten, wie Lesen, Nähen oder eben Briefe schreiben. Man musste warten, bis die Lampe wieder still hing. Doch selbst dann lag der Tischabschnitt, der eben genug war, um als Schreibunterlage zu dienen, in so tiefer Dunkelheit, dass bald Flecken das sorgfältig ausgebreitete Briefpapier verunstalteten.
Obgleich meine Mutter mich öfter um Rat fragte beim Buchstabieren schwieriger Wörter, hatte sie einen eigenwilligen Schreibstil. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich nach der richtigen Schreibweise von »hochachtungsvoll« gefragt hätte, ich kann also nur vermuten, dass sie es so schrieb wie in allen anderen offiziellen Briefen, die sie regelmäßig mit der Höflichkeitsfloskel schloss: »Hoch Achtungsfoll«. Familiärere Briefe an Bekannte oder später auch an mich endeten unweigerlich mit einem »Halt die Oren staif«, was mir jedes Mal ein Lächeln entlockte.
Meine Mutter bombardierte nicht nur sämtliche Krankenhäuser, von denen sie je gehört hatte (und noch ein paar mehr), mit weitschweifigen Lobeshymnen auf meine Tugenden und schulischen Leistungen, sondern erbat auch von jedem im Umkreis, der einen gewissen Stand hatte, ein Empfehlungsschreiben, auch wenn die meisten dieser Leute mir noch nie begegnet waren.
Wenn ihre Bittschriften Erfolg hatten und sie tatsächlich eine Antwort erhielt, öffnete sie den Umschlag über Wasserdampf und las den Inhalt sorgfältig. Enthielt das Schreiben einen Begriff oder einen Satz, der ihr nicht gefiel, kratzte sie ihn vorsichtig vom Papier und fügte in die entsprechende Stelle eine Formulierung ein, die ihr angemessener erschien, oder ließ sie frei. Offenbar vertrat sie den Standpunkt, dass man fremden Leuten nicht alles auf die Nase binden sollte – schon gar nicht Negatives. War es vollbracht, versiegelte sie das Kuvert wieder mithilfe von Briefmarkenrandstücken. Zwar sah der Umschlag hinterher nicht mehr ganz so astrein aus, aber das war allemal besser, als ungeschönte Empfehlungen abzuschicken, die mir möglicherweise mehr schaden als nützen würden. Außerdem verlieh das eigenwillige »Siegel« den Umschlägen eine besondere Note.
Nachdem dann ihre Anschreiben fertig formuliert waren, steckte sie alles...
| Erscheint lt. Verlag | 1.7.2021 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Die Krankenschwestern von Notting Hill |
| Übersetzer | Cécile Lecaux |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | A Nurse in Time |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | 2.Weltkrieg • Call the midwife • Carmen Korn • Donna Douglas • Frauen • Freiheit • Geburt • Hebammen • Krankenschwester • Lazarett • Lesley Pearse • London • Notting Hill • Saga • Säugling • Unabhängigkeit • Wochenbett |
| ISBN-10 | 3-8412-2467-9 / 3841224679 |
| ISBN-13 | 978-3-8412-2467-5 / 9783841224675 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich