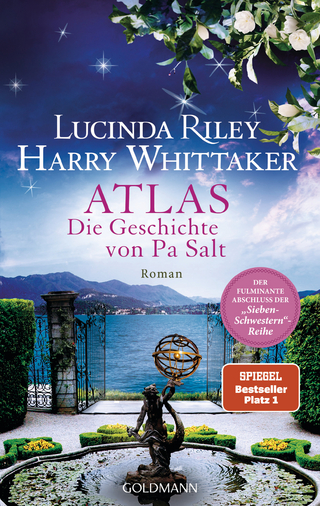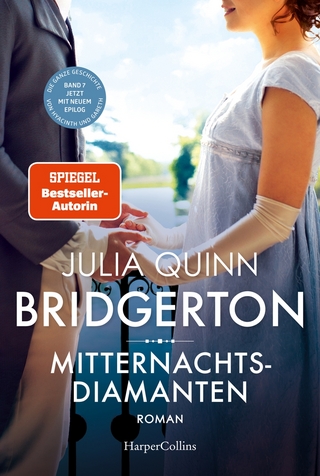Im Zwielicht der Zeit
Verlag 3.0 Zsolt Majsai
978-3-95667-365-8 (ISBN)
1912 – die 17-jährige Gertrud Oertel sitzt am Totenbett ihrer Mutter. Sie starb an Diabetes, denn damals gab es noch kein Insulin. Trauer herrscht im Hause Oertel. Gertruds Vater, ein angesehener Hochschulprofessor leidet sehr unter dem Verlust seiner geliebten Frau. In der Musik – Oertel spielt Cello, Gertrud Klavier und ihr Bruder Paul Geige – finden sie Trost. Sie geben Hauskonzerte, und das normale Leben kehrt langsam zurück. Da bricht der 1. Weltkrieg aus. Gertruds Verlobter fällt im ersten Kriegsjahr. Sie lebt weiter im Haus des Vaters und versucht gemeinsam mit Emmy, der Haushälterin, die Oertel eingestellt hat, die Familie durch die Hungerjahre des Krieges zu bringen. Sie geht mit Emmy zu den umliegenden Bauernhöfen und bittet um Nahrungsmittel.
Paul, Oertels Sohn, hat mit siebzehn Jahren das Notabitur gemacht und sich freiwillig an die Front gemeldet. Er wird schwer verwundet. Unter dem Eindruck der traumatischen Kriegserlebnisse beschließt er, Theologie zu studieren und nicht Mathematik, wie der Vater es wollte. Es kommt zu Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn.
Gertrud möchte einen Beruf erlernen. Das Leben zu Hause findet sie eintönig. Doch der Vater, der die traditionellen konservativen Ansichten der wilhelminischen Ära vertritt, verbietet es ihr. Als der Krieg 1918 zu Ende ist, schließt Gertrud sich unter dem Einfluss ihrer Freundin Anni einer Künstlerclique an. Sie gerät in die Welt der Bohème, lernt den Dadaismus und die moderne Malerei kennen. Sie verliebt sich in Marcel, einen Maler.
Dem Vater passt dieser Lebenswandel seiner Tochter überhaupt nicht. Er verheiratet sie mit Philipp Holtstein, dem Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Zunächst ist die Ehe ohne Probleme. Gertrud und Philipp akzeptieren einander, aber eine enge gefühlsmäßige Bindung besteht nicht. Gertrud trifft Marcel wieder und hat eine Affäre mit ihm. Wegen der aufkommenden Nationalsozialisten geht Marcel ins Ausland. Gertrud hat inzwischen zwei Kinder: Anna und Joachim. Das erste Kind, das sie vor diesen beiden bekommen hatte, starb an Scharlach.
Ab 1933 Ist das Leben von Gertrud und Philipp zunehmend von Ängsten und Sorgen geprägt. Ihre Auswanderungspläne nach Australien scheitern. Philipps Geschäft wird enteignet, er selbst wird 1938 im Zusammenhang mit der so genannten „Reichskristallnacht“ verhaftet und ins KZ Buchenwald verschleppt, wird aber als so genannter privilegierter Jude nach mehreren Wochen wieder frei gelassen.
Joachim muss das Gymnasium verlassen und wird später auch noch in ein Lager verschleppt, kann 1945 aber fliehen.
Anna kann noch die mittlere Reife erreichen. Die Mutter schickt sie nach Berlin, wo ihr Bruder als Pfarrer lebt. Sie kann hier eine private Schule besuchen. Anna verfolgt beharrlich ihren Traum, Schauspielerin zu werden, besteht die Eignungsprüfung und nimmt Privatunterricht, bis der Bombenkrieg alles Leben lahm legt. Nach dem 20. Juli 1944, dem Attentat auf Hitler, kann sie nur noch mit einer gepackten Tasche aus dem Haus gehen, weil sie als Halbjüdin fürchten muss, verhaftet zu werden.
In ihrer Sorge um ihre Kinder beichtet Gertrud Philipp ihre Affäre mit Marcel in den frühen Jahren ihrer Ehe. Sie bittet ihn um einen Vaterschaftstest, weil Marcel der Vater ihrer Kinder sein könnte. Wenn da stimmt, könnte man sie für arisch erklären lassen. Der Test brachte kein eindeutiges Ergebnis.
1943 nimmt Philip sich unter dem Druck der Verhältnisse das Leben.
Anna hat den Bombenkrieg in Berlin überlebt. Sie flieht 1945 aus dem sowjetisch besetzten Teil Deutschlands, indem sie bei Magdeburg durch die Elbe schwimmt. Beide Kinder sind nun wieder mit der Mutter vereint.
“Die handelnden Personen sind frei erfunden, die Handlung des Romans orientiert sich jedoch an tatsächlichen Ereignissen.” Diesen Satz habe ich meinem Buch “Im Zwielicht der Zeit“ vorangestellt, dem ersten Band einer Familiensaga, die mit dem Roman “Im Bann der Vergangenheit“ weitergeführt wird. Sie ist keine Familienchronik, sondern Dichtung und Wahrheit. Das ergibt sich zwangsläufig schon daraus, dass ich im Jahr 1912, in dem die Geschichte beginnt, noch gar nicht gelebt habe. Die Ereignisse in den Jahren vor meiner bewussten Existenz sind mir erzählt worden und ich habe versucht, sie mit Leben zu füllen, indem ich einige Personen erfunden habe. Der Hintergrund für die beiden Romane sind die schicksalhaften Begebenheiten in meiner Familie, die alle der Wahrheit entsprechen und sich so ereignet haben, wie sie beschrieben werden. “Im Zwielicht der Zeit“ schildert die Jahre von 1912 bis 1945. Der Roman erzählt von Gertrud, einer lebenslustigen jungen Frau, die nach den dunklen Jahren des ersten Weltkriegs ihr Leben genießen will und sich in den Kreisen der Bohème amüsiert … von ihrem strengen Vater, einem Gelehrten, Professor der Mathematik, der dies missbilligt und sie zur Heirat drängt, damit sie zurückfindet in ein bürgerliches Leben … von ihrem Bruder Paul, der sich gegen den Willen des Vaters unter dem Eindruck traumatischer Kriegserlebnisse entschließt, Theologie zu studieren … und von Philipp, Gertruds jüdischem Ehemann, der die Verfolgung durch die Nationalsozialisten nicht überlebt. Das Vorbild für die Figur der Gertrud ist meine Mutter, für den Vater mein Großvater, für Paul mein Onkel und für Philipp mein Vater. Erfunden habe ich die Freunde und Künstler in der Welt der Bohème. Die übrigen Personen, von denen nach und nach die Rede sein wird, haben alle ihre Vorbilder in meiner Familie. Der Leser erfährt auch etwas von den gesellschaftlichen Umbrüchen jener Zeit. Von den konservativen, traditionellen Vorstellungen der Kaiserzeit, die den Frauen nur die Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter zuwiesen und so ihre persönliche Entwicklung stark einschränkten, war Gertruds Elternhaus geprägt. Mit den Erschütterungen des verlorenen Krieges kam in den zwanziger Jahren die Befreiung von den Zwängen der Vergangenheit, bis dann in den Jahren nach 1933 mit der Hitlerdiktatur ein autoritäres Regime seine Herrschaft antrat und bei vielen Menschen Unsicherheit und Angst verbreitete. Der Roman beschreibt mit den handelnden Personen auch ein Stück Zeitgeschichte.
Gertrud war siebzehn, als ihre Mutter starb. Die Todesursache war Diabetes. Zehn Jahre später sollte es Insulin geben, das so vielen Menschen, die an dieser Krankheit litten, ein halbwegs normales Leben ermöglichte. Aber damals – man schrieb das Jahr 1912 – waren sie Todeskandidaten. Gertrud stand wie in Trance am Bett ihrer Mutter und blickte starr auf deren bleiches, wächsernes Gesicht. Sie war schön, von einer unschuldigen, fast kindlichen Schönheit. Das braune Haar, das sie sonst der Mode entsprechend hochgesteckt trug, lag in losen Strähnen auf dem Kissen und umrahmte ihr stilles Antlitz. Plötzlich meinte Gertrud, sie leise atmen zu hören, zu sehen, wie sich ihre Brust ganz sacht hob und senkte. 'Sie ist nicht tot, sie lebt!!! Die Ärzte haben sich geirrt!', wollte sie aufschreien. Ihr war, als verschwände der Boden unter ihren Füßen und die Wände des Zimmers zögen sich zurück, als schwebe sie im leeren Raum, nur sie allein mit ihrer Mutter auf dem Totenbett, allein in einer öden, tiefschwarzen Finsternis. Sie drohte in einen Abgrund zu stürzen, aber ehe dies geschah, empfand sie einen ungeheuren Hunger nach Leben. Er durchzog ihre Adern, zerrte an jeder Faser ihres Körpers mit übermächtigem Sehnen. Gleichzeitig spürte sie einen verzehrenden Schmerz, der sie auszulöschen schien. 'Ich will leben, leben! Ich will leben!', schluchzte sie auf und sank am Bett ihrer Mutter nieder. Sie weinte bis zur Erschöpfung. All die aufgestauten Gefühle des Tages – die verzweifelte Hoffnung, an die sie sich zunächst geklammert hatte, das langsame Begreifen der Endgültigkeit des Abschieds, der Lebenshunger und der unendliche brennende Schmerz – wurden mit der Tränenflut hinweggeschwemmt. Später setzte sie sich in den Sessel neben dem Bett der Toten und sank in einen unruhigen Schlaf, der von wirren Träumen begleitet war. Sie sah ihre Mutter, wie sie sie als Kind oft gesehen hatte, im Sessel sitzend, mit einer Handarbeit beschäftigt, still, freundlich zu jedermann, liebevoll zu ihren Kindern. Aber ihre Liebkosungen waren nur flüchtig, sie strich ihren Kindern leicht über das Haar, tätschelte zart ihre Wangen oder hauchte einen kaum spürbaren Kuss darauf, so als wolle sie sie nicht zu stark an sich binden, als ahne sie, dass sie früh von ihnen gehen würde. Sie vertiefte sich in ihre Stickerei. Unter ihren Händen entstanden kunstvolle Tischdecken, die man überall im Haus auf Tischen, Truhen und Kommoden bewundern konnte. Und noch viele Jahre später, als längst Kunststoffe und maschinell bedruckte Tücher benutzt wurden, sollte sich ihre Enkelin Anna daran freuen, wenn sie diese Kunstwerke bei festlichen Gelegenheiten aus dem Schrank holte. Sie war immer ein wenig müde, still und geduldig, jeder hatte sie gern. Die Krankheit, die ihr ständiger Begleiter war, ließ sie dem Leben mit einer gewissen Teilnahmslosigkeit begegnen. Sie liebte ihre Kinder, sie liebte ihren Mann, aber es war ihr stärker als anderen Menschen bewusst, dass sie ihr nur für eine kurze Zeitspanne ihres Lebens gegeben waren. In ihrem Traum war Gertrud wieder das kleine Mädchen, das zu den Füßen der Mutter saß und sich in ihren Rock kuschelte. Doch plötzlich entfernte sich ihre Mutter auf rätselhafte Weise, sie wurde durchsichtig, immer kleiner und schien ganz zu verschwinden. 'Mama!', schrie Gertrud auf, das Wort ihrer Kindertage benutzend, und erwachte vom Klang ihrer eigenen Stimme. Sie rieb sich die Augen. Es dämmerte. Sie fühlte sich verlassen und allein. So sollte es ihr Leben lang bleiben. In Stunden tiefer Verzweiflung und Niedergeschlagenheit war sie immer allein. Gertrud hatte einen Sinn für das Praktische, und sie hatte die Fähigkeit zu Beherrschung und Disziplin, was ihr Wesen und ihre Gefühle betraf. Damit konnte sie später manche Krise in ihrem Leben bewältigen. In der gegenwärtigen Situation halfen ihr diese Eigenschaften, die Trauer und die Ängste der Nacht in ihrem Herzen einzuschließen und sich den Dingen zuzuwenden, die nun erledigt werden mussten. Sie ging in die Küche, wo sie Fine, die Hausangestellte, schon am Herd hantieren hörte. 'Ach, Fräulein Gertrud, mein Beileid', sagte die Frau mit unsicherer Stimme und wischte sich mit dem Schürzenzipfel die Augen. Sie war schon lange in der Familie. Gertruds Mutter hatte sie mitgebracht, als sie vom Rhein nach Braunschweig heiratete. Fine hatte die Kinder aufwachsen sehen. Aus Treue zu ihrer kranken Herrin hatte sie nie geheiratet. Inzwischen war sie ein ältliches Mädchen geworden, mit scharfen Zügen undabgearbeiteten Händen, aber ihre Augen waren voller Güte und Verstehen. Ohne die Hoffnung auf einen Mann und eigene Kinder hatte sie ihre Herrschaft zu ihrer Familie gemacht. 'Der Herr Geheimrat hat die ganze Nacht Licht in seinem Zimmer gehabt. Er hat sicher gar nicht geschlafen', redete Fine weiter, als sie Gertrud eine Tasse Kaffee hinstellte. 'Der wird Ihnen gut tun, Fräulein Gertrud. Ach, wie schrecklich, dass die gnädige Frau so früh sterben musste, mit neununddreißig Jahren.' 'Ja, Fine, es ist für uns alle ein großes Unglück', antwortete Gertrud mit einer fast steifen Förmlichkeit. Man ließ sich vor den Dienstboten nicht gehen, auch wenn sie schon so lange im Haus waren wie Fine. Das gehörte sich nicht. 'Deck den Frühstückstisch, ich werde nach meinem Vater und meinem Bruder sehen.' Der Geheime Hofrat Professor Dr. Friedrich Oertel hatte sich in seine Studierstube zurückgezogen. Wie betäubt saß er an seinem Schreibtisch. Es gelang ihm nicht, seine Gedanken zu ordnen. 'Ich werde eine Haushälterin einstellen müssen. Gertrud ist noch zu jung. der Haushalt. ich in meiner Stellung habe Verpflichtungen. ich muss repräsentieren.' Dann überwältigte ihn der Schmerz. Wie ein reißender Fluss, der über die Ufer tritt und alle Dämme zerstört, überflutete er sein Inneres und löschte jede andere Empfindung aus. Schwach und hilflos fühlte Oertel sich dem ausgeliefert, was geschehen war. Obwohl er über die Krankheit immer genau Bescheid gewusst hatte, konnte er in diesem Augenblick nicht begreifen, dass er seine Frau nun endgültig verloren haben sollte. Nie mehr würde sie ihn anlächeln, nie mehr ihre Hand leicht auf seine Schulter legen, niemals wieder mit ihrer sanften Stimme zu ihm sprechen. Es konnte nicht sein, es durfte nicht sein! Etwas in ihm wehrte sich mit aller Macht gegen diese grausame Wahrheit. Sein Kopf sank vorn über auf die Schreibtischplatte. Tränenloses, krampfhaftes Schluchzen erschütterte seinen Körper. So verharrte er lange Zeit, ohne etwas denken zu können, ganz dem Ansturm seiner Gefühle preisgegeben. Schließlich stand er auf, ging langsam zum Fenster und öffnete es. Die Nacht war schwül, die Luft schwer, er meinte, er müsse ersticken. Der Himmel war wolkenverhangen, kein Stern sandte einen Lichtschimmer in die Finsternis. In der Ferne donnerte es leise. Ab und zu erhellte Wetterleuchten am Horizont die Nacht. Vor dem geöffneten Fenster ging ein leichter Sommerregen nieder. Manchmal sprühte er Tropfen in Oertels Gesicht, aber er konnte dessen heiße Stirn nicht kühlen. Dieses Haus am Waldrand – er hatte es für sie gebaut. Es trug ihren Namen, 'Lorenhöhe'. Sie sollte sich hier ausruhen, erholen, neue Kraft schöpfen. Nun war sie hier gestorben. Ihm war, als habe er, ohne es zu wissen, ein Mausoleum für sie erbaut. Lange stand er am Fenster und starrte in die Dunkelheit. Schließlich setzte er sich benommen, leer und ausgebrannt wieder an seinen Schreibtisch. Er stützte den Kopf in beide Hände. Er wusste nicht, wie spät es war, es interessierte ihn nicht. Er spürte nichts, gar nichts mehr, auch nicht den wütenden Schmerz, der sein Innerstes aufgewühlt hatte. Es war, als sei alles Leben aus ihm gewichen, als sei er mit ihr gestorben. Eine lange Zeit saß er so da, bis ihn plötzlich ein Geräusch aufschreckte. Mit Erstaunen nahm er wahr, dass Tageslicht ins Zimmer fiel. Die Tür war leise geöffnet worden. Gertrud stand im Türrahmen, gefasst, aber mit bleichem, übernächtigtem Gesicht. Sie ging auf den Vater zu. Eine Welle von Liebe und Mitgefühl stieg in ihr auf. Sie wusste, wie sehr er seine Frau geliebt, wie viel er mit ihr verloren hatte. Ihr eigener Schmerz um die tote Mutter ließ sie das Leid des Vaters mitfühlen. Sie schlang zärtlich die Arme um ihn, eine Geste, die es schon lange nicht mehr zwischen ihnen gegeben hatte. Er ließ es wie selbstverständlich geschehen. Gertrud konnte sich nicht erinnern, dass ihr Vater sie in den Arm genommen hatte, seit sie dem Kleinkindalter entwachsen war. Eine Respekt gebietende Autorität war immer von ihm ausgegangen, eine distanzierte Strenge. Die Kinder wussten sich von ihm geliebt, er gab ihnen Sicherheit und Geborgenheit. Aber gleichzeitig war die Übermacht seiner starken Persönlichkeit stets allgegenwärtig. Sein Wort war Gesetz. Jeder hatte sich nach ihm zu richten. Widerspruch oder kleine Ungehorsamkeiten wurden nicht geduldet. Er regierte sein Hauswesen und seine Familie wie ein guter Patriarch: mit Liebe, aber auch mit Strenge; mit Verantwortungsbewusstsein, aber Gehorsam fordernd; gerecht, aber unduldsam gegenüber Meinungen, die er nicht teilte; mit einer Autorität, die jeder in seiner Umgebung spürte und die in seinem Charakter begründet war. Es schnitt Gertrud ins Herz, ihren starken Vater so zu sehen, gramgebeugt, ein schwacher Mensch.
• Gertrud schreibt im August 1936 in ihr Tagebuch: Anna sitzt noch immer im Garten unter der Tanne und grübelt. Ich sehe sie vom Fenster aus und mache mir Sorgen um sie. Das Kind hat sich verändert. Seit sie zur Mittelschule geht, ist sie nicht mehr so fröhlich und lebhaft wie früher. Von der Schule erzählt sie nicht viel, aber ihre Noten sind gut. Die Lehrer sind mit ihr zufrieden. Trotzdem macht sie einen bedrückten Eindruck. Irgendetwas scheint sie zu quälen. Anna starrt mit leeren Augen auf den Boden. Ein Käfer, blauschwarz mit einem glänzenden Panzer, krabbelt zu ihren Füßen auf der Erde herum. Sie sieht ihn nicht. Das Bild auf der Netzhaut dringt nicht in ihr Bewusstsein, ebenso wenig wie die Wärme der Sonnenstrahlen, die durch die Zweige fallen, das Spiel von Licht und Schatten, oder die vertrauten Geräusche, die zu ihr herüberklingen: das Dengeln einer Sense und das Kreischen der Gattersäge vom nahen Sägewerk. Sie hat sich in ihr Inneres zurückgezogen wie in eine Höhle, in der es kein Licht gibt, nur Finsternis. Sie verharrt lange so, sie fühlt sich leer, allein gelassen in einer unbekannten Öde, hinausgeworfen aus der Wärme des Lebens in eine feindselige, kalte Welt. Dann kommt dieses Gefühl wieder, das sie in der letzten Zeit schon des Öfteren gehabt hat. Ihr ist, als ob sie sich aus ihrem Körper löse, als ob ihr Bewusstsein und ihr Körper nebeneinander existierten, als ob sie in zwei Wesenheiten gespalten sei. Es ist ein unangenehmer Zustand. Sie weiß, dass sie ihn beenden kann, wenn sie sich ganz stark auf etwas außerhalb von ihr konzentriert, das hat sie schon erfahren. Der Käfer krabbelt noch zu ihren Füßen. Nun sieht sie ihn bewusst an und beobachtet aufmerksam, wie er sich müht, seinen Weg zu finden zwischen all den Hindernissen, die ihn aufhalten wollen. Er versucht, über Zweige und Tannenzapfen zu klettern, fällt wieder herunter, zappelt einen Augenblick, auf dem Rücken liegend, dann gelingt es ihm durch eine geschickte Bewegung, wieder auf die Beine zu kommen. Er schlägt eine andere Richtung ein, versucht, die Barrieren zu umgehen, die ihn aufhalten wollen. Anna konzentriert sich ganz auf den Käfer. Sie zwingt sich dazu, sein Bemühen zu verfolgen, trotz aller Behinderungen weiterzukommen. Allmählich steigen Bilder in ihr auf, Bilder, die Fragen sind, auf die sie keine Antworten weiß, auf die sie von niemandem Antworten bekommen hat, nur die eine von ihrer Mutter: „Dein Vater ist doch Jude.“ Aber das ist keine Antwort gewesen, nur eine neue Frage. Sie hat darüber nachgedacht, tagelang, ohne zu begreifen, was anders sein sollte an ihrem Vater, anders an ihr selbst. „Ich kann dich nicht aufnehmen“, hat Lucie gesagt und ihr dabei den Arm um die Schultern gelegt. „Heute kannst du bleiben, aber du darfst nicht wiederkommen. Und die Uniform, die darfst du auch nicht tragen.“ Anna hat die BDM-Führerin mit großen, verständnislosen Augen angesehen. „Warum?“ hat sie leise gefragt. Alle meine Klassenkameradinnen werden doch aufgenommen, warum ich nicht, hat sie noch fragen wollen, aber die Worte sind ihr in der Kehle stecken geblieben. „Frag deine Mutter, lass es dir von ihr erklären. Ich kann es dir nicht sagen.“ Eigentlich ist Lucie nett gewesen, denkt Anna, sie hat mich so lieb angesehen und mich in den Arm genommen. Das ist damals auf dem Schulhof des Gymnasiums gewesen, bei der Aufnahme der Zehnjährigen in den Jungmädelbund und das Jungvolk. Seitdem hat sie es immer wieder gemerkt, dass sie nicht so selbstverständlich dazugehört wie früher: Beim Fahnenappell, wenn alle Kinder der Schule in ihrer Uniform angetreten sind, steht sie als einzige in ihrem Schulkleid da mit dem Gefühl, dass alle sie anstarren würden, als ob sie eine Aussätzige sei oder sonst irgendeinen Makel an sich habe. In der Pause, wenn ihre Freundinnen die Köpfe zusammenstecken und über Erlebnisse im „Dienst“ reden, wird sie mit Worten wie „davon verstehst du ja doch nichts“ oder „das geht dich nichts an“ weggeschickt. Und wenn man sie zuhören lässt, dann muss sie selbst feststellen, dass sie nicht mitreden kann und zieht sich zurück. Was ist anders an Vati? Was ist anders an mir? Immer wieder grübelt Anna über diese Frage nach. Wir leben wie alle anderen auch, wir sprechen dieselbe Sprache, ich gehe in die Schule wie alle Kinder, muss Hausaufgaben machen, ärgere mich über Lehrer, habe Angst vor Klassenarbeiten, bekomme Zeugnisse, freue mich über gute Noten und bin traurig über schlechte – genau wie sie. Aber immer wieder werde ich plötzlich ausgeschlossen, darf ich nicht mitmachen. Ich bin ausgenommen von allem, was für die anderen selbstverständlich ist. Warum? Sie hat das Gefühl, dass sie nirgendwo hingehört, überall dazwischensitzt, aus unerklärlichen Gründen isoliert und dann doch wieder einbezogen wird, willkürlich, so, wie andere es gerade wollen. Sie hat keinen Einfluss darauf, es geschieht ihr eben einfach. „Gott schuf den Weißen, Gott schuf den Schwarzen, aber der Teufel schuf das Halbblut.“ Laut und durchdringend hat die Stimme des Lehrers geklungen, als er der Klasse diesen Satz vorsprach. „Wiederholen“, kommandierte er. Im Chor haben die Kinder diese Worte nachgesprochen. Aber es hat dem Ohr des Lehrers wohl nicht überzeugend geklungen, nicht „markig“ genug, wie er betont hat, und so schallte es noch einmal durch die Klasse: „Gott schuf den Weißen, Gott schuf den Schwarzen, aber der Teufel schuf das Halbblut.“ Anna hat den Satz mitgesprochen, ohne sich etwas dabei zu denken. Was der Lehrer sagt, das muss man tun. Plötzlich aber hat er sich umgedreht und sie angesehen. Mit einer Stimme, die viel menschlicher klang als vorher, hat er gesagt: „Das gilt aber nicht für dich, Anna.“ Zur Klasse gewandt, hat er seine Kommandostimme wieder angenommen. „Auswendiglernen!“ befahl er. Alle Kinder haben sich zu Anna umgedreht. Noch jetzt spürt sie die Beklemmung, die Ratlosigkeit, die sie bei ihren Blicken überfiel. Zu Hause hat sie die Mutter gefragt: „Was ist ein Halbblut?“ Gertrud hat ihre Tochter erstaunt angesehen. „Wie kommst du darauf?“ „Wir mussten in der Schule so einen Spruch auswendig lernen: ‘Gott schuf den Weißen, Gott schuf den Schwarzen, aber der Teufel schuf das Halbblut’. Was ist das, ein Halbblut?“ Anna hat bemerkt, wie das Gesicht der Mutter bei ihrer Frage einen düsteren, verschlossenen Ausdruck annahm. „Das verstehst du noch nicht“, ist ihre kurze Antwort gewesen. Sie hat noch erzählen wollen, was der Lehrer zu ihr gesagt hat, aber eine innere Unsicherheit hat sie davon abgehalten. Die Mutter wollte anscheinend nicht darüber sprechen. Wie Szenen aus einem Film, ungeordnet aneinandergereiht, tauchen alle diese Bilder in ihrer Erinnerung auf. Und dann fällt ihr der Traum ein, den sie in der vergangenen Nacht geträumt hat: Sie geht einen langen Gang entlang. Zu beiden Seiten sind Türen. Die Türen sind geschlossen. Sie klopft an die erste Tür, aber keiner macht ihr auf. Sie versucht es bei der zweiten, aber auch dort öffnet niemand. Sie geht weiter zur dritten, zur vierten Tür, aber auch die bleiben verschlossen. Ihre Erregung wächst, als sie nun von Tür zu Tür läuft, anklopft und um Einlass bittet. Kein Mensch scheint sie zu hören, oder man will ihr nicht öffnen. Atemlos kommt sie bei der letzten Tür an. Sie ist ein bisschen größer als die übrigen, der Gang führt darauf zu. Sie klopft mit verzweifelter Kraft, und die Tür wird tatsächlich aufgemacht. Sie blickt in einen großen Raum, der voller Menschen ist, Männer und Frauen. Sie sitzen an Tischen und scheinen sich zu unterhalten. Als sie Anna sehen, fangen sie auf einmal alle an zu lachen. Erst ist es nur ein Kichern von Einzelnen, dann werden es mehr und immer mehr, aus dem Kichern wird Gelächter, und dieses Gelächter wird laut und immer lauter, schwillt an zu einem unheimlichen Getöse. Es dröhnt Anna in den Ohren und verursacht ihr Kopfschmerzen. Die Menschen in dem Raum zeigen mit dem Finger auf sie und hören nicht auf zu lachen. Erschrocken sieht Anna an sich herunter und stellt fest, dass sie nichts anhat, dass sie nackt ist. Furcht und Panik ergreifen sie. Sie läuft, wie von Furien gehetzt, wieder zurück durch den Gang.
| Erscheinungsdatum | 31.01.2021 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Familiensaga Ellinor Wohlfeil ; 1 |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 130 x 195 mm |
| Gewicht | 374 g |
| Einbandart | Englisch Broschur |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | 1. Weltkrieg • 20er Jahre • 2. Weltkrieg • Dadaismus • Familiensaga • Frauenschicksal • Gesellschaftliche Entwicklung • Judenverfolgung • Kriegszeit • Nachkriegszeit • Nationalsozialismus • Wilhelminisches Zeitalter • Winternähe |
| ISBN-10 | 3-95667-365-4 / 3956673654 |
| ISBN-13 | 978-3-95667-365-8 / 9783956673658 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich