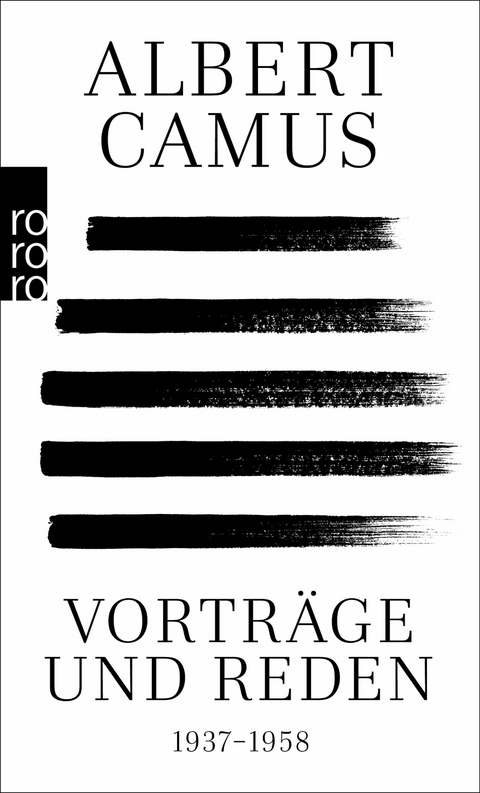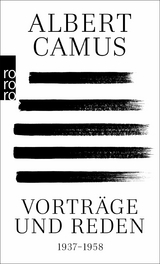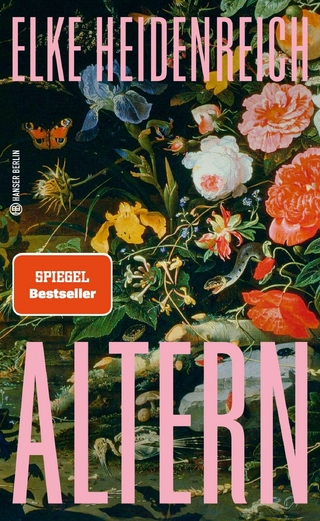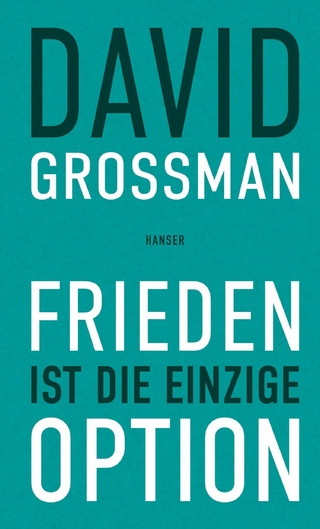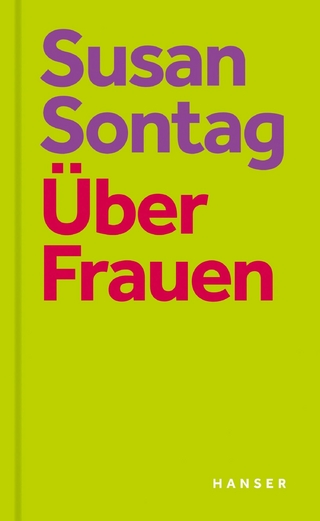Vorträge und Reden (eBook)
416 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-00457-3 (ISBN)
Albert Camus wurde am 7. November 1913 als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi, Algerien, geboren. Er studierte an der Universität Algier Philosophie, 1935 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei und gründete im Jahr darauf das «Theater der Arbeit». 1937 brach er mit der KP. 1938 entstand sein erstes Drama, Caligula, das 1945 uraufgeführt wurde, 1947 sein Roman «Die Pest». Neben seinen Dramen begründeten der Roman Der Fremde und der Essay Der Mythos des Sisyphos sein literarisches Ansehen. 1957 erhielt Albert Camus den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Autounfall. Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.
Albert Camus wurde am 7. November 1913 als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi, Algerien, geboren. Er studierte an der Universität Algier Philosophie, 1935 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei und gründete im Jahr darauf das «Theater der Arbeit». 1937 brach er mit der KP. 1938 entstand sein erstes Drama, Caligula, das 1945 uraufgeführt wurde, 1947 sein Roman «Die Pest». Neben seinen Dramen begründeten der Roman Der Fremde und der Essay Der Mythos des Sisyphos sein literarisches Ansehen. 1957 erhielt Albert Camus den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Autounfall. Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor. Andreas Fliedner (* 1966) studierte Religionswissenschaft, Philosophie und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Er übersetzt aus dem Französischen und Englischen. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bilden politische Philosophie und Ideengeschichte, daneben legte er auch literarische Übersetzungen vor.
Die Krise des Menschen
1946
Im Frühjahr 1946 wurde Albert Camus von der Abteilung für kulturelle Beziehungen des französischen Außenministeriums eingeladen, eine Reihe von Vorträgen in den USA zu halten. Während der Überfahrt verfasste er Die Krise des Menschen. Camus hielt den Vortrag erstmals am 28. März 1946 bei einer Veranstaltung in der Columbia University, bei der auch Vercors[1] und Thimerais[2] sprachen. Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten trug er den Text noch mehrfach in einer leicht erweiterten Version vor, deren Typoskript im Nachlass von Dorothy Norman[3] (Beinecke Library, Yale University) entdeckt wurde. Diese Fassung liegt der folgenden deutschen Übersetzung zugrunde. Dorothy Norman veröffentlichte Die Krise des Menschen Ende 1946 in der von ihr herausgegebenen Zeitschrift Twice a Year in einer englischen Übersetzung von Lionel Abel.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
als man mir vorschlug, in den Vereinigten Staaten von Amerika Vorträge zu halten, kamen mir sogleich Bedenken, und ich zögerte. Ich bin noch nicht im Alter für Vorträge und fühle mich wohler beim Nachdenken, als wenn ich gezwungen bin, apodiktische Aussagen zu treffen. Denn ich wähne mich nicht im Besitz dessen, was man gemeinhin die Wahrheit nennt. Nachdem ich meine Bedenken vorgebracht hatte, antwortete man mir überaus freundlich, es gehe nicht darum, ob ich eine persönliche Meinung hätte. Wichtig sei, dass ich in der Lage wäre, meinen Zuhörern jene wenigen grundlegenden Informationen über Frankreich zu vermitteln, anhand derer sie sich ihrerseits eine Meinung bilden könnten. Also schlug man mir vor, meine Zuhörer über die aktuelle Lage des französischen Theaters, der französischen Literatur und sogar der Philosophie zu unterrichten. Ich antwortete, es wäre vielleicht ebenso interessant, über die außerordentlichen Leistungen der französischen Eisenbahner zu sprechen oder über die Bedingungen, unter denen die Bergleute in Nordfrankreich arbeiten. Daraufhin machte man mich zutreffend darauf aufmerksam, dass man stets bei seinem Leisten bleiben solle und Spezialfragen am besten von Fachleuten behandelt würden. Da ich mich schon seit längerem für Fragen der Literatur interessiere, während ich, was das Stellen von Weichen betraf, keinerlei Kenntnisse vorweisen könne, liege es nahe, dass man mich über Literatur sprechen lassen wolle statt über die Eisenbahn.
Jetzt hatte ich endlich begriffen. Es ging, kurz gesagt, darum, über etwas zu sprechen, worin ich mich auskannte, und auf diese Weise eine Vorstellung von Frankreich zu vermitteln. Und genau darum habe ich mich entschlossen, weder über die Literatur noch über das Theater zu sprechen. Denn in der Literatur, im Theater, in der Philosophie, in der geistigen Suche und den Anstrengungen eines ganzen Volkes spiegelt sich nichts anderes wider als eine grundlegende Ungewissheit, ein Kampf um das Leben und um den Menschen: Und das ist bei uns die alles entscheidende Frage des Augenblicks. Die Franzosen spüren, dass der Mensch unaufhörlich bedroht ist, und sie spüren zudem, dass sie nicht weiterleben können, wenn eine bestimmte Idee vom Menschen nicht aus der Krise gerettet wird, welche die Welt erschüttert. Daher, aus Treue zu meinem Land, habe ich mich entschieden, über die Krise des Menschen zu sprechen. Und da es darum ging, über etwas zu sprechen, womit ich mich auskenne, habe ich es für das Beste gehalten, so präzise wie möglich das geistige Erleben der Menschen meiner Generation nachzuzeichnen. Denn sie haben diese weltumspannende Krise in ihrem ganzen Ausmaß erlebt, und ihre Erfahrungen können sowohl das absurde Geschick der Franzosen als auch einen Aspekt ihres heutigen Weltempfindens ein wenig erhellen.
Lassen Sie mich zunächst den Standort dieser Generation bestimmen. Die Menschen meines Alters in Frankreich und Europa wurden kurz vor oder während des Ersten Weltkriegs geboren, haben als Jugendliche die Weltwirtschaftskrise erlebt und waren bei Hitlers Machtergreifung zwanzig Jahre alt. Um ihren Bildungsweg zu vervollständigen, folgten der Spanische Bürgerkrieg, das Münchner Abkommen, der Krieg von 1939, die Niederlage und vier Jahre Besatzung und Untergrundkampf. Man kann also davon ausgehen, dass es sich bei ihnen um das handelt, was man eine interessante Generation nennt. Und daher wird es für Sie, meine Damen und Herren, vermutlich informativer sein, wenn ich weniger in meinem eigenen Namen spreche als vielmehr im Namen einer gewissen Anzahl von Franzosen, die heute dreißig Jahre alt sind und die ihre Geistes- und Herzensbildung während jener schrecklichen Jahre erworben haben, in denen sie sich, gemeinsam mit ihrem Land, von der Schmach genährt und ihre Lebenskraft aus der Auflehnung bezogen haben.
Ja, es handelt sich um eine interessante Generation, vor allem, weil sie, angesichts der absurden Welt, in die sie hineingeboren wurde, an nichts glaubte und in einem Zustand der Auflehnung lebte. Die Literatur ihrer Zeit lehnte sich auf gegen die Klarheit, das Erzählen, ja den Satz als solchen. Die Malerei lehnte sich auf gegen das Sujet, die Realität und die schlichte Harmonie. Die Musik verweigerte sich der Melodie. Was die Philosophie anging, so lehrte sie, dass es keine Wahrheit gäbe, sondern nur Phänomene: dass es zwar einen Mister Smith, einen Monsieur Durand und einen Herrn Vogel geben könne, dass diese drei Einzelphänomene jedoch nichts miteinander gemeinsam hätten. Die moralische Haltung dieser Generation war noch entschiedener: Der Nationalismus erschien ihr überholt, die Religion eine Ausflucht. Fünfundzwanzig Jahre internationaler Politik hatten sie gelehrt, an jeder reinen Lehre zu zweifeln, und sie zu der Überzeugung gebracht, dass niemand unrecht hatte, da jeder recht haben konnte. Was die überlieferte Moral unserer Gesellschaft anging, so erschien sie uns als das, was sie stets gewesen war, nämlich eine ungeheure Heuchelei.
Wir verneinten also alles. Natürlich war das nichts Neues. Andere Generationen, andere Länder haben in anderen geschichtlichen Epochen dieselbe Erfahrung gemacht. Neu war jedoch, dass ebendiese Menschen, denen alle Werte fremd waren, eine persönliche Haltung angesichts von Mord und Terror finden mussten. In dieser Situation drängte sich ihnen der Gedanke auf, dass es möglicherweise eine Krise des Menschen gab, denn sie sahen sich gezwungen, im schmerzhaftesten aller Widersprüche zu leben. Sie sind wahrhaftig in den Krieg gegangen, wie man das Tor zur Hölle durchschreitet, wenn es zutrifft, dass die Hölle die Selbstverleugnung ist. Sie hatten weder Geschmack am Krieg noch an der Gewalt, doch sie mussten den Krieg akzeptieren und selbst Gewalt anwenden. Das Einzige, was sie hassten, war der Hass. Und doch mussten sie die schwierige Kunst des Hassens erlernen. In offenkundigem Widerspruch zu sich selbst, ohne auf irgendwelche überlieferten Werte zurückgreifen zu können, mussten sie das quälendste Problem lösen, das sich den Menschen je gestellt hat. Wir haben also auf der einen Seite eine ganz eigentümliche Generation, wie ich sie gerade beschrieben habe, und auf der anderen Seite eine die ganze Welt und das gesamte menschliche Bewusstsein umfassende Krise, die ich nun so klar wie möglich charakterisieren will.
Worin also besteht diese Krise? Statt sie im Allgemeinen zu charakterisieren, möchte ich sie zunächst durch vier kurze Geschichten veranschaulichen, die aus einer Zeit stammen, die die Welt bereits zu vergessen beginnt, die uns jedoch noch immer ein Pfahl im Fleisch ist.
1) In einem von der Gestapo genutzten Gebäude einer europäischen Hauptstadt sitzen nach einer Verhörnacht zwei Beschuldigte noch blutend und gefesselt da, während die Concierge anfängt, sorgfältig Ordnung zu machen – in aller Seelenruhe, da sie zuvor wohl gut gefrühstückt hat. Als ihr einer der beiden Gefolterten Vorhaltungen macht, antwortet sie empört mit einem Satz, der übersetzt etwa lauten würde: «Ich stecke meine Nase nie in die Angelegenheiten meiner Mieter.»
2) In Lyon wird einer meiner Kameraden aus seiner Zelle geholt und zum dritten Mal zum Verhör gebracht. Da man ihm bei einem vorherigen Verhör die Ohren in Fetzen geschlagen hat, trägt er einen Verband um den Kopf. Der deutsche Offizier, der ihn abführt, war schon bei den ersten Verhörsitzungen dabei, und doch erkundigt er sich mit einem Anflug von Anteilnahme und Fürsorge: «Und, wie geht es unseren Ohren heute?»
3) In Griechenland will ein deutscher Offizier nach einer Partisanenaktion drei Brüder erschießen lassen, die er als Geiseln genommen hat. Die alte Mutter wirft sich ihm zu Füßen, und er willigt ein, einen der Brüder zu verschonen, jedoch nur unter der Bedingung, dass sie selbst ihn auswählt. Weil sie sich nicht entscheiden kann, stellt man alle drei an die Wand. Da wählt sie den Ältesten, weil er eine Familie zu ernähren hat, aber im selben Atemzug verurteilt sie damit die beiden anderen zum Tode – so wie es der deutsche Offizier wollte.
4) Eine Gruppe von Frauen, unter denen sich eine unserer Kameradinnen befand, wird aus der Deportation über die Schweiz nach Frankreich zurückgebracht. Kaum auf Schweizer Territorium angelangt, treffen sie auf eine zivile Beerdigung. Und dieser Anblick allein reicht aus, um sie in hysterisches Gelächter verfallen zu lassen: «So also behandelt man hier die Toten» ist ihr einziger...
| Erscheint lt. Verlag | 18.5.2021 |
|---|---|
| Übersetzer | Andreas Fliedner |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Die Pest • Essays • Existenzialismus • Frankreich • Literaturnobelpreis • Literaturnobelpreisträger • Maria Casarès • Nobelpreis für Literatur • Nobelpreis Literatur • Nobelpreisträger Literatur • Philosophie • Vorträge |
| ISBN-10 | 3-644-00457-9 / 3644004579 |
| ISBN-13 | 978-3-644-00457-3 / 9783644004573 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich