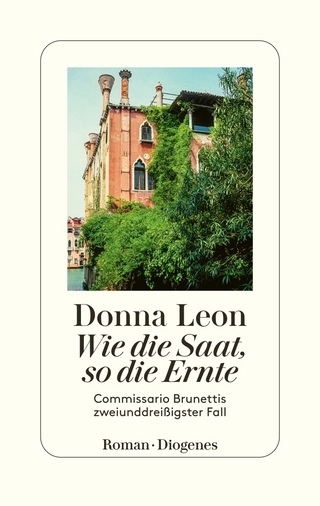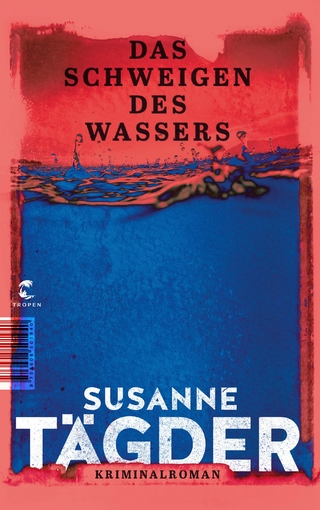Die Tinktur des Todes
Pendo (Verlag)
978-3-86612-472-1 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Zur gleichen Zeit tritt der Medizinstudent Will Raven seine Stelle bei dem brillanten und renommierten Geburtshelfer Dr. Simpson an, in dessen Haus regelmäßig bahnbrechende Experimente mit neu entdeckten Betäubungsmitteln stattfinden. Hier trifft Will auf das wissbegierige Hausmädchen Sarah, die jedoch einen großen Bogen um ihn macht und sofort erkennt, dass er ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt.
Beide haben ganz persönliche Motive, die Morde aufklären zu wollen. Ihre Ermittlungen führen sie in die dunkelsten Ecken von Edinburghs Unterwelt und nur, wenn es ihnen gelingt, ihre gegenseitige Abneigung zu überwinden, haben sie eine Chance, lebend wieder herauszufinden.
Ambrose Parry ist das gemeinsame Pseudonym von Christopher Brookmyre und Marisa Haetzman. Das Paar ist verheiratet und lebt in Schottland. Brookmyre arbeitete nach seinem Studium der Englischen Literatur- und Theaterwissenschaften als Journalist in London, Los Angeles und Edinburgh. Der mehrfach preisgekrönte Autor hat über zwanzig Romane veröffentlicht, darunter internationale Bestseller. Marisa Haetzman ist Medizinhistorikerin und hat zwanzig Jahre als Anästhesistin gearbeitet. Ihre Forschungsarbeit zur modernen Anästhesie inspirierte das Paar zu seinem ersten gemeinsamen Roman »Die Tinktur des Todes«.
Atmosphärische Spannung trifft auf gefährliche medizinische Experimente.
"Eine Aufsehen erregende Kriminalgeschichte vor dem Hintergrund medizinischer Experimente im Edinburgh des 19. Jahrhunderts. Das Buch lässt sowohl die Stadt als auch die Epoche lebendig werden und ist eine großartige Lektüre." Ian Rankin
"Parrys viktorianisches Edinburgh wird auf eindringliche Weise lebendig - als Welt des Schmerzes." Val McDermid
Kapitel 1 Eine gute Geschichte sollte nicht mit einer toten Dirne beginnen – dafür bitte ich um Verzeihung –, schließlich handelt es sich nicht um ein Thema, mit dem achtbare Menschen sich gern zu befassen pflegen. Doch gerade die Überzeugung, die braven Leute Edinburghs würden sich solch einer Angelegenheit niemals widmen, führte Will Raven im Winter 1847 auf seinen schicksalhaften Weg. Zwar hätte Raven die Entdeckung der unglücklichen Evie Lawson ungern als Beginn seiner eigenen Geschichte betrachtet gewusst, doch trieb ihn vor allem die Entschlossenheit an, dass es nicht das Ende der ihren bleiben durfte. Er fand sie in einer kalten, schiefen, kleinen Dachkammer im vierten Stock am Canongate. Es stank nach Alkohol und Schweiß, kaum abgemildert von einer angenehmeren Note: einem Damenduft, wenn auch einem billigen, der nur eine käufliche Dame verhieß. Wenn er mit diesem Geruch in der Nase die Augen schloss, konnte er sich vorstellen, sie wäre noch dort und würde sich gleich zum dritten oder vierten Mal in ebenso vielen Stunden wieder hinunter auf die Straße schleppen. Doch seine Augen standen offen, und er brauchte auch nicht nach dem fehlenden Puls zu tasten, um sich zu versichern. Raven war mit dem Sterben vertraut und erkannte, dass ihr Übergang von diesem Leben ins nächste kein leichter gewesen war. Die Laken waren zerwühlt, also hatte sie sich wohl stärker gewunden als jemals zuvor in gespielter Leidenschaft, und Raven fürchtete, es habe länger gedauert als jede Zusammenkunft mit einem ihrer Freier. Ihr Körper ruhte ganz und gar nicht in Frieden, sondern er lag vollkommen verrenkt da, als quälte sie immer noch der Schmerz, der sie fortgetragen hatte, als hätte der Tod ihr keine Erlösung gebracht. Ihre Stirn blieb zerfurcht, ihr Mund aufgesperrt. In den Mundwinkeln hatte sich Schaum gesammelt. Raven legte die Hand auf ihren Arm und zog sie schnell wieder zurück. Er erschrak vor der Kälte, auch wenn er es nicht hätte sollen. Schließlich war er den Umgang mit Leichen gewohnt, nicht allerdings den mit einer Leiche, deren Berührung im warmen Zustand er gekannt hatte. In diesem Augenblick des Kontaktes bewegte ihr Übergang von einem Menschen zu einer Sache in ihm etwas Uraltes. Schon viele Männer vor ihm hatten in diesem Zimmer gesehen, wie Evie sich verwandelte: vom Objekt äußerster Begierde zum armseligen Gefäß des ungewollten Samens, angebetet bis zum Moment des Ergusses, dann verhasst. Doch nicht er. Wann immer sie beieinander gewesen waren, hatte er sich allein mit einer Verwandlung befasst – mit dem Wunsch, sie alledem zu entheben. Er war nicht bloß ein weiterer Freier. Sie waren Freunde: Nicht wahr? Deshalb hatte sie ihm doch ihre Hoffnung verraten, einmal eine Anstellung als Dienstmädchen in einem ehrbaren Hause zu finden, und deshalb hatte er auch versprochen, sich ihrethalben zu erkundigen, sobald er in den rechten Kreisen verkehrte. Deshalb hatte sie ihn um Hilfe gebeten. Sie hatte ihm nicht sagen wollen, wofür das Geld war, nur dass es eilte. Raven vermutete, dass sie es jemandem schuldete, doch der Versuch, ihr zu entlocken, wem, war aussichtslos. Dazu war Evie viel zu erfahren in der Kunst der Täuschung. Jedenfalls wirkte sie außerordentlich erleichtert und versicherte ihm unter Tränen ihre Dankbarkeit, als sie die Summe hatte. Er verriet ihr nicht, woher er das Geld hatte, und verschwieg die Sorge, dass er nun womöglich bei demselben Geldleiher in der Kreide stand und Evies Schuld lediglich auf sich überschrieben hatte. Letztere betrug zwei Guineas, von denen er gut und gerne mehrere Wochen hätte leben können und zu deren Rückzahlung er folglich nicht unmittelbar imstande war. Das sorgte ihn aber nicht. Er wollte helfen. Raven wusste, dass manche die Vorstellung belächelt hätten, doch wenn Evie glaubte, sie könne sich als Dienstmädchen neu erfinden, dann wollte er es um ihretwillen doppelt glauben. Doch das Geld hatte sie nicht gerettet, und nun gab es keinen Ausweg mehr. Er sah sich im Zimmer um. Die Reste zweier Kerzen flackerten in alten Ginflaschen, während eine dritte schon vor Langem ganz abgeschmolzen war. Im winzigen Kamin glommen noch schwach die Reste eines Feuers, in das sie normalerweise schon vor Stunden sparsam Kohlen aus der Schütte nachgelegt hätte. Am Bett stand eine flache Schüssel Wasser, über deren Rand nasse Lappen hingen, daneben ein Krug. Damit wusch sie sich hinterher. In der Nähe lag eine Flasche Gin in einem Pfützchen, das zeigte, wie wenig noch darin gewesen war, als sie umkippte. Die Flasche trug kein Etikett, ihre Herkunft war unbekannt und deshalb verdächtig. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass irgendein Hinterhoffuselbrenner versehentlich einen Todestrunk gepanscht hatte. Komplizierter wurde diese Deutung aber durch den Anblick einer noch halb vollen Flasche Brandy auf der Fensterbank. Die hatte wohl ein Freier mitgebracht. Raven fragte sich, ob dieser auch Evies Todesqualen beigewohnt und die Flasche in der Eile, dem Nachspiel zu entfliehen, zurückgelassen hatte. Wenn Ersteres stimmte, warum hatte er dann nicht um Hilfe gerufen? Wahrscheinlich, weil es für manche ebenso schlimm wäre, mit einer kranken Buhldirne erwischt zu werden wie mit einer toten, warum sollte man also die Aufmerksamkeit auf sich lenken? Das war Edinburgh: öffentlicher Anstand und heimliche Sünde, Stadt Tausender Doppelleben. Genau. Manchmal brauchte es nicht mal einen Erguss, damit sich das Gefäß verwandelte. Er sah sich noch einmal die glasige Leere ihrer Augen an, die verzerrte Fratze, die nichts mehr mit ihrem Gesicht gemein hatte. Er schluckte, weil er einen Kloß im Hals hatte. Zum ersten Mal hatte Raven sie vier Jahre vorher gesehen, als er noch Internatsschüler an George Heriot’s School für vaterlose Jungen gewesen war. Er erinnerte sich gut an die Tuscheleien der älteren Jungen, die wussten, wen sie vor sich hatten, wenn sie sie auf dem Cowgate sahen. Sie waren voll dieser seltsamen Mischung aus lüsterner Faszination und ängstlichem Spott gewesen, misstrauisch gegenüber all dem, was ihr eigener Instinkt sie spüren ließ. Sie wollten sie, sie hassten sie, selbst damals schon. Nichts hatte sich seitdem geändert. In dem Alter wirkte die Zukunft ungreifbar, auch wenn er darauf zuraste. Für Raven war Evie die Gesandte einer Welt, die er noch nicht bewohnen durfte. Aus diesem Grunde betrachtete er sie als jemanden, der über ihm stand, auch dann noch, als er merkte, dass die Zukunft bereits da war, und erfuhr, wie überaus greifbar gewisse Dinge in Wirklichkeit waren. Sie wirkte so viel älter, so viel weltgewandter, bis er mit der Zeit verstand, dass sie nur einen kleinen, düsteren Teil der Welt kennengelernt hatte, und den weit ausgiebiger, als es eine Frau jemals sollte. Eine Frau? Ein Mädchen. Er erfuhr später, dass sie fast ein Jahr jünger war als er. Sie musste vierzehn gewesen sein, als er sie auf dem Cowgate gesehen hatte. Wie sie in seiner Vorstellung gewachsen war zwischen jenem Moment und dem, als er sie zum ersten Mal besessen hatte: ein Versprechen wahrer Fraulichkeit und all dessen, was er sich davon erträumte. Ihre Welt war klein und armselig gewesen. Sie verdiente es, einmal eine größere, eine bessere kennenzulernen. Deshalb hatte er ihr das Geld gegeben. Das war nun genauso fort wie sie, und Raven hatte nicht den geringsten Hinweis, wofür er mit seinen Schulden hergehalten hatte. Einen Augenblick lang war ihm, als würden Tränen kommen, aber ein wachsamer Instinkt ermahnte ihn, sich von diesem Ort zu entfernen, bevor er gesehen wurde. Er verließ das Zimmer mit leisen Schritten und schloss behutsam die Tür. Als er die Treppe hinabschlich, kam er sich wie ein Dieb und Feigling vor, der Evie zurückließ, um seinen Ruf zu schützen. Von anderswo auf dem Stockwerk hörte er Kopulationsgeräusche, die übertriebenen Schreie einer jungen Frau, die Ekstase vortäuschte, um das Ende herbeizuführen. Raven fragte sich, wer Evie nun finden würde. Wahrscheinlich ihre Vermieterin: die durch und durch verschlagene Effie Peake. Obgleich sie gern Unwissenheit vorschützte, wenn es ihr nutzte, entging ihr wenig von dem, was unter ihrem Dach geschah, zumindest bevor sie sich am Abend dem Gin hingab. Raven war sich aber sicher, dass es dafür noch zu früh war, weshalb er besonders leise auftrat. Er ging durch die Hintertür, vorbei am Küchenabfallhaufen, und kam über dreißig Meter von der Vordertür entfernt aus einer Gasse auf das Canongate. Unter dem schwarzen Himmel war die Luft kühl, aber alles andere als frisch. Hier stank es aus allen Winkeln vor Unflat, so viele Leben stapelten sich im schmutzigen Labyrinth der Old Town, ganz wie bei Bruegels Turmbau zu Babel oder Botticellis Karte der Hölle. Raven wusste, dass er für eine letzte Nacht in sein kaltes, freudloses Zimmer in der Bakehouse Close zurückkehren sollte. Am nächsten Tag stand ihm ein vollständiger Neuanfang bevor, für den er sich ausruhen musste. Nach allem, was er gesehen hatte, würde der Schlaf aber ohnehin ausbleiben. Es war weder eine Nacht für Einsamkeit noch für Nüchternheit. Das einzige Gegenmittel gegen das Aufeinandertreffen mit dem Tod bestand in einer innigen Umarmung des Lebens, auch wenn es eine übel riechende, verschwitzte und grobe war. Kapitel 2 Aitken’s Tavern war ein Sumpf aus Leibern, ein Don nerlärm aus Männerstimmen, die einander immer lauter zu übertönen suchten, und das Ganze in einen dichten Pfeifendunst gehüllt. Raven selbst frönte dem Tabak nicht, genoss aber seine Süße in der Nase, ganz besonders in einem Lokal wie diesem, wo er andere Gerüche überdeckte. Raven stand an der Bar, trank Ale und redete mit niemand Besonderem, allein, aber nicht einsam. An diesem warmen Platz konnte man sich gut verlieren, das Stimmengewirr bot seinen Gedanken einen besseren Hintergrund als jede Stille, aber ihm war auch die Ablenkung durch die verschiedenen Gespräche willkommen, als wäre jedes von ihnen eine winzige Szene, die sich zu seiner Zerstreuung abspielte. Es wurde über den Bau der neuen Caledonian Railway Station am Ende der Princes Street gesprochen, und Sorgen wurden geäußert, dass nun Horden hungernder Iren aus Glasgow einfallen würden. Jedes Mal, wenn er sich umdrehte, sah er Gesichter, die er kannte, manche schon aus der Zeit, als er ein Lokal wie dieses noch gar nicht betreten durfte. Die Old Town wimmelte von Tausenden von Menschen, die man ein Mal auf der Straße sah und danach nie wieder, und doch hatte sie gleichzeitig etwas von einem Dorf. Wo man auch hinschaute, fand man vertraute Gesichter – und ebenso vertraute Augenpaare, die einem folgten. Er bemerkte einen Mann mit uraltem, lumpigem Hut, der mehr als einmal einen Blick in seine Richtung warf. Raven erkannte ihn nicht, aber jener ihn offensichtlich schon, und sein Blick zeugte kaum von Zuneigung. Sicher jemand, mit dem er sich einmal geprügelt hatte, wobei das Bier nicht nur den Streit herbeigeführt, sondern auch Ravens Gedächtnis getrübt hatte. Lumpenhuts sauertöpfischer Miene nach zu urteilen hatte er wohl den Kürzeren gezogen. Womöglich war der Alkohol aber nicht der einzige Grund gewesen, zumindest auf Ravens Seite. Manchmal hatte er ein düsteres Verlangen in sich, auf das er mittlerweile achtgab, wenn auch nicht genug, um es vollkommen zu beherrschen. An diesem Abend hatte er es wieder im Zwielicht der Dachkammer gespürt, und er konnte nicht sagen, ob er hierhergekommen war, um es zu ertränken oder zu bestärken. Er erwiderte Lumpenhuts Blick noch einmal, woraufhin der zur Tür huschte. Er bewegte sich zielgerichteter als wohl die meisten Männer, die einen Pub verlassen, und warf noch einen letzten Blick auf Raven, bevor er in die Nacht entschwand. Raven widmete sich wieder seinem Bier und dachte nicht mehr an ihn. Als er seinen Krug wieder hob, schlug ihm eine Hand auf den Rücken, verweilte und griff seine Schulter. Instinktiv ballte er die Faust, holte aus und fuhr herum. »Langsam, Raven! Begrüßt man so einen Kollegen? Erst recht einen, der noch genügend Kleingeld in der Tasche hat, um es mit seinem Durst aufzunehmen?« Es war sein Freund Henry, den er wohl im Getümmel übersehen hatte. »Entschuldigung«, erwiderte Raven. »Man kann heutzutage im Aitken’s gar nicht mehr vorsichtig genug sein, das Lokal hat nachgelassen. Wie ich höre, lassen sie mittlerweile sogar schon Chirurgen rein.« »Einen Mann von deinen Aussichten hätte ich auch gar nicht mehr in einer Schenke der Old Town erwartet. Du hast Großes vor dir. Den besten Einstand wird es sicher nicht abgeben, wenn du dich deinem neuen Arbeitgeber nach durchzechter Nacht vorstellst.« Henry scherzte, das wusste Raven, aber doch war es ein Wink zur rechten Zeit, dass er es nicht übertreiben durfte. Ein, zwei Gläser würden ihm sicher schlafen helfen, aber jetzt, da er Gesellschaft hatte, würde es wahrscheinlich nicht dabei bleiben. »Und du selbst? Erwarten dich am Morgen denn keine Verpflichtungen?«, erwiderte Raven. »Doch, in der Tat, aber da ich meinen alten Freund Will Raven verhindert wähnte, ersuchte ich den Beistand meiner beiden Gefährten Hopfen und Malz, um den Kummer meines heutigen Tagewerks abzumildern.« Henry reichte ein paar Münzen über die Theke, und ihre Krüge wurden wieder aufgefüllt. Raven dankte ihm und sah zu, wie Henry einen großen Schluck trank. »Eine beschwerliche Schicht also?«, fragte Raven. »Eingeschlagene Schädel, gebrochene Knochen und ein weiterer Tod durch Peritonitis. Wieder eine junge Frau, armes Ding. Wir konnten ihr nicht helfen. Professor Syme konnte den Auslöser nicht ermitteln, was ihn in äußerste Rage versetzte und natürlich die Schuld aller anderen war.« »Es wird also eine Obduktion geben?« »Ja. Zu schade, dass du nicht dabei sein kannst. Klügeren Rat als unser derzeitiger Pathologe wüsstest du mit Sicherheit. Der ist oft ebenso alkoholgetränkt wie die Präparate in seinem Labor.« »Eine junge Frau, sagst du?«, fragte Raven und dachte an die, die er eben erst zurückgelassen hatte. Evie würde keine solche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie gefunden wurde. »Ja, warum?« »Einfach so.« Henry trank einen großen Schluck und musterte Raven nachdenklich. Der ahnte, welcher peinlichen Untersuchung er ausgesetzt war. Henry war ein begnadeter Diagnostiker, und das nicht nur im Bereich körperlicher Gebrechen. »Geht es dir gut, Raven?«, fragte er mit aufrichtigem Ton. »Besser, wenn ich das hier intus habe«, erwiderte er und gab sich Mühe, fröhlicher zu klingen. Doch Henry ließ sich nicht so leicht täuschen. »Du hast bloß … diesen Blick, vor dem ich mich schon vor Langem in Acht zu nehmen gelernt habe. Weder teile ich deine krankhafte Hadersucht, noch möchte ich dich später zusammenflicken müssen, wenn ich eigentlich schlafen sollte.« Raven wusste, dass ihm keine Widerrede zustand. Alle Anschuldigungen waren wahr, auch der Funke dieses düsteren Verlangens, der an diesem Abend in ihm glomm. Doch das Bier würde ihn auslöschen, da war er sich nun, in Henrys Gesellschaft, sicher. Du hast den Teufel in dir, hatte seine Mutter ihn als Kind oft ermahnt. Manchmal geschah das im Scherz, manchmal weniger. »Ich habe jetzt gute Aussichten, Henry«, versicherte er, schob etwas Geld über die Theke und bat mit einer Geste, die zwei Krüge nachfüllen zu lassen, »und ich habe nicht vor, sie aufs Spiel zu setzen.« »In der Tat gute Aussichten«, antwortete Henry. »Doch warum der geschätzte Professor der Geburtshilfe gerade einem Schurken wie dir einen solch begehrten Posten angeboten hat, bleibt mir ein Rätsel.« So ungern er es zugab, beschäftigte diese Frage auch ihn. Er hatte hart für die Anerkennung des Professors gearbeitet, aber es hatte mehrere gleichermaßen gewissenhafte und arbeitsame Mitbewerber um die Famulatur gegeben. Er hatte keinen festen Anhaltspunkt, warum gerade er den Vorzug bekommen hatte, und er dachte nur ungern darüber nach, ob diese Entscheidung womöglich aus einer flüchtigen Laune heraus getroffen worden war. »Der Professor kommt selbst aus einfachen Verhältnissen«, sagte Raven, was Henry ebenso wenig zufriedenstellen dürfte wie ihn selbst. »Vielleicht glaubt er, dass derartige Gelegenheiten nicht allein den Hochwohlgeborenen vorbehalten bleiben sollten.« »Oder er hat eine Wette verloren, und du bist die Schuld.« Das Bier floss und mit ihm die alten Geschichten. Das half. Evies Anblick flackerte ihm immer wieder vor Augen wie die Kerzen in ihrer Kammer. Aber während er Henry zuhörte, musste er an die Welt denken, die Evie nicht zu sehen bekommen hatte, an die Gelegenheit, die ihn auf der anderen Seite der North Bridge erwartete. Ein Teil seiner Liebe zu diesem Ort und der Old Town im Allgemeinen war an diesem Abend gestorben. Es war an der Zeit, das alles zurückzulassen, und wenn jemand an Neuanfänge glaubte, dann Will Raven. Er hatte sich schon einmal neu erfunden, und er würde es nun wieder tun. Mehrere Bierkrüge später standen sie draußen vor Aitken’s und sahen ihren Atem in der kühlen Luft zu Dampf werden. »Es war schön, dich mal wieder zu sehen«, sagte Henry. »Aber ich muss zu Bett. Syme operiert morgen, und er ist hundsgemein, wenn er bei seinen Assistenten noch Tabak und Bier vom Vorabend riecht.« »Ja, ›hundsgemein‹ passt auf Syme«, erwiderte Raven. »Obwohl mir da noch ganz andere Tiere einfallen würden. Ich kehre einstweilen noch ein letztes Mal in mein Quartier bei Mrs Cherry zurück.« »Du wirst sie und ihr klumpiges Porridge sicher noch vermissen«, rief Henry, als er in Richtung Infirmary auf die South Bridge einbog. »Ganz zu schweigen von ihrer überschäumenden Wesensart.« »Die und Syme würden sicher ein gutes Paar abgeben«, rief Raven zurück, ging über die Straße und Richtung Osten auf seine Unterkunft zu. An gewisse Umstände seiner Zeit hier würde Raven sich wohl einmal voller Nostalgie, ja Wehmut erinnern, aber seine Bleibe zählte nicht dazu. Ma Cherry war ein zänkisches altes Weib, das seinem Namen nur insoweit gerecht wurde, als auch sie rund und rot war, aber süß war an ihr überhaupt nichts. Sie war sauer wie Ohrenschmalz und vertrocknet wie eine Wüstenleiche, aber sie führte eine Pension, die zu den günstigsten der Stadt zählte; in Sachen Komfort und Sauberkeit eine Stufe über dem Zuchthaus. Der Wind blies ihm einen kalten Nieselregen um die Ohren, als er die High Street hinab Richtung Netherbow ging. Seit er bei Aitken’s aufgebrochen war, waren Wolken aufgezogen, und das Mondlicht war verschwunden. Ihm fiel auf, dass manche der Straßenlaternen dunkel blieben, sodass es fast unmöglich war, den Kothaufen auf dem Trottoir auszuweichen. Im Stillen verfluchte er den Laternenanzünder, der seine doch sicher recht einfache Arbeit nicht getan hatte. Wenn er selbst so nachlässig wäre, würden Menschen sterben. Das Anzünden der Laternen fiel genauso in den Zuständigkeitsbereich der Polizei wie das Sauberhalten der Gosse. Vorrang vor allem anderen aber hatte für sie die Ermittlung und Rückführung gestohlenen Eigentums. Wenn sie dieser Pflicht ebenso gewissenhaft nachkam wie ihren anderen, konnte jeder Dieb in den Lothian Districts ruhig schlafen, dachte Raven. Als er sich der Bakehouse Close näherte, trat er in etwas Weiches, und sein linker Schuh füllte sich mit Wasser; zumindest hoffte er, dass es Wasser war. Er hinkte ein paar Meter und versuchte abzuschütteln, was noch an seiner Sohle hing. Dann merkte er, dass eine Gestalt aus einem Eingang getreten war und ein Stück weit vor ihm stand. Er fragte sich, worauf der Bursche wartete und warum er im immer stärkeren Regen verweilte. Bis Raven in der Dunkelheit sein Gesicht erkannte, war er dem anderen so nah gekommen, dass er auch schon den Gestank seiner Zahnfäule roch. Seinen Namen kannte Raven nicht, aber er hatte ihn schon einmal gesehen: einer von Flints Männern. Raven hatte ihn »das Wiesel« getauft, weil er verstohlen wirkte und ein Nagetiergesicht hatte. Das Wiesel war sicher niemand, der Raven allein entgegentreten würde, also hatte er vermutlich einen Spießgesellen in der Nähe. Wahrscheinlich den etwas lahmgeistigen Burschen, der auch zuletzt bei ihm war: Stummel, wie Raven ihn nannte, weil ihm nur noch ein einzelner Zahn aus dem ruinierten Kiefer ragte. Wahrscheinlich war Raven ein paar Augenblicke zuvor an ihm vorbeigekommen, ohne es zu merken. Er lauerte sicher in einem anderen Hauseingang, um Raven den Weg abzuschneiden, falls er wegrannte. Dieses Treffen beruhte nicht auf Zufall. Ihm fiel wieder der Mann ein, der ihn angestarrt und dann so zielstrebig das Lokal verlassen hatte. »Mr Raven, Sie gehen mir doch nicht etwa aus dem Weg, oder?« »Da mir nichts einfällt, was mir Ihre Gesellschaft anempfehlen würde, wäre es tatsächlich ein allgemeiner Vorsatz meinerseits, Ihnen auszuweichen, nur ahnte ich nicht, dass ich gesucht werde.« »Wer Mr Flint etwas schuldet, wird immer gesucht. Aber Sie können sich meiner Abwesenheit gewiss sein, sobald Sie Ihre Schulden beglichen haben.« »Beglichen? Ich schulde die Summe doch kaum vierzehn Tage! Wie wäre es also, wenn Sie mir schon mal einen Vorschuss auf Ihre Abwesenheit geben und mir aus dem Weg treten?« Raven schob sich an ihm vorbei und ging weiter. Das Wiesel versuchte weder, ihn aufzuhalten, noch folgte es gleich. Es wartete wohl auf seinen Spießgesellen. Das Wiesel und Stummel waren es gewohnt, bereits gebrochenen Männern auch noch die Knochen zu brechen, und vielleicht hatte irgendein feiger Instinkt gespürt, dass Raven einem Kampf nicht ganz abgeneigt war. Zuvor hatte das Bier vielleicht das Feuer in ihm gelöscht, aber der Anblick dieser Afterblüte ließ es wieder auflodern. Raven ging langsam und hörte die Schritte hinter sich. Er suchte im Zwielicht nach einer Waffe. Alles konnte als solche dienen – man musste nur wissen, wie. Sein Fuß stieß an etwas Hölzernes, und Raven hob es auf. Es war ein gesplitterter, ansonsten aber recht solider Stock. Raven fuhr herum, richtete sich gleichzeitig auf und holte mit dem Knüppel in der Rechten aus, als in seinem Kopf etwas explodierte. Alles war Licht und eine Peitschenbewegung, als würde sein schlaffer Körper von seinem Kopf mitgerissen. Zu plötzlich, als dass er sich hätte abfangen können, knallte er auf das nasse Pflaster, dass die Knochen klapperten. Benommen öffnete er die Augen und sah auf. Der Schlag hatte ihm wohl das Bewusstsein genommen, denn er fantasierte. Über ihm stand ein Monster. Ein Riese. Von einer weit über zwei Meter großen Kreatur wurde er in eine dunkle Gasse geschleift. Schon der Kopf war doppelt so groß wie der jedes Menschen, die Stirn unmöglich hervorgewachsen wie ein Felsvorsprung an einer Klippe. Raven war gelähmt vor Schmerz und Schock und unfähig, sich zu regen, als dieser Gargantua sich vor ihm aufbäumte und mit dem Absatz auf ihn einstampfte. Ravens eigener Schrei hallte von den Mauern wider, als der Schmerz in ihm aufwallte. Er wand sich und zog alle Gliedmaßen nah an sich, bevor das baumstammartige Bein seines Angreifers noch einmal wie vom Vorschlaghammer getrieben auf ihn niederging. Gargantua setzte sich rittlings auf ihn, sodass das bloße Gewicht seiner Schenkel Ravens Arme an den Boden heftete. Alles an diesem Monster wirkte gestreckt und außer Proportion, als wären manche seiner Teile einfach weitergewachsen und hätten den Rest zurückgelassen. Als es den Mund öffnete, zeigten sich gleichmäßige Lücken zwischen den Zähnen, also hatten die Kiefer sich wohl noch um sie ausgedehnt. Der Schmerz war unbeschreiblich, und das Wissen, dass Gargantuas Fäuste jeden Moment ungehindert auf ihn einprügeln konnten, machte ihn noch schlimmer. Kein Alkohol konnte ausreichen, seine Sinne davor zu betäuben, sonst würden die Operationssäle mehr Whisky verbrauchen als Aitken’s. In seinem Kopf tobte ein Sturm, zusammenhängende Gedanken waren zwischen Qual und Verwirrung kaum zu fassen, aber eins schien klar: Der Versuch war aussichtslos, sich zu wehren. Wollte dieses Monster ihn töten, würde er hier in dieser Gasse sterben. Gargantuas Gesicht bot einen grotesken Anblick, es war wilder und verzerrter als das jeden Wasserspeiers an einer Kirchenmauer, aber vor allem seine dicken, wurstartigen Finger zogen im Zwielicht Ravens Blick auf sich. Da seine eigenen Hände hilflos fixiert waren, war er allem ausgeliefert, was diese gigantischen Pranken mit ihm anstellen wollten. Raven war erleichtert, als sie seine Taschen durchwühlten, was aber nur kurz währte, denn ihm fiel ein, dass dort nicht viel zu holen war. Gargantua hatte Ravens wenige verbleibende Münzen in der Hand, als das Wiesel aus dem Schatten trat, das Geld einsteckte und sich neben das Monster hockte. »Ach, auf einmal sind wir gar nicht mehr so vorlaut, was, Mr Raven?« Das Wiesel zog ein Messer aus der Tasche und hielt es ins spärliche Licht der Gasse, damit Raven es sah. Es war gut zehn Zentimeter lang, die Klinge dünn und um den Holzgriff ein blutverschmierter Lumpen gewickelt. Raven betete stumm um ein schnelles Ende seiner Tortur. Vielleicht ein aufwärtsgerichteter Stich unter die Rippen. Das Perikard würde sich mit Blut füllen, sein Herz aufhören zu schlagen, und es wäre vorbei. »Da ich nun Ihre Aufmerksamkeit habe, lassen Sie uns einmal mit dem gebührenden Ernst über Ihre Schulden bei Mr Flint sprechen.« Die Masse des Monsters auf sich und die Kehle vor Schmerz zugeschnürt, fand Raven kaum den Atem zum Sprechen. Das merkte das Wiesel wohl, denn es bedeutete dem Riesen, gerade so viel Gewicht von Raven zu nehmen, dass er ein Flüstern herausbekam. »Wie uns zu Ohren gekommen ist, haben Sie Ihr Licht unter dem Scheffel gehalten. Seit Ihnen die Summe geliehen wurde, erfuhren wir, dass Sie der Sohn eines vornehmen Anwaltes in St Andrews sind. Nach einer neuerlichen Einschätzung Ihres Status hat Mr Flint also das erwartete Rückzahlungsdatum etwas vorgezogen.« Auch wenn Gargantua ihn nicht mehr erdrückte, spürte Raven nun ein anderes Gewicht auf sich. Es war die Last einer Lüge, die gemäß dem Gesetz der unvorhergesehenen Folgen zum Lügner zurückgekehrt war. »Mein Vater ist schon lange tot«, keuchte er. »Meint ihr, wenn ich mir etwas von ihm hätte leihen können, hätte ich mich an Wucherer und Halsabschneider gehalten?« »Das mag sein, aber ein Anwaltssohn dürfte in der Not auch auf andere Bekanntschaften zurückgreifen können.« »Kann ich nicht. Aber wie ich Flint schon sagte, als ich mir das Geld lieh: Ich habe Aussichten. Wenn ich Geld verdiene, kann ich die Schulden mit Zinsen zurückzahlen.« Das Wiesel beugte sich ein wenig tiefer zu ihm herab, und der Gestank aus seinem Mund war schlimmer als alles, was in der Gosse liegen mochte.Kapitel 3 Raven blieb eine Weile in der Dunkelheit liegen und richtete seine ganze Aufmerksamkeit aufs Atmen. Nun, da seine Angreifer fort waren, erfüllte ihn eine tiefe Erleichterung, eine höchste Freude darüber, dass er nicht tot war. Unglücklicherweise drückte diese sich im unerwarteten Drang zu lachen aus, wogegen seine Rippen heftig aufbegehrten. Waren sie gebrochen? Wie große Verletzungen hatte er davongetragen? Waren Organe gequetscht worden? Er stellte sich vor, wie zwischen den Schichten seines Brustfells Blut tröpfelte, Druck auf die lädierte Lunge ausübte und ihre Ausdehnung auch jetzt noch einschränkte, da das Monster nicht mehr auf ihm war. Er vertrieb die Vorstellung aus seinem Kopf. Wichtig war nur, dass er fürs Erste noch atmete, und solange das so war, hatte er gute Aussichten. Er legte sich wieder die Hand auf die Wange. Sie war nass vor Blut und matschig wie eine Druckstelle an einem Pfirsich. Die Wunde war tief und breit. Er konnte nicht einfach in sein Zimmer bei Mrs Cherry zurückkehren, ohne die Verletzung versorgen zu lassen. Raven schleppte sich zur Infirmary Street, wo er beschloss, die Pförtnerloge und die strengen Fragen wegen seines Äußeren zu meiden. Stattdessen folgte er der Mauer bis zu der Stelle, über welche die Chirurgen gern kletterten. Henry und seine Kollegen nutzten diesen Einstieg nach nächtlichen Ausflügen, da diese eine scharfe Maßregelung nach sich ziehen konnten. In seinem geschwächten Zustand benötigte er mehrere Anläufe, aber schließlich hievte Raven sich hinüber und stieg durch das niedrige Fenster nach drinnen, das zu diesem Zweck stets entriegelt war. Er schlurfte über den Flur und lehnte sich an die Wand, wenn das Atmen zu schwer und schmerzhaft wurde. Ohne Zwischenfall schlich er an der chirurgischen Abteilung vorbei und hörte durch die Tür lautes Schnarchen. Das Geräusch kam wahrscheinlich von den Nachtpflegern, die oft die Weine und Spirituosen als Schlafmittel missbrauchten, welche eigentlich für die Patienten bereitstanden. Raven kam an Henrys Tür und klopfte wieder und wieder, während jede Sekunde seine Angst wachsen ließ, Henry könnte nach dem Pub-Besuch nicht mehr ansprechbar sein. Schließlich schlug die Tür nach innen auf, und Henrys verschlafenes, zerzaustes Gesicht erschien dahinter. Seine erste Regung war der Schrecken vor der Kreatur, die ihn da mitten in der Nacht heimsuchte, dann erst erkannte er Raven. »Herrgott, Raven! Was zum Teufel ist dir denn zugestoßen?« »Es hat jemandem missfallen, dass ich nichts Stehlenswertes bei mir hatte.« »Wir gehen gleich nach unten. Das muss genäht werden.« »Die Diagnose hab ich auch schon gestellt«, sagte Raven. »Kennst du denn einen fachkundigen Chirurgen?« Henry warf ihm einen bösen Blick zu. »Fordere mich nicht heraus!« Raven legte sich hin und versuchte, sich zu entspannen, was nicht leichtfiel, da Henry sich seinem aufgeschlitzten Gesicht mit einer großen Nadel näherte. Raven zählte im Geiste nach, wie oft Henrys Krug wieder aufgefüllt worden war, und überschlug die Folgen für seine Fingerfertigkeit. Aber ob betrunken oder nüchtern, selbst die sauberste Naht würde ihm eine Narbe nicht ersparen, die in Zukunft immer den ersten Eindruck einer neuen Bekanntschaft prägen würde. Das würde sicher auch Auswirkungen auf sein Fortkommen haben, aber darüber durfte er gerade nicht nachdenken. Seine oberste Priorität lautete: nicht bewegen, was aber die gewaltigen Schmerzen und der Anblick von Henrys Nadel nicht erleichterten. »Ich weiß ja, dass es schwierig ist, aber ich muss dich doch bitten, stillzuhalten und auch nicht zu zucken, wenn ich anfange. Die Wunde reicht bis nah ans Auge, und wenn die Naht misslingt, wird es hängen.« »Dann werde ich dich nur noch mit scheelem Blick ansehen können«, erwiderte Raven. »Warum das?«, fragte Henry; dann verstand er. »Herrgott, Raven!« Henrys Gesicht war lustiger als der Scherz, aber jegliche Erleichterung, die es Raven brachte, forderte einen Tribut von seinen Rippen. Raven lag still und versuchte, sich aus dem Hier und Jetzt zu entfernen, damit er die Prozedur weniger bewusst erlebte. Allerdings war sein erstes Ziel unwillkürlich Evies Kammer, sodass ihm der Anblick ihrer gekrümmten Leiche vor Augen kam, als Henrys Nadel zum ersten Mal in seine Wange eindrang. Er merkte, wie sie sich durch die Haut in die weiche Schicht darunter bohrte, und stellte sich unvermittelt vor, wie sie in einer Bogenbewegung die Wunde querte, bevor sie wieder emporkam, als er spürte, wie das Katgut sein geschundenes Gesicht zusammenzurrte. Das schmerzte weit mehr als des Wiesels Messer, dem er nur wenige Sekunden lang ausgesetzt gewesen war. Er hob die Hand, als Henry sich an den zweiten Stich machen wollte. »Hast du Äther da?«, fragte er. Henry sah ihn missbilligend an. »Nein. Du wirst es eben aushalten müssen. Schließlich amputieren wir dir hier ja kein Bein.« »Das sagt sich leicht. Hast du dir schon einmal das Gesicht nähen lassen?« »Nein, und dieses Glück könnte darauf zurückzuführen sein, dass ich auch nicht dazu neige, den Mond anzubellen und Streit mit den Zwielichtgestalten der Old Town vom Zaun zu brechen.« »Ich habe gar keinen Streit vom … au!« »Schweig still!«, forderte Henry, der nun weiternähte. »Ich kann nicht arbeiten, wenn deine Wange sich bewegt.« Raven starrte ihn undankbar an. »Der Äther versagt ohnehin zuweilen den Dienst«, erklärte Henry und zog das Katgut straff. »Syme hat ihn schon beinahe aufgegeben, und da nun vor Kurzem jemand an dem Zeug gestorben ist, dürfte das der letzte Nagel im Sarg sein.« »Jemand ist daran gestorben?« »Ja. Irgendwo unten in England. Der Pathologe sagte, es sei eine unmittelbare Folge des Äthers, aber Simpson hält immer noch daran fest.« Henry hielt inne. »Du kannst ihn ja selbst danach fragen, wenn du morgen bei ihm anfängst.« Den Kopf dicht über Ravens Gesicht gebeugt fuhr Henry mit dem Nähen fort. Raven roch das Bier in seinem Atem. Gleichwohl arbeitete Henry mit ruhiger Hand, und Raven gewöhnte sich an den Rhythmus aus Stich und Straffen. Kein Stich war weniger schmerzhaft als der vorangegangene, andererseits tat auch keiner so weh wie seine Rippen. Henry trat einen Schritt zurück und begutachtete sein Werk. »Nicht schlecht«, verkündete er. »Vielleicht sollte ich mir vor jeder Operation ein paar Krüge bei Aitken’s genehmigen.« Henry weichte ein Stück Mull in kaltem Wasser ein und legte es auf die Wunde. Die Kühle tat überraschend gut, die erste angenehme Empfindung seit Ravens letztem Schluck Ale. »Aber in dem Zustand kann ich dich nicht zurück in die Arme von Mrs Cherry schicken«, sagte Henry. »Ich gebe dir eine Dosis Laudanum und stecke dich in mein Bett. Ich kann den Rest der Nacht auf dem Boden schlafen.« »Ich stehe in deiner Schuld, Henry, wirklich. Aber bitte erwähne nicht noch einmal die Arme von Mrs Cherry. In meinem derzeitigen Zustand lässt mich die Vorstellung sonst womöglich brechen.« Henry musterte ihn mit analytischem Starren, aber sein Ton war verschmitzt. »Du weißt doch sicher, dass sie für eine gewisse Zusatzgebühr Sonderdienstleistungen anbietet, oder?«, sagte er. »Wie ich höre, haben viele junge Gäste in ihren Armen Trost gesucht. Sie ist Witwe und braucht das Geld. Das ist keine Schande. Ich meine, mit der Narbe und dem hängenden Auge musst du vielleicht bald deine Ansprüche etwas anpassen.« Nachdem sie wieder nach oben gegangen waren, führte Henry Raven zu seinem Bett, wo der sich vorsichtig niederließ. Es tat ihm an mehr Stellen gleichzeitig weh, als ihn jemals einzeln geschmerzt hatten. Seine Wange war durchzogen von Katgut, und auch ohne Scherz würde er seine Erwartungen an eine zukünftige Ehefrau tatsächlich senken müssen. Aber es hätte alles viel schlimmer kommen können. Er lebte noch, und morgen wartete ein neuer Anfang. »So«, sagte Henry, »nun sollst du dein Laudanum bekommen. Aber falls du dich übergeben musst, vergiss bitte nicht, dass ich neben dir auf dem Boden liege, und ziele auf meine Füße, nicht auf den Kopf.« Kapitel 4 Sarah verweilte im Büro des Professors, als es klingelte, eine unliebsame, aber unvermeidliche Unterbrechung dieses Moments der Ruhe. Hier erfüllte sie ihre Pflichten mit besonders viel Zeit und Sorgfalt, weil sie sich allzu gern in diesem Raum aufhielt. Er war ein Ort des Friedens in völliger Abgeschiedenheit vom Chaos des übrigen Hauses, aber die Zeiten der Zuflucht waren selten und meist von kurzer Dauer. Mit dem Feuer hatte sie sich besondere Mühe gemacht und mit der Kohle nicht gegeizt. Im Winter wie im Sommer brannte der Kamin, damit es die Patienten warm hatten, die der Doktor hier behandelte, aber es war ein besonders kalter Tag, und der Raum brauchte eine Weile, um aufzutauen. Innen am Fenster neben dem Schreibtisch des Doktors hatte sich eine zarte Eisblume gebildet, die verschwand, als sie sie anhauchte. Sie wischte die Feuchtigkeit mit einem Lappen ab und genoss eine Weile die Aussicht. An klaren Tagen wie diesem konnte man bis nach Fife sehen. So hatte man es ihr zumindest gesagt. Sie selbst war noch kaum über die Vororte Edinburghs hinausgekommen. Auf dem Tisch am Fenster türmten sich Bücher und Manuskriptstapel, um die Sarah vorsichtig herumwischen musste. Mit der Zeit hatte sie ihre Technik perfektioniert, aber während des Lernprozesses hatte sie mehrfach verirrte Blätter vor dem Feuer retten müssen. So einladend hatte der Raum nicht immer gewirkt. Als sie neu in Dr. Simpsons Dienst getreten war, hatte sie schreckliche Angst vor allem gehabt, was ihr dort begegnete. An einer Wand stand eine hohe Vitrine, auf deren Böden sich Gläser mit anatomischen Präparaten aneinanderreihten: allerlei menschliche Organe in gelblicher Flüssigkeit. Viele davon waren verletzt, krank oder missgebildet, als wäre ihre bloße Gegenwart nicht schon genug. Mit der Zeit jedoch war ihre Faszination für all das geweckt worden, selbst für das Glas, das zwei winzige Babys Gesicht an Gesicht, am Brustbein aneinandergewachsen, enthielt. Als sie es zum ersten Mal gesehen hatte, war sie von Fragen umgetrieben worden, wo so etwas herkommen mochte und wie es beschafft worden war. Ebenso fragte sie sich, ob es überhaupt anständig war, ein solches Präparat zu verwahren, diese offensichtlich menschlichen Überreste zu konservieren, statt die beiden zu beerdigen. War es statthaft, so etwas auszustellen? War es falsch, es sich anzuschauen? Der untere Teil der Vitrine bestand aus einem geschlossenen kleinen Schrank und enthielt die Lehrmaterialien für die Geburtshilfevorlesung des Professors. Sarah wusste nicht, ob es erlaubt war, den Inhalt des Schränkchens zu erkunden, aber da es ihr nicht ausdrücklich verboten worden war, hatte sie ihrer Neugier nachgegeben, wenn ausnahmsweise einmal Zeit gewesen war. Es enthielt eine seltsame Sammlung von Beckenknochen und Geburtshilfeinstrumenten, deren jeweilige Verwendung sie nur erraten konnte. Natürlich lag dort eine Geburtszange, die Sarah schon kannte, aber es gab auch andere, mysteriösere Gerätschaften, die als Cephalotribe, Kranioklast oder Perforator ausgewiesen waren. Die Namen allein klangen schon brutal, und Sarah konnte sich nicht vorstellen, was diese Werkzeuge bei der Geburt eines Kindes zu suchen hatten. In der mangelnden Organisation des Zimmers im Allgemeinen und der Bibliothek im Besonderen erkannte man ihren Herrn wieder. Diesen Missstand hätte Sarah nur allzu gern einmal behoben, hätte sie die Zeit dafür gehabt. Bücher standen an scheinbar zufällig gewählten Orten im Regal. Zum Beispiel stand ein in rotes Leder gebundenes Shakespeare-Kompendium zwischen der Familienbibel und der Edinburgh Pharmacopoeia, bei der aus irgendeinem Grund eine Liste der Haustiere der Familie auf die Innenseite des Deckels gekritzelt war. Ehrfürchtig berührten ihre Finger jeden Buchrücken, während sie die Titel las: Paleys Natural Theology, Bells The Anatomy and Physiology of the Human Body, Adams Antiquities, Symes Principles of Surgery. Dann steckte Jarvis den Kopf durch den Türspalt. »Miss Grindlay ruft nach dir«, sagte er und verdrehte beim Gehen die Augen. Sarah ließ die Fingerspitzen noch einige Augenblicke auf den ledernen Buchrücken ruhen. Das war eine der großen Enttäuschungen ihrer Stelle: freier Zugriff auf eine bunte Sammlung von Büchern, aber nur allzu selten Gelegenheit, sie zu lesen. Ihre Hand verweilte auf einem Buch, das sie noch nie gesehen hatte. Sie zog es aus dem Regal und schob es sich in die Tasche. Als sie den Raum verließ und an die Treppe kam, ging ein Regen aus Zeitungspapier von den höheren Stockwerken auf sie nieder. Offensichtlich war der Doktor auf dem Weg nach unten. Er las gern die Tageblätter – den Scotsman und den Caledonian Mercury – in ihrer Gesamtheit, bevor er aus dem Bett stieg, und machte sich einen Spaß daraus, sie auf dem Weg nach unten über die Balustrade zu werfen. Das erfreute besonders die beiden älteren Kinder David und Walter, die die Seiten gern zerknüllten und damit einander und die Angestellten bewarfen; Jarvis dagegen weniger, der hinterher alles aufräumen musste. Sarah manövrierte sich zwischen niedersegelnden Seiten, begeisterten Kindern und dem murrenden Butler hindurch und stieg die Treppe hinauf. Als sie Aunt Minas Zimmer im dritten Stock betrat, sah sie sich dem üblichen Chaos gegenüber. Scheinbar war der gesamte Inhalt von Miss Mina Grindlays Kleiderschrank im Zimmer verteilt; Kleider und Unterröcke lagen auf jeder verfügbaren Fläche, ob Bett, Stuhl oder Boden. Mina selbst trug noch ihr Nachthemd und hielt sich vor dem Spiegel ein Kleid an, bevor sie es zu all den anderen warf. »Da bist du ja endlich, Sarah. Wo zum Kuckuck warst du denn?« Sarah ging davon aus, dass es sich um eine rhetorische Frage handelte, und blieb still. Mina schien fortwährend darüber entrüstet zu sein, dass Sarah auch andere Pflichten zu erfüllen hatte. Sie war das einzige Hausmädchen; wenn sie also nicht die Kohlen nachlegte, den Tee brachte, die Zimmer putzte und das Essen servierte, tat es niemand. Mrs Lyndsay verließ nur selten die Küche, und Jarvis, der Butler, Diener und allgemeines Faktotum, hatte schon alle Hände voll mit dem Doktor zu tun. »Wie oft habe ich schon gesagt«, fuhr Mina fort, »dass eine Dame meines Standes ein Kammermädchen haben sollte?« Fast jedes Mal, wenn ich hier hereinkomme, dachte Sarah. »Man erwartet doch wohl nicht von mir, dass ich mich allein ankleide.« »Mrs Simpson scheint es zu schaffen«, erwiderte Sarah. Minas Augen blitzten auf, und Sarah wusste sofort, dass sie zu vorlaut gewesen war. Sie wollte sich gleich entschuldigen, aber Mina sprach schon wieder, und sie nun zu unterbrechen wäre noch schlimmer. »Meine Schwester ist eine verheiratete Frau und noch dazu in Trauer. Die Auswahl ihrer Kleidung ist eine vollkommen triviale Angelegenheit.« Sarah dachte an Mrs Simpson in dem schweren schwarzen Bombasin, den sie nun schon seit Monaten trug, bleich und fahl von der langen Zeit im Haus. »Aber Sarah, du musst dir wirklich austreiben, jeden deiner Gedanken gleich herauszuplappern. Deine Meinung hast du für dich zu behalten, wenn dich niemand danach fragt. Als du die Stelle neu angetreten hast, habe ich das noch geduldet, aber vielleicht habe ich dir einen schlechten Dienst erwiesen, indem ich dich nicht schon früher in deine Schranken verwiesen habe. Wenn dir so etwas einmal vor jemand weniger Nachsichtigem unterläuft, hast du dich womöglich geradewegs auf die Straße geplappert, fürchte ich.« »Ja, Ma’am«, antwortete Sarah und senkte den Blick. »Vieles spricht für die Disziplin, seine Zunge im Zaum zu halten. Auch ich muss es oft tun, wenn ich nicht damit einverstanden bin, wie meine Schwester ihren Haushalt führt. Ich bin hier nur zu Gast und dankbar dafür, wie du auch dankbar für deine Anstellung sein solltest. Wir haben beide unsere Pflichten, und zu denen einer Frau meines Standes gehört eine geschmackvolle Kleidung.« Mina deutete auf den Kleiderberg auf dem Bett, was bedeuten sollte, dass Sarah ihr bei der Auswahl helfen musste. »Wie ist es denn mit dem hier?« Sarah hielt ein schlichtes graues Seidenkleid mit Spitzenkragen hoch, den sie erst am Vortag gestärkt und gebügelt hatte. Mina betrachtete das Kleid einige Minuten kritisch. »Ach, es wird wohl reichen müssen«, sagte sie, »auch wenn ich fürchte, dass es keinen Mann nach der Feder greifen lassen wird, um mir ein Sonett zu widmen.« Sarah warf einen Blick auf Minas Schreibtisch. Wie immer lag dort ein halb fertiger Brief und daneben ein Roman. »Was lesen Sie denn gerade?«, fragte Sarah, die wusste, dass das Thema Literatur ihren Vorwitz schnell aus den Gedanken ihrer Herrin vertreiben würde. »Einen Roman namens Jane Eyre von Currer Bell. Ich bin gerade damit fertig. Mit diesem Schriftsteller war ich bisher noch nicht vertraut.« »Hat das Buch Ihnen gefallen?« »Das ist in diesem Fall eine vielschichtige Frage, die ich lieber mit einem Gegenüber besprechen möchte, das diesen Roman selbst gelesen hat. Also leih es dir gerne einmal aus.« »Danke, Ma’am.« Sarah schob sich das Buch in die Tasche neben den anderen schmalen Band, den sie zuvor aus der Bibliothek mitgenommen hatte. Da nun ein annehmbares Kleid ausgewählt war, legte Mina ihr Korsett an und stemmte die Hände in die Hüften, während Sarah die Schnüre straff zog. »Enger«, forderte Mina. »Dann können Sie doch nicht mehr atmen«, erwiderte Sarah, als sie weiterzerrte. »Unfug«, sagte Mina. »Ich habe noch nie die Besinnung verloren, auch wenn alle anderen Damen aus meinem Bekanntenkreis mit großer Regelmäßigkeit ohnmächtig dahinsinken. Manchmal geradezu theatralisch«, fügte sie hinzu, und ein angedeutetes Lächeln umspielte ihre Lippen. Als Mina angemessen gekleidet war, musste Sarah sie frisieren. Das dauerte bedeutend länger als das Schnüren des Korsetts. Eine Stärkemixtur musste aufgetragen werden, damit das Haar den Tag über die Form hielt. Vorne wurde es mittig gescheitelt, geflochten und um die Ohren geschlungen. Ab der Linie von Ohr zu Ohr wurde das Haar nach hinten zu einem festen Dutt gedreht. Die Aufgabe erforderte Geduld und Präzision, zwei Qualitäten, die Sarah im Bereich des Frisierens anscheinend fehlten. »Und deshalb brauche ich ein Kammermädchen«, sagte Mina zu ihrem Spiegelbild und schürzte die Lippen angesichts von Sarahs Bemühungen. »Ich weiß ja, dass du dein Bestes gibst, Sarah, aber ohne die richtige Art von Hilfe werde ich nie einen Ehemann finden.« »Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Miss Grindlay«, antwortete Sarah, die dankbar Bürste, Kamm und Haarnadeln ablegte. »Die Sache ist nur, dass gutes, zuverlässiges Personal so schwer zu finden ist. Du weißt ja, welche Schwierigkeiten Mrs Simpson hat, ein geeignetes Kindermädchen zu bekommen.« Der schnelle Personalwechsel dieser Position war Sarah nicht verborgen geblieben. Die Simpsons hatten drei Kinder: David, Walter und den kleinen James. David und Walter hielten sich nur selten im Kinderzimmer im obersten Stock auf und folgten stets ihrer natürlichen Neugierde, und die bisherigen Kindermädchen hatten sich dagegen gesträubt, dass dieses Verhalten nicht nur erlaubt, sondern sogar bestärkt wurde. Zudem gab Mrs Simpson offenbar nur ungern die Verantwortung für ihre Kinder aus der Hand, was wohl darauf zurückzuführen war, dass sie bereits zwei in jungem Alter verloren hatte. »Den Sheldrakes ist gerade eins ihrer Dienstmädchen abhanden gekommen«, fuhr Mina fort und wandte sich dabei im Sitzen nach Sarah um. »Welches denn?« »Ich glaube, sie hieß Rose. Kennst du sie?« »Nur flüchtig. Die andere, Milly, kenne ich etwas besser. Was ist denn passiert?« »Durchgebrannt. Einfach so. Es gab Gerüchte, sie treffe sich mit einem jungen Mann. Genauer gesagt mit mehreren, wie es hieß.« Mina wandte sich wieder dem Spiegel zu und trug etwas Rouge auf die Wangen auf. Sarah rührte es selbst aus Weingeist, Wasser und Cochenille-Pulver an. Sie fragte sich, warum ein Dienstmädchen nicht auf männliche Aufmerksamkeit aus sein durfte, wenn genau das doch anscheinend Minas Lebensinhalt war. »Ich habe sie noch letzte Woche getroffen«, sagte Sarah. »Vor Kennington and Jenner’s.« »Was für einen Eindruck machte sie?«, fragte Mina und drehte sich wieder um. »Einen guten«, erwiderte Sarah, denn sie war sich bewusst, dass sie zu einer neutralen Antwort verpflichtet war. In Wahrheit hätte Rose zwar auf jeden einen guten Eindruck gemacht, der sie noch nie gesehen hatte, aber Sarah war gleich ihr missmutiges Auftreten aufgefallen. Sie hatte Rose und ihre Herrin getroffen, als sie gerade aus dem Laden an der Princes Street kamen. Mrs Sheldrake blieb stehen, um mit einer Bekannten Höflichkeiten auszutauschen, sodass sich auch für Sarah und Rose die Gelegenheit dazu bot, wenn auch etwas verhaltener. Wie Sarah Mina berichtet hatte, war sie mit Roses Kollegin Milly vertrauter. In Millys Worten war Rose »temperamentvoll«, eine höfliche Umschreibung, denn eigentlich fand sie das Mädchen kapriziös und eingebildet und war bei ihr instinktiv misstrauisch. Rose hatte an dem Tag untypisch reserviert gewirkt, als würde Schwereres auf ihr lasten als die Pakete, die sie trug. Sie war blass, die Augen verquollen, und sie sagte wenig zu Sarahs vorsichtigen Erkundigungen nach ihrer Gesundheit. Sarah hatte einen Blick auf Roses Herrin geworfen, eine korpulente Frau von etwa dem gleichen Alter wie Mrs Simpson, die aber deutlich älter wirkte. Dies lag teils an ihrem Äußeren, um das sie sich nicht sonderlich zu kümmern schien, und teils an ihrer strengen Miene. Mr Sheldrake hatte Sarah noch nicht kennengelernt, also fragte sie sich, wie er wohl aussehen mochte. Mrs Sheldrakes Zorn war berüchtigt, und meistens entlud er sich auf die jungen Frauen in ihrem Dienst. Zweifellos traf er Rose öfter als andere, aber diese leblose Niedergeschlagenheit schien mehr als nur die Folge einer gehörigen Standpauke. Vielleicht war da einiges zusammengekommen, hatte Sarah überlegt und sich um ihre eigene Zukunft gesorgt. Wenn das Leben als Dienstmädchen selbst jemandem wie Rose die Freude nehmen konnte, was mochte es dann bei ihr bewirken? »Nun steh nicht dumm herum, Sarah«, sagte Mina, denn das Thema von Roses Verschwinden war schon vergessen. »Du hast doch sicher andere Pflichten.« Sarah verließ das Zimmer, stieg die Treppe hinab und dachte an die vielen Arbeiten, die sie hätte erledigen können, während sie Mina in ihr Kleid gezwängt und ihr Haar gebändigt hatte. Wie immer gab es mehr Aufgaben als Stunden, in denen sie erfüllt werden konnten, und heute musste sie zusätzlich noch eins der Gästezimmer für die Ankunft des neuen Famulus des Doktors vorbereiten. Sarah fragte sich, ob er sich zu einem gewissen Interesse an Mina würde bewegen lassen können. Das würde dann wenigstens all die zusätzliche Arbeit aufwiegen.
| Erscheinungsdatum | 22.08.2020 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Die Morde von Edinburgh ; 1 |
| Übersetzer | Hannes Meyer |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | The Way of All Flesh |
| Maße | 136 x 205 mm |
| Gewicht | 538 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Literatur ► Krimi / Thriller / Horror ► Historische Kriminalromane |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | 1793 • 19. Jahrhundert • Anästhesie • Anästhesie • Arzt • Betäubungsmittel • Betäubungsmittel • Christopher Brookmyre • Detektiv • Edinburgh • Frauenmorde • frühe Medizin • frühe Medizin • Gesellschaftspanorama • Großbritannien • Großbritannien • Historischer Kriminalroman • Historischer Roman • Ian Rankin • Leiche • Medizingeschichte • Mord • Mordfall • Romance • Schottland • Sherlock Holmes • spannend • spannende Bücher • spannende Bücher • spannende Krimis • Universität • Universität • Val McDermid • Vergiftung |
| ISBN-10 | 3-86612-472-4 / 3866124724 |
| ISBN-13 | 978-3-86612-472-1 / 9783866124721 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich