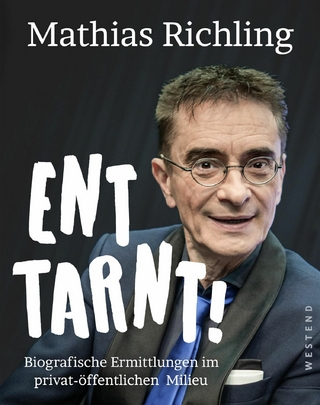»Mama und Papa hatte ich nicht, ich musste Renate und Eberhard sagen« (eBook)
240 Seiten
dtv Deutscher Taschenbuch Verlag
978-3-423-43396-9 (ISBN)
Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Er ist regelmäßiger Gast in verschiedenen Fernsehsendungen (u.a. im >Scheibenwischer< und im >Quatsch Comedy Club<, >Mitternachtsspitzen<) und Talkshows (u.a. >3 nach 9<, >Kölner Treff<, >NDR Talkshow<). Seit 2006 ist er Gastgeber der >SWR-Poetennächte<. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt >Das Dosenmilch-Trauma<. Es folgten >Flaschendrehen< (Erzählungen), >DanebenLeben< (Bildband), >Was sollen die Leute denken< (Monolog), >Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?< (Erzählungen), >Liebespaare bitte hier küssen< (Bildband) sowie der Roman >Bellboy<, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm >Was weg is´, is' weg< inspirierte. Zuletzt erschien sein Roman >Abschlussball< bei dtv. Seine CDs erscheinen bei WortArt. Preise: Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (Förderpreis), Deutscher Kabarettpreis, Prix Pantheon, Passauer Scharfrichterbeil, zuletzt: Kleinkunstpreis Baden-Würtemberg 2011.
Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Er ist regelmäßiger Gast in verschiedenen Fernsehsendungen (u.a. im ›Scheibenwischer‹ und im ›Quatsch Comedy Club‹, ›Mitternachtsspitzen‹) und Talkshows (u.a. ›3 nach 9‹, ›Kölner Treff‹, ›NDR Talkshow‹). Seit 2006 ist er Gastgeber der ›SWR-Poetennächte‹. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt ›Das Dosenmilch-Trauma‹. Es folgten ›Flaschendrehen‹ (Erzählungen), ›DanebenLeben‹ (Bildband), ›Was sollen die Leute denken‹ (Monolog), ›Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?‹ (Erzählungen), ›Liebespaare bitte hier küssen‹ (Bildband) sowie der Roman ›Bellboy‹, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm ›Was weg is´, is' weg‹ inspirierte. Zuletzt erschien sein Roman ›Abschlussball‹ bei dtv. Seine CDs erscheinen bei WortArt. Preise: Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (Förderpreis), Deutscher Kabarettpreis, Prix Pantheon, Passauer Scharfrichterbeil, zuletzt: Kleinkunstpreis Baden-Würtemberg 2011.
Meine Eltern waren Hippies
Meine Eltern waren 68er, und obwohl man das damals noch gar nicht so nannte, war das ausgesprochen hart für mich. Regelrechte Hardcore-Hippies waren sie, mit Flokati auf dem Kopf, Che Guevara in der Küche und Frank Zappa aufm Klo, aber hallo. Sie hörten den ganzen Tag Pink Floyd, da wurdest du blöd in der Birne als Kind. Was für mich allerdings erschwerend dazukam: Meine Eltern sind auch noch Bayern. Bayern und 68er! Das ist eine Kombination, die gibt es eigentlich gar nicht. Man möge sich das bildlich vorstellen, Franz Josef Strauß in Schlaghosen und mit einem Arafat-Schal um den nicht vorhandenen Hals oder auch Stoibers Sturschädel von Dreadlocks bedeckt. Ein Ding der Unmöglichkeit, bayerische 68er, da kreuzen sich bigotte Dumpfheit mit sexueller Revolution, Klerikertum mit K-Gruppe, Pink Floyd mit Volksmusik – wenn die sich vermehren, kann man sich ja vorstellen, was da rauskommt: Das sieht nicht gut aus.
Schon im Mutterleib schwante mir Böses, aber ich war von all den Pülverchen und bewusstseinserweiternden Kräutern, welche meine Mutter zu sich nahm, derart benebelt, dass ich meinen Plan, noch etwas länger im Fruchtwasser zu planschen, nicht verwirklichen konnte und pünktlich nach neun Monaten auf das im Wohnzimmer ausgelegte Tüchersammelsurium schwappte. An sich war das ganz nett, alle waren da, die Oma väterlicherseits, meine Mutter, einige Leute, die ich nicht kannte, und mein Erzeuger. Ich hatte ihn ja nie zuvor gesehen, mir ihn aber in etwa so vorgestellt. Er war groß, an den seltsamsten Stellen mit Haaren bedeckt, ein bisschen abgerissen gekleidet, und er ließ sein donnerndes Lachen erschallen, das ich schon im Ohr hatte. Geburtsschlag erhielt ich keinen (logisch, Pazifisten!), und ich dachte: Wird schon werden. Mein Vater nahm mich auf den Arm und begann mit mir erst mal über die Geburt zu reden, völlig zwanglos führte er mich ins Leben ein:
»Ja, griaß di. Servus in der Welt, Burschi, supa, dass’d da bist. He – kloaner Hos’nscheißer, welcome on örf. Wir müssen da jetza ned das Diskutier’n anfangen, schau’ a mal her: I bin der Eberhard und die, wo da noch so saublöd umanand flackt, des is’ die Renate.«
Was für eine Begrüßung! Es war noch viel schrecklicher, als ich in den dunkelsten embryonalen Stunden befürchtet hatte. Und das Schlimmste war: Ich verstand kein Wort. Das muss man sich mal vorstellen, man wird in diese Welt geworfen und versteht noch nicht einmal die eigenen Eltern – weil die so einen grauenvollen Dialekt sprechen. Die ersten Jahre verlebte ich eher unbewusst, da habe ich summa summarum gar nichts verstanden. Und Mama und Papa hatte ich ja nicht, ich musste immer Renate und Eberhard sagen. In diesem Punkt folgten meine Eltern konsequent den pädagogischen Maximen der frühen 70er-Jahre. Der Eigenname durfte um keinen Preis aufgegeben werden. Nur um das ein für alle Mal klarzustellen: Mama ist für ein Baby wesentlich leichter zu artikulieren als Renate!
Gestillt wurde ich, bis ich acht war, und dann gab’s Körner. Dass ich überhaupt gewachsen bin, darf getrost als Wunder bezeichnet werden. Es handelte sich im Übrigen um Körner, die sich heute in keinem Laden dieser Republik mehr auf legalem Wege erwerben lassen. Garniert wurden diese Verdauungsbremsen mit allerlei Farnen und Moosen, von denen auch nur meine Eltern meinten, dass sie überhaupt essbar waren. Das Grünzeug war selbstredend im eigenen Garten angebaut und ungespritzt. Meine Fresse, das hätte man gar nicht spritzen brauchen, da wäre kein Schädling der Welt freiwillig rangegangen. Alsdann zermanschte derjenige, der laut Kochplan an der Reihe war, das Ganze in einem hölzernen Bottich und verrührte den bizarren Sud in rituellen, kreisenden Bewegungen. Linksdrehend.
Gesalzen wurde nicht. O nein, kein Salz, in den Salinen beutete die herrschende Klasse schließlich die Arbeiter aus, und der Eberhard und die Renate wollten da ein Stück weit schon auch ein Zeichen setzen. Curry gab es ebenso wenig, handelte es sich dabei doch um ein Produkt des englischen Imperialismus. Ketchup war aus antiamerikanischen Gründen vollkommen ausgeschlossen. Ketchup? No way! Die Renate wetterte in ihrer unnachahmlichen Diktion:
»Man tunkt seine Pommes ned in das Blut von Fietnam!«
Pfeffer hatten die Herrenmenschen auf den Kreuzzügen geraubt, neulich erst, kam also auch nicht auf den Tisch. Man kann sagen, dass meiner Kindheit ein bisschen die Würze gefehlt hat. Die Suppe jedoch musste ich auslöffeln. Das war ein typischer Erziehungswiderspruch meiner Eltern: antiautoritär kochen, aber aufessen müssen. Natürlich wehrte ich mich mit Händen und Füßen, allein der Eberhard und die Renate verfügten über sämtliche didaktischen Aufess-Tricks. Als ob man eine Wahl gehabt hätte, tunkten sie den Löffel in die Pampe und säuselten etwas von »komm’, noch einen Happen für den Opa«, und zack, schon bekam ich mit dem Zeug den Mund gestopft. Dabei hatte ich überhaupt keinen Opa, aber es gab schlicht und ergreifend keine zwei Meinungen: »Ein Happa für den Onkel, ein Happa für die Oma …«, wie oft wünschte ich mir, dass in der Verwandtschaft möglichst bald wieder jemand sterben möge. (Obwohl ich diesen Wunsch immer gleich bereute, denn die Bärenmarken-Oma wollte ich keinesfalls gefährden.) Wenn es aber absolut ungenießbar wurde und ich mich partout weigerte, auch nur einen Bissen runterzuwürgen, griffen meine sonst so toleranten Eltern doch mal in die Knüppelkiste teutonischer Pädagogik:
»Wenn du des ned aufisst, Burschi, wenn du des ned aufisst, gibt’s morgen schlecht’ Wetter!«
Mein Gott, diese Verantwortung. Ich entschuldige mich hier in aller Form für so manch verregneten Sommer in den 70er- und 80er-Jahren. Aber ich hab’s einfach nicht runtergebracht, dafür gewann der Begriff »Hungerstreik«, der in den Gesprächen der Erwachsenen so oft fiel, für mich schon sehr früh an Bedeutung.
Was darüber hinaus ebenfalls den eher scheußlichen Dingen meiner Kindheit zugerechnet werden muss und zudem auch wenig appetitanregend wirkte: Meine Eltern waren immer nackt. Das war … also schön war es nicht. Der Eberhard und die Renate hatten nie was an zu Hause, das war open. Sie liefen wie Adam und Eva durch die Kommune und nahmen da überhaupt kein Blatt vor den Unterleib. Total open war das. Unser Haus besaß auch keine Türen, alles open, und immer wenn meine Eltern im Schlafzimmer waren, wenn sie in trauter Zweisamkeit im Bett lagen, wenn ›Wish you were here‹ auf dem Endlosband lief und wenn ich das alles in Ermangelung von Türen auch noch mit ansehen musste, riefen sie schnaufend:
»Geh weiter, Burschi, schau dir des ruhig an. Des ist Liebe.«
Die Renate kniete auf dem Bett und der Eberhard dotzte ihr von hinten mit seinem Unterleib gegen den Allerwertesten, also Liebe konnte ich da keine entdecken.
»Magst du koa Schwesterchen?«, fragte mich die Renate keuchend. »So geht des nämlich. Oder glaubst du noch an den Klapperstorch?« Dass sie überhaupt sprechen konnte, so wie sie traktiert wurde, wunderte mich, und mein Vater schrie:
»Schau her, so haben der Eberhard und die Renate dich auch g’macht, g’rad a so ham wir dich aa g’macht!« Dann brüllte er wie ein russischer Hammerwerfer beim entscheidenden letzten Versuch.
Also ich hätte echt kein Problem damit gehabt, vom Affen abzustammen, aber von Eltern, die so was so open machten, wollte ich nicht abstammen! Das sah vielleicht krank aus. Das konnte unmöglich die herkömmliche Art der Fortpflanzung gewesen sein, denn das hieße ja, dass dann alle so einen Eiertanz aufführten. Nein, nein, das war nur bei meinen Eltern so, und deswegen bin auch nur ich ein derartig verkorkster Typ geworden.
Heute kommt mir gelegentlich in den Sinn, dass das Liebesleben meiner Freunde und Bekannten streng genommen noch viel kranker aussieht. Viele haben gar keines. Das sind die neuen Werte, also die ganz alten: Keinen Sex vor der Ehe, kein Petting vor der Verlobung. Oder Blümchen-Sex. Oder Dr.-Sommer-Sex. Also irgendwas hat sich im Wertegefüge doch verschoben, wir sind so: politisch indifferent, sexuell desorientiert, aber immer gut gekleidet. Und: Wir haben fun. Aber hallo haben wir einen fun. Wir hoppen von Event zu Event, von Club zu Club und haben aber so was von fun. Und einmal im Jahr scheißen wir in den Tiergarten und haben Spaß dabei. Welch eine Entwicklung – von der freien Liebe zur Loveparade, evolution sucks!
Was allerdings die moderne Musik, von House bis Techno, von Rap bis Big Beat angeht, daran bin ich unschuldig. Erstens kenne ich mich da nicht aus und zweitens wurden mir meine Vorliebe für Computer-Sounds und meine ablehnende Haltung gegenüber West-Coast-Protest-Geschrammel und anderer Handmade-Musik quasi in die Wiege gelegt. Bereits im Alter von fünf Jahren schenkte mir der Eberhard eine Klampfe. Alle meine Freunde bekamen Playmobil und ich eine E-Gitarre! Die Renate pickte eine Pril-Blume auf den Korpus, und ich sollte mich freuen, schönen Dank auch, das Teil wog so schwer, dass ich es kaum halten konnte. Und das Problem mit Instrumenten ist ja vor allem das Erlernen ebendieser. An sich verlief die musikalische Entwicklung streng linear. Aus dem gemeinsamen Orff’schen Singspiel kristallisierten sich genau zwei Stränge heraus: die Flöteneleven, die später mal Sologeigerin oder zumindest Konzertcellist werden sollten, und die zukünftigen Klavierschüler. Letztere Gruppe...
| Erscheint lt. Verlag | 9.3.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Comic / Humor / Manga ► Humor / Satire |
| Schlagworte | 68er-Eltern • Anthologie • Antiautoritäre Erziehung • Erwachsenwerden • Flaschendrehen • Hippies • Humor • Kindheit in Bayern • Kurzgeschichten • Protestkultur • Pubertät • Unterhaltung |
| ISBN-10 | 3-423-43396-5 / 3423433965 |
| ISBN-13 | 978-3-423-43396-9 / 9783423433969 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich