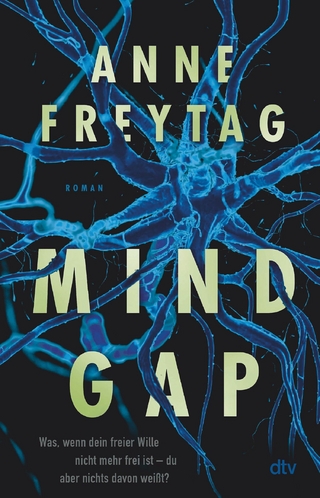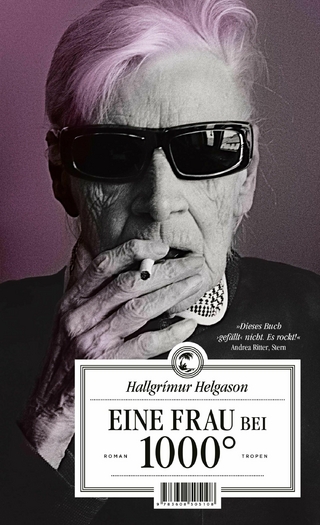Schleierwolken (eBook)
320 Seiten
konkursbuch (Verlag)
978-3-88769-563-7 (ISBN)
1964 in Altenhundem (Sauerland) geboren, aufgewachsen in Herten, Studium der Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, lebt als freie Autorin und Lektorin in Berlin. Sie veröffentlichte Romane und Erzählungen, bisher fünfzehn Bücher. Zuletzt die Thriller 'Wanderurlaub' und 'Endlich daheim'. Die Presse zur Autorin: 'Patricia Highsmith hat eine deutsche Erbin gefunden!' (Alf Mayer, Juror Dt. Krimipreis, in 'Strandgut'.
2 – Juli
Meine Familie war normal. Langweilig normal. In meiner Familie gab es weder Fälle von Kriminalität noch von Alkoholismus oder Drogensucht, es gab keine Essstörungen, keine Verrücktheiten – jedenfalls keine allzu auffälligen –, keine sexuellen Perversionen oder sonstigen Abweichungen. Nichts Ekelhaftes. Das wüsste meine Mutter. Nicht einmal seltene Blutgruppen gab es in meiner Familie. Oder Linkshänder. Das war auch besser so, denn die hatten es laut meiner Mutter viel schwerer im Leben. Es gab nichts, worüber man die Nase hätte rümpfen können. Gott sei Dank! Denn dass niemand – die Nachbarn, entferntere Verwandtschaft, die Bäckersfrau oder der Arzt – die Nase rümpfte, so wie sie es umgekehrt ständig bei anderen tat, war für meine Mutter das Allerwichtigste.
Immer wenn ich in die Schränke meiner Mutter sah, was ihr nicht recht war, aber seit ihrer Hüftoperation vor zwei Jahren kam sie nicht mehr schnell genug hinterher, um mich davon abzuhalten, fragte ich mich, ob hier die anerzogene Sparsamkeit waltete oder der Wahnsinn. Aber den gab es in meiner Familie bekanntlich ja nicht. Meine Mutter hortete in der Küche und im Keller unvorstellbare Mengen an Plastikbehältern und Gläsern mit Schraubverschlüssen in jeder erdenklichen Größe. Joghurtbecher und Margarinedosen, unzählige Male abgewaschen, sodass das Plastik schon ganz rau war. Alte Senfgläser, die noch aus den Siebzigern oder Achtzigern stammen mussten.
»Wozu brauchst du das alles?«
»Das kann man doch immer brauchen.«
Ich hatte schon oft vorsichtig angedeutet, sie müsse sich auch von Dingen trennen, was aber immer nur Gezeter zur Folge hatte. Gezeter und echten, unverhohlenen Hass in den Augen. »Ich lasse mir doch von meiner Tochter nichts vorschreiben!« Und am Ende die von Tränen begleitete Beteuerung, all das dringend zu benötigen.
Und Plastiktüten. Wie konnte jemand so viele Plastiktüten aufheben? Obwohl es zugegeben besser war, sie stapelten sich ordentlich, wie glatt gebügelt, im Küchenschrank meiner Mutter, statt im Ozean herumzuschwimmen. Etliche der Geschäfte, deren Logo auf die Tüten gedruckt war, existierten schon lange nicht mehr, vielleicht schon seit meiner Schulzeit, und jedes Mal, wenn ich eine davon sah, fühlte ich mich unangenehm an eben jene Horrorzeit erinnert, obwohl sie so weit zurücklag und sich heute so fremd und so fern anfühlte, als wäre es damals gar nicht mein Leben gewesen, sondern das von jemand anderem.
»Manchmal braucht man doch Plastiktüten«, sagte meine Mutter. »Und sind die jetzt nicht auch verboten? So wie die Glühbirnen? Dann ist es gut, wenn ich noch welche habe.«
»Sie sind noch nicht verboten«, sagte ich.
»Aber bestimmt bald!«
Meine Mutter war vierundachtzig und verweigerte jeden Gedanken daran, dass sie das Haus, in dem sie seit dem Tod meines Vaters allein lebte, eines Tages verlassen musste. Eines nicht allzu fernen Tages. Es war viel zu groß für sie. Sie kam nicht mehr darin zurecht. Sie baute von Woche zu Woche mehr ab; jedes Mal, wenn ich zu ihr fuhr, kam sie mir ein bisschen schwächer, ein bisschen älter und geschrumpfter vor als bei meinem Besuch davor. Aber wenn es nach meiner Mutter ginge, würde sie das Haus nie verlassen. Jedenfalls nicht lebendig.
Ist ja eigentlich auch löblich, dachte ich, dass sie nichts wegwirft und Ressourcen spart. Vielleicht könnte ich sie zu einer Art Wettkampf anmelden. Wer hat die größten Vorräte. Wer wirft am wenigsten weg. Niemand besaß so viele Putzlappen – jedenfalls niemand, den ich kannte –, wozu bei meiner Mutter auch alte, rau gewaschene Unterhosen zählten. Garantiert niemand nannte eine ganze Schublade voller Aluminiumfolie sein eigen, ordentlich zusammengelegt und geglättet, schätzungsweise acht bis zehn Zentimeter hoch. Bereits benutzte Aluminiumfolie, auf der teilweise noch die Reste alter Krusten aus dem Backofen zu erkennen waren. Niemand bewahrte Quittungen von Haushaltsgeräten aus den sechziger und siebziger Jahren auf. Nur meine Mutter. Wie sollte ich ihr beibringen, dass sie nicht mit zigmal abgespülten Joghurtbechern und benutzter Aluminiumfolie ins betreute Wohnen ziehen konnte? Wie sollte ich ihr überhaupt das betreute Wohnen beibringen?
Noch ging es gut, aber damit konnte es jeden Tag vorbei sein, und ich rechnete auch fast täglich mit einem solchen Anruf. Trotzdem verschloss ich davor die Augen und meine Mutter, die sich verzweifelt und mit aller Kraft an das zu große Haus in der schrecklichen Siedlung klammerte, erst recht. Seit ihrer Hüftoperation fiel ihr das Gehen schwer. Im Flur stand ein Rollator, den die Krankenkasse gezahlt hatte – andernfalls hätte sie darauf verzichtet –, den sie aber nicht benutzen wollte, vor allem nicht draußen, weil die Nachbarn sie dann ja für eine alte Frau halten würden, wie sie sagte. Sie konnte fast keinen der Nachbarn leiden. Folglich hätte ihr eigentlich egal sein können, was sie über sie dachten, aber das war es nicht.
Meine Eltern hatten nie freundschaftlichen Kontakt zu den Nachbarn gepflegt. Das Haus hatten sie gekauft, weil es ihren Vorstellungen und ihrem Budget entsprochen hatte. Wie es drum herum aussah, wo die nächste Bushaltestelle war – sie fuhren sowieso nie mit dem Bus – und wer dort sonst noch wohnte, war nachrangig gewesen. Das Haus entsprach ihrer Vorstellung vom Himmel und meiner Vorstellung der Hölle. Wie eng beieinander Himmel und Hölle doch liegen konnten. Und seit mein Vater, vom Wesen her immerhin ein bisschen geselliger, nicht mehr lebte, hatte es sich verschlimmert. Die Nachbarn waren Feinde. Auch wenn meine Mutter es nicht so nannte. Sie nannte sie stattdessen: »Die da vorne an der Straße, du weißt schon, die ihren Garten verkommen lassen, eine Schande ist das.« Sie nannte sie: »Die Frau schräg gegenüber, ich glaube, die steht nie vor zehn auf.« Sie nannte sie: »Der ist ja wohl schon länger arbeitslos, aber wenn du mich fragst, hat er sich auch nie richtig bemüht« – woher wusste meine Mutter das? – und »Tja, die hat Krebs, das wird wohl nichts mehr mit der« und »Da hinten, da wohnen ja jetzt Türken.«
Das Haus in der schrecklichen Siedlung in Wattenscheid hatten meine Eltern erst nach meinem Abitur gekauft. Mein elf Jahre älterer Bruder Egbert war schon lange ausgezogen. In der schrecklichen Siedlung standen lauter Einfamilienhäuser, viele davon waren wie ein Badezimmer oder das Innere eines Schlachthofes verklinkert, was den Bewohnern vermutlich die Idee von Reinheit vermittelte.
Am liebsten war es mir, wenn meine Familie nicht da war, dann bildete ich mir sogar ein, manchmal zumindest, sie zu mögen. Schließlich mochte man seine Familie, oder nicht? Das war ein Naturgesetz. Schon in meiner Teenagerzeit hätte ich am liebsten möglichst wenig an meine Familie gedacht, aber wenn man noch zu Hause wohnte, wo das Gesetz des Vaters herrschte – war der Vater abwesend, galt stellvertretend das Gesetz der Mutter, das sich aber von dem des Vaters in nichts unterschied –, und wenn man seine Füße noch unter den Tisch des Vaters stellte, fiel es schwer, so zu tun, als wäre die Familie nicht da. Und mehr als ein Vierteljahrhundert später fiel es immer noch schwer.
Das wäre am besten, dachte ich manchmal. Wenn meine Mutter fort wäre. Einfach verschwunden.
Aber sie war nicht verschwunden.
»Willst du mich vergiften?«, fragte sie.
Manchmal kochte ich abends, wenn ich meine Mutter besuchte. Die Arbeitsplatte in der Küche des viel zu großen Hauses, die Griffe der Schränke und ihre Oberflächen waren von einem klebrigen, fettigen Film überzogen. War das schon immer so gewesen? Oder erst seit Neuestem? Nein, es konnte nicht schon immer so gewesen sein. Meine Mutter hatte, seit ich denken konnte, für einen perfekten Haushalt gesorgt. Perfekt sauber. Man hätte sprichwörtlich vom Boden essen können. Jetzt nicht einmal von der Arbeitsplatte. Ich ekelte mich jedes Mal. Und sobald ich mich ekelte, ein nicht erlaubtes und unerhörtes Gefühl, meldete sich natürlich das schlechte Gewissen zu Wort: Du darfst deine Mutter doch nicht ekelhaft finden! Auch nicht ihre Küche. Deine Mutter hat dich genährt. All die Jahre genährt und nur hin und wieder verdroschen. Eigentlich waren es ja nur ein paar Ohrfeigen. Und dafür gab es immer einen triftigen Grund, das musst du doch zugeben.
»Willst du mich vergiften?«, wiederholte meine Mutter und stach auf ein Stück Tomate ein. Sie machte zwar nicht die empfohlene Krankengymnastik, sorgte sich ansonsten aber ständig um ihre Gesundheit und nahm so viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich, dass ich mich manchmal fragte, was für wilde chemische Reaktionen sie in ihr auslösten. »Das Grüne ist doch giftig! Weißt du das etwa nicht?«
»Du müsstest ungefähr hundert Stück davon essen, mindestens, bevor es giftig wird.«
»Nein, das ist giftig!«, beharrte meine Mutter. »Ich schneide das Grüne ja immer raus. Und übrigens esse ich abends auch nicht gern so viel. Das bekommt meiner Galle nicht. Das weißt du doch.« Mit einem angewiderten Gesichtsausdruck schob sie das Schälchen mit dem Tomatensalat von sich.
Und genau diese beiden Dinge, dass sie den Tomatensalat von sich schob, ihn verweigerte, und ihr angewidertes Gesicht, machten mir etwas aus. Machten mir viel mehr aus, als ich mir eingestehen wollte. Ein unangenehm heißes Gefühl, wie Scham....
| Erscheint lt. Verlag | 2.10.2017 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Krimi / Thriller / Horror |
| ISBN-10 | 3-88769-563-1 / 3887695631 |
| ISBN-13 | 978-3-88769-563-7 / 9783887695637 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 325 KB
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich