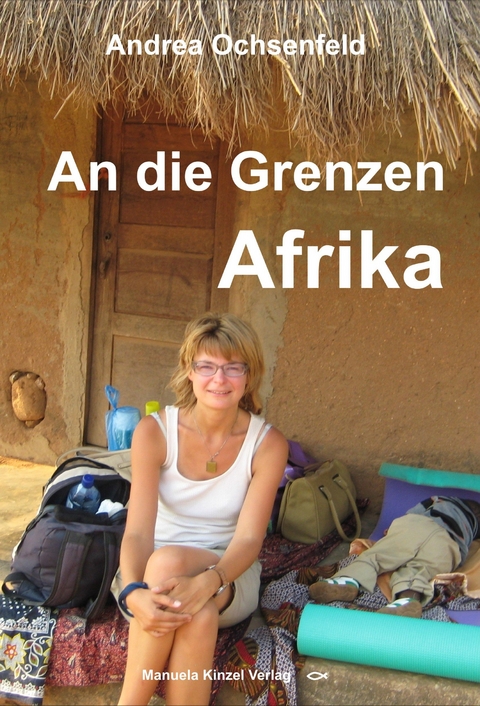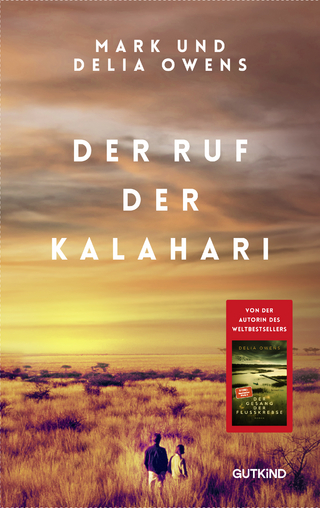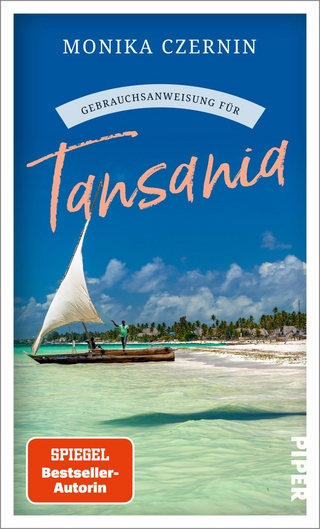An die Grenzen - Afrika
Manuela Kinzel Verlag
978-3-95544-046-6 (ISBN)
- Keine Verlagsinformationen verfügbar
- Artikel merken
Andrea Ochsenfeld unternimmt regelmäßig größere und kleinere Reisen. Die skurrilen, schönen sowie unschönen oder einfach alltäglichen Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen hält sie in Erlebnisberichten und Drehbüchern fest. Nachdem sie viele Jahre immer wieder in Lateinamerika unterwegs gewesen war, beschloss sie Afrika kennen zu lernen.
[...] Um 8:30 Uhr nehme ich einen Bus nach Lusaka, einen großen, dreckigen Bus, in dem Kakerlaken rumlaufen, dessen Frontscheibe bedenklich zersplittert ist und dessen Tür mit einem Strick festgebunden werden muss. Ich scheine nun im armen Afrika angekommen zu sein. Die Fahrt dauert statt der angekündigten sechs Stunden achteinhalb. Auf dem Weg kommen wir an vier Unfällen vorbei: Zwei LKWs umgekippt im Straßengraben, ein mit einem Zug zusammengeprallter LKW und ein mit einem Esel zusammengestoßener Bus. Der Esel ist tot, der Bus okay. Es ist schon irgendwie gruselig, auf einer doch so kurzen Strecke an so vielen Unfällen vorbeizukommen, aber das scheint hier völlig normal zu sein. Unser Fahrer lacht jedenfalls bei jedem Unfall einfach nur blöd. Man hat auch das Gefühl, dass er nicht langsamer fährt, wenn Tiere auf der Straße auftauchen, sondern, im Gegenteil, sogar noch mehr Gas gibt. Unser Toilettenstopp sieht so aus: Eine aus in großem Abstand zueinander vernagelten Brettern bestehende Tür führt zu einem dreckigen, stinkigen Loch im Boden. Alle Frauen gehen in die Mulde hinter der vermeintlichen Toilette und machen sich gleichzeitig ans Werk. Ich bin unentschlossen. Eine sehr gepflegte und geschminkte Frau lacht und sagt, ich habe die Wahl... Letztendlich gehe ich in die Toilette, weil ich nicht will, dass mich jeder sieht. Eine Frau kommt rein und stellt sich mit dem Rücken zu mir hin. Was sie da treibt, ist unklar. Als ich rauskomme, winkt ein Typ mit Scheinen. Er will Geld, weil die Toilette kein gratis Service ist. Auch die „Muldenfrauen“ sollen zahlen. Die Frauen regen sich auf, pöbeln ihn an, keine zahlt. [...] _________ Samstag, 02.10.2010 Die Nacht war sehr anstrengend wegen Hitze und Durchfall. Um 4:30 Uhr gehe ich zum Bus und werde von einem Hotelangestellten begleitet, die Haltestelle ist sehr nahe. Dem Bus fehlen einige Fensterscheiben, es ist ein totaler Klapperkasten. Mir ist kalt. Ein Typ vor mir bietet mir seine Jacke an, aber beim nächsten Stopp hole ich meine eigene aus dem Gepäck. In Namialo suche ich eine Chapa nach Ilha. Wenige gehen direkt, die meisten fahren über Monapo, wo man umsteigen muss. Ein Typ ruft: „Monapo-Ilha!“, jemand sagt, er lügt, er fahre nicht nach Ilha. Aber ich finde keinen direkten, also versuche ich es mit dem potentiellen Lügner. Die Ladefläche erscheint mir komplett voll, doch der Typ zeigt auf ein kleines Loch zwischen den ganzen Menschen, in das ich mich pressen soll. Ich bin wieder total genervt, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, denn in einer anderen Chapa wäre es genauso, jedenfalls früher oder später. Ich presse mich also zwischen die Leute und sehe mit an, wie das mit Flecken und Wunden übersäte Bein einer Frau gegen meines reibt. Dabei male ich mir aus, wie sämtliche exotische Krankheiten von der Frau zu mir rüberwandern. Ich werde innerlich sogar panisch, da ich aufgekratzte Moskitostiche an den Beinen habe. Irgendwann schaffe ich es, meine Jacke zwischen unsere Beine zu klemmen. Kurz vor Monapo stellt sich heraus, dass wir doch nicht nach Ilha fahren, und sieben, acht Leute, die auch nach Ilha wollen, fangen einen Streit mit dem Fahrer an. In Monapo finden wir aber sofort Anschluss, und ich darf vorne sitzen, der reinste Luxus. Neben mir sitzt Andrew, ein Ami aus Washington DC, der in Maputo etwas über Fotografiegeschichte in Mosambik forscht. Seine Mutter ist Afroamerikanerin, sein Vater Ägypter. Er ist ganz begeistert von Maputo. In der Chapa zeigt er sich aber sehr ungeduldig. Er fragt alle fünf Minuten, wie lange es noch dauert. Er ist mit zwei Flügen gekommen, reist also eher bequem. Er gibt mir seine Nummer. [...] _________ Montag, 04.10.2010 Natürlich geht der Bus nicht um 2 Uhr, sondern um 3:15 Uhr, nachdem er endlose Runden auf der Suche nach weiteren Fahrgästen durch die Gegend gedreht hat. Ein Betrunkener im Bus will meine Nummer, hat aber nichts zu schreiben. Er meint, er kann sie sich merken und wiederholt sie zu diesem Zweck immer und immer wieder, was mich immer gereizter werden lässt, weil er ständig will, dass ich die Nummer wiederhole. Irgendwann sage ich, dass er sie sich aufschreiben und mich in Ruhe lassen soll. Er bittet mich daraufhin hinaus, um einen Stift zu suchen, wie ich vermute, aber dann fängt er an, die Nummer in den Sand zu schreiben. Ich versuche ruhig zu bleiben und steige kommentarlos zurück in den Bus, der sich immer mehr füllt, bis es wieder vollkommen unbequem ist. Entgegen aller Versprechungen, dass wir trotz der großen Verspätung rechtzeitig in Nampula ankommen, um den Bus nach Quelimane zu kriegen, verpasse ich ihn natürlich. Ich muss vom Busbahnhof unserer Ankunft eine Chapa zum Busbahnhof A Faina nehmen. Die Chapa will mehr Geld für meinen Rucksack als für mich. In A Faina wird mir versichert, dass die einzige Möglichkeit nach Maputo zu kommen in folgender Verbindung besteht: Bus nach Alto Molocue, Chapa nach Mocuba, Chapa nach Nicoadala, dort im Bus nach Maputo übernachten, der erst am nächsten Morgen losfährt. Mir wird übel bei der Auflistung all dieser Strecken, aber ich will weiterkommen. Ich setze mich unter der Bedingung, dass mein Platz auch wirklich nur mein Platz bleibt, in den noch fast leeren Bus nach Alto Molocue, und warte drei Stunden, bis er sich füllt. Kurz vor Abfahrt setzen sie zusätzlich einen Teenager auf meinen Platz, so dass ich mal wieder wie in einer Sardinenbüchse reisen soll. Ich bin diesmal viel zu müde und genervt für so etwas. Als ich merke, dass mein Protest wegen ausgemachter Bedingung nichts nutzt, steige ich aus und verlange meinen Rucksack zurück, den sie vom Dach losbinden müssen, was wiederum die Typen nervt. Bezahlt hatte ich noch nicht, weil man das hier immer erst am Ende der Reise tut. Ich bin total frustriert und weiß nicht, was ich machen soll. Ich will nicht in dieser hässlichen Stadt bleiben, aber auch nicht in einer Sardinenbüchse die nächsten zwei Tage zubringen, denn bis Maputo ist es weit. Ich gehe die sehr belebte Straße entlang und werde von jeder Menge Typen, die weder vertrauenerweckend noch intelligent wirken, auf sehr blöde Art und Weise gegrüßt. Die übertrieben betonten Wörter und zu Grimassen geschnittenen Gesichter sollen vermutlich ausdrücken, dass sie mich als Frau sehr toll finden. Ich komme an eine Tankstelle und frage, ob hier Autos nach Maputo halten. Ja. Ich stelle meinen Rucksack ab und bin den Tränen nahe, wenn ich die Menschen um mich herum so sehe. Da kommt ein kleiner Sicherheitsmann mit einem Riesengewehr und fragt, ob ich ihn heiraten will. Dieser Tropfen bringt das Fass zum Überlaufen, und ich fange an zu heulen. Ich kann einfach nicht mehr. Der Typ bleibt stehen und wiederholt immerzu etwas besorgt „amiga, amiga“. Dann taucht ein zweiter Sicherheitsmann mit Riesengewehr auf und sagt zum ersten, er soll mich in Ruhe lassen. Er holt mir einen Kanister zum Sitzen und meint, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ich werde ein Auto finden. Seine Fürsorglichkeit tut gut. Ein anderer will helfen und fragt herum, ob jemand nach Maputo fährt. Er findet einen LKW mit vier Männern, aber ich will keine so lange Strecke mit vier Männern fahren. Überhaupt halten nur LKWs oder Pickups, die Männer zu ihrer Arbeit in der Umgebung fahren. Reiche oder Mittelschicht scheint es hier gar nicht zu geben, jedenfalls kommt keiner an dieser Tankstelle vorbei. Irgendwann tauchen zwei dubiose Gestalten auf. Einer von ihnen meint, er führe gerade seinen Bruder aus, der Patient in der Psychiatrie hinter der Tankstelle sei. Er will wissen, wie der deutsche Geheimdienst heißt, ich muss es ihm aufschreiben. Er sagt, er arbeite bei Interpol. Dann schenkt er mir ein Bonbon. Er hat eine Muschel und fragt, ob ich sie will. Ich lehne dankend ab, ich habe selber welche. Er will sie sehen, aber ich habe keine Lust, sie aus dem Rucksack zu kramen. Er insistiert. Ich finde eine und zeige sie ihm. Er will sie gegen seine tauschen, ich nicht. Seine Laune verschlechtert sich. Dann will er Geld für den Bus in die Stadt. Ich sage, ich hätte kein Kleingeld. Er fragt, wie ich dann nach Maputo kommen wolle. Er wird sauer und legt sich mit dem Sicherheitsmann an, warum der seinen Job nicht mache, er solle mein Gepäck und meinen Pass kontrollieren, nicht den Beschützer spielen. Die Situation ist sehr angespannt. Ich sage, die Polizei habe meinen Pass bereits kontrolliert, was ihn etwas besänftigt. Er fragt seinen Bruder, der das ganze Gespräch fast teilnahmslos verfolgt, – es ist zweifelhaft, ob er überhaupt etwas versteht, – ob sie uns in Ruhe lassen sollen. Dann gehen sie. Irgendwann erblicke ich ein weißes Mädchen. Ich freue mich so sehr, dass ich sofort hinrenne und frage, ob sie Richtung Süden fährt. Sie ist aus den USA, aber sie arbeitet hier. Ich erzähle ihr und ihrem Freund, einem Schwarzen, von meinen ganzen Strapazen. Sie meinen, es gäbe einen direkten Bus nach Maputo. Ich soll nochmal fragen gehen, während sie ein Waisenhaus besuchen. Sie kämen dann zurück zur Tankstelle, mich abholen, damit ich bei Erica übernachte. Ein arabisch aussehender Mann nimmt mich bis zum Bus mit, der nach Maputo fahren soll, und bringt mich auch wieder zurück. Obwohl es ein Langstreckenbus ist, sieht er genauso klapperkastenmäßig aus wie alle anderen. Aber er fährt erst in drei Tagen, das dauert mir zu lange. Erica und ihr Freund Jonas holen mich mit ihrer Chapa ab. Bevor ich gehe, gibt mir der Sicherheitsmann zu verstehen, dass er Geld für seine „Dienste“ erwartet. Ich habe mich also getäuscht, er hat mir nicht aus Nettigkeit geholfen. Ich tue wieder so, als ob ich nicht richtig verstehe und will gehen. Da bittet er doch tatsächlich Erica und Jonas um Geld, aber sie geben ihm keins. Jonas meint im Auto, dass das hier leider typisch sei. Vor Ericas Wohnung sitzt ein Sicherheitsmann. Das Gitter vor der Wohnungstür ist mit zwei großen Schlössern verriegelt, die Wohnungstür selbst ist auch verschlossen. Erica erklärt, dass bei ihr eingebrochen wurde, als sie in den USA und der Sicherheitsmann krank war. Wir gehen einkaufen und fragen nach einem anderen Bus nach Maputo, der bereits ausgebucht ist. Aber wir sollen am Abend nochmal den Fahrer fragen. Ich bin so unheimlich erleichtert, endlich wieder mit jemandem sprechen zu können, der mich versteht. Ich lasse meinen ganzen Frust raus. Erica ist 24 und unterrichtet seit einem Jahr die Kinder von reichen internationalen Missionaren. Die Stelle hat sie im Internet gefunden. Sie versteht alles, was mich nervt, und kann noch andere Dinge aufzählen. Aber ihr gefällt es trotzdem so gut, dass sie vielleicht wirklich hier bleiben will. Ihre Mutter ist von ihrem schwarzen Freund nicht begeistert. Erica meint, dass ich das wahrscheinlich nicht glauben könne, aber Jonas sei nicht an ihrem Geld interessiert. Er will in Mosambik bleiben. Er kommt aus einer sehr armen Familie, hat aber studiert. Er sieht immer alles sehr gelassen. Jonas spricht sehr gut Englisch und erzählt viele interessante Geschichten. Er wird zum Englischlehrer ausgebildet und hat viel zu kämpfen. Obwohl die Schüler seinen Unterricht mögen und meinen, sie lernen bei ihm mehr als bei seinem Professor, der nur Sachen an die Tafel schreibe ohne sie zu erklären, werde er ständig fertig gemacht. Seine Professorin unterstellte ihm beispielsweise, eine Geschichte, die er bereits im Rahmen einer Aufgabenstellung geschrieben hatte, kopiert zu haben, da sie meinte, die Geschichte bereits zu kennen. Sie konnte es aber nicht beweisen. Trotzdem gab sie ihm so eine schlechte Note, dass er eine Zusatzprüfung machen musste. Auch seine Schwester hat es nicht leicht: Sie wollte ebenfalls Englisch studieren und wurde von ihrem Professor erpresst. Wenn sie nicht mit ihm schliefe, würde sie nicht bestehen. Sie ist dann durchgefallen. Jetzt studiert sie woanders. Jonas erzählt, dass es in Mosambik noch sehr viel Aberglauben gibt. Im Unterricht sollten seine Schüler diskutieren, ob ein traditioneller Heiler oder ein Arzt besser sei. Manche Gruppen waren für den Heiler, mit der Begründung, dass dieser ihnen auch zu einem Auto verhelfen könnte. Das funktioniert folgendermaßen: Man geht zu einem Heiler und bittet um ein Auto. Der Heiler hält einem dann einen Spiegel vor und sagt, man solle an einen ganz nahen Verwandten denken. Wenn man dann diesen Verwandten im Spiegel sieht, muss man eine Nadel in ihn stechen. Kurze Zeit später wird dieser Verwandte dann auf unerklärliche Weise sterben. Er wird krank, aber im Krankenhaus kann nichts Konkretes festgestellt werden. Und so erbt man also. Wenn man jemandem Böses will, kann man ihn mit einem Fluch belegen. Jonas kennt einen Professor, der einen Studenten schlecht behandelt hat, deswegen verflucht wurde, plötzlich erkrankte und starb. Jonas glaubt diese Dinge auch, sie sind für ihn Realität. Außerdem erzählt er, dass im Krankenhaus alle korrupt seien. Man müsse das Personal mit viel Geld bestechen, wenn man gut behandelt werden wolle. Er sagt, dass Leuten, die sehr krank sind, oft etwas injiziert werde, damit sie sterben. Ich lege mich ein bisschen hin. Erica und Jonas kochen Reis mit Huhn. Wir gehen nochmal zum Bus, aber der Fahrer ist immer noch nicht da. Dann essen wir. Die beiden versuchen, mir ein Taxi für 2:45 Uhr zu organisieren, was aber nicht einfach ist, weil niemand nachts arbeiten will, da es wohl vermehrt Überfälle auf Taxifahrer gegeben hat. Schließlich bekomme ich eine Nummer, die ich um 2:30 Uhr anrufen soll. Ich schlafe im Gästezimmer in einem Bett, über das ich mein Moskitonetz hänge. Dienstag, 05.10.2010 Wie vereinbart rufe ich den Taxifahrer an, der aber nicht kapiert, wo er mich abholen soll. Ericas Sicherheitsmann, der vor der Tür sitzt, begleitet mich zu einem Taxistand. Am Bus angekommen, ein TCO-Bus, der angeblich luxuriöseste des ganzen Landes, erfahre ich, dass nur bis Quelimane Plätze frei sind. Ich fahre trotzdem mit. Der Bus ist wahnsinnig bequem, endlich hat man Platz! Es gibt sogar eine Klimaanlage. Wir fahren zügig mit wenigen Stopps, und zum ersten Mal in diesem Land gibt es Toilettenpausen. Außerdem bekommt man ein Frühstück, das aus Keksen, Bonbons und einem Apfel besteht. Neben mir sitzt ein Mann, der auch kein Ticket hat und nach Beira will. Nach etwa vier Stunden Fahrt geht der Bus mitten in der Pampa kaputt, und wir müssen auf einen Ersatzbus aus Beira warten. Viele Gäste beschweren sich, weil der Bus immerhin nicht billig war. Viele derjenigen, die kein Ticket haben, trampen weiter. Die anderen warten in der Hitze, im Schatten eines Baumes oder bei ein paar vereinzelten Lehmhütten, die nicht weit sind. Manche wollen im Bus warten, aber da wird es schnell zu heiß. Ich setze mich in den Schatten einer Lehmhütte und versuche, wie einige andere auch, auf meiner Isomatte zu schlafen. Die Fahrgastgemeinschaft hat scheinbar so etwas wie einen Anführer bestimmt, der sich um alle kümmern soll, vor allem soll er Essen und Trinken organisieren, da keiner auf so eine lange Reise vorbereitet ist. Es gibt ein kleines Dorf, circa 5 km entfernt. Mit einem Fahrrad werden Hühner und Maismehl, die in einem Riesentopf gekocht werden, und Wasser und Cola herbeigeschafft und verkauft. Ich frage nach Eiern und auch die treibt man auf. Abends wird ein Lagerfeuer gemacht, um das Männer und Frauen getrennt voneinander sitzen. Ein Mann unterhält sich mit mir. Er untersucht kulturelle Gründe für Verhaltensweisen, die die Verbreitung von Aids fördern, zum Beispiel dass Männer keine Kondome benutzen wollen. Er erzählt außerdem, dass er für einen Südafrikaner gearbeitet hat, der mit Holzschnitzereien aus Mosambik handelte. Aber die mosambikanischen Kunsthandwerker haben die Arbeiten nie zum vereinbarten Zeitpunkt abgeliefert. Nicht, weil keine Zeit gewesen wäre, sondern weil sie keine Lust hatten, sich an irgendwelche Vorgaben zu halten. So hat der Südafrikaner die Geschäfte mit ihnen abgebrochen. Der Mosambikaner hat auch keine Erklärung für das Verhalten seiner Landsleute. [...] Freitag, 22.10.2010 Um sieben Uhr wandere ich zum Pinnacle, einer Felsformation mit Wasserfall, dem ersten Stopp auf meiner Route. Auf dem Weg zu God’s Window, einem Aussichtspunkt über einer Schlucht, hupt der Typ mit dem Glasauge und fragt, ob er mich mitnehmen soll. Er bringt drei Frauen zum God’s Window, die dort arbeiten. Diesmal will er kein Geld, sondern meine Handynummer und eine Umarmung zum Abschied. Ich laufe weiter zum nächsten Aussichtspunkt, dem Wonder View, dann zu den Berlin Wasserfällen, alles liegt an einer Straße. Der Weg ist doch recht weit, so dass ich es irgendwann per Anhalter versuche, aber keiner nimmt mich mit. Die Wasserfälle sind nicht sonderlich spektakulär. Beim Weggehen hält ein Auto mit einer deutschen Familie und fragt, ob ich mitfahren will. Sie haben mich beim Hinweg gesehen, aber angeblich zu spät. Allerdings fahren sie nun in eine andere Richtung. Das Glasauge schreibt mir eine SMS, dass ich mich melden soll, wenn ich vom Wonder View weiter will, dass ich so nett wäre, dabei nennt er mich „Sweety“. Ich antworte nicht. Während ich die Straße entlang laufe, hält eine ältere weiße Frau an, um mir verärgert zu sagen, dass das, was ich hier tue, sehr gefährlich sei. Sie ist zuerst an mir vorbei gefahren und dann extra umgedreht, um das loszuwerden. Das Glasauge ruft an und fragt, ob es mir einen Saft vorbeibringen soll, was ich dankend ablehne. Ein Auto mit zwei Touristenpärchen, einem älteren und einem jüngeren, nimmt mich zu den Lisbon Falls mit. Auch hier ist die ältere Frau sehr verärgert. Auf dem Rückweg trampe ich dann nicht, bis dieses Auto vorbeigefahren ist. Dann probiere ich es wieder, es sind noch 7 km bis Graskop. Ein Tourenbus mit zwei Luxemburgern und einer weißen Fahrerin von einer Lodge in Marloth Park, einem Ort beim Krüger Park, wo die Tiere durch die Straßen laufen, nimmt mich mit. Die Fahrerin hat zwei Babygalagos, Buschbabys dabei, kleine Tierchen mit Riesenaugen, zum Fressen süß. Der Bus fährt nach Pilgrim’s Rest, einer sehr touristischen alten Goldgräberstadt, und zurück. Ich schließe mich an. Zurück im Backpackers koche ich Reis mit Karotten und Cremesuppe, unterhalte mich mit verschiedenen Gästen und gehe dann schlafen. Um 2:30 Uhr wache ich auf, weil ich ein Geräusch höre. Zuerst denke ich, es gehört zu meinem Traum, aber als es länger anhält, richte ich mich irritiert auf. Genau in diesem Augenblick sehe ich, dass jemand das Zelt aufgeschnitten hat und gerade meinen kleinen Rucksack herausheben will. Meine Reaktion, mich schreiend auf den Rucksack zu stürzen, in dem sich eigentlich „nur“ mein Tagebuch an Wert befindet, ist ein Reflex, ich denke gar nicht darüber nach. Ich hänge durch das geschnittene Loch am Rucksack und schreie, während der Typ damit wegrennen will, aber nicht kann. Schließlich lässt er den Rucksack fallen und läuft weg. Ich klettere aus dem Zelt, ziehe den Rucksack auf den Rücken und stehe da in der Hoffnung, dass jemand käme. Aber es kommt niemand. Obwohl direkt neben mir eine bezogene Holzhütte steht und ein paar Meter weiter das Zelt eines Angestellten. Auch die restlichen Anlagen sind nicht weit. Die Hunde in der Nachbarschaft bellen. Ich rufe nicht ganz so laut wie zuvor um Hilfe. Da kommt der Typ zurück, um sein Messer zu holen, das noch vor dem Zelt liegt, und läuft dann wieder in dieselbe Richtung weg. Das versetzt mich in Panik, ich rufe nochmal um Hilfe. Endlich kommt der Besitzer verschlafen an, Edwin, ein Holländer. Er ruft die Polizei. Bis die da ist, vergeht natürlich Zeit. Sie fragen, ob ich den Typen gesehen habe. Tja, zwar habe ich ihn gesehen, aber ohne Brille nicht viel erkannt. Ich kann nur sagen, dass er schwarz, schlank und nicht besonders groß war und ein blaues T-Shirt hatte. Ich zittere. Edwin hilft mir, meine Sachen in eine Hütte mit zwei Zimmern und vier Betten zu tragen, wo ich den Rest der Nacht verbringen darf. Edwin schläft zu meiner Beruhigung im Nebenzimmer. Samstag, 23.10.2010 Morgens werde ich von dem Pärchen, das in der Holzhütte neben meinem Zelt geschlafen hat, gefragt, wie es mir geht. Ich fühle mich seltsam, weil keiner außer dem Besitzer zu Hilfe gekommen ist und es unmöglich sein kann, dass niemand etwas gehört hat. [...] Zurück im Backpackers wechsle ich in den Schlafsaal. François, der Ersatzmanager, der im Zelt ein paar Meter von meinem entfernt geschlafen hat, will wissen, was passiert ist. Angeblich hat er nichts gehört. Er sagt, dass aus seinem Zelt ein bisschen Geld und Zigaretten gestohlen worden sei. Er meint, er habe mit offener Zelttür geschlafen. Trotzdem sei das Messer an einer Stelle reingestochen worden. Er hat die Theorie, dass er mit einer angebrannten CD oder mit einem Spray betäubt wurde. Hm. Ein holländisches Pärchen erkundigt sich auch nach meinem Befinden, sie hätten mich gehört, aber da wäre die Polizei schon da gewesen (das war allerdings einige Zeit später). Die Putzfrau, die einige Straßen weiter wohnt, meint, sie habe mich dreimal schreien gehört und geglaubt, da würde jemand vergewaltigt. Auch ein anderer Nachbar hat mich gehört… Der Backpackers hat keinen Sicherheitsmann und keinen Hund, beziehungsweise einen Hund schon, der sei aber gerade mit dem Manager im Urlaub. Einen Nachtwächter hatten sie wohl zwei Jahre lang, der habe aber zu viel getrunken. Das bringe nichts, man könne sich auch auf die Nachtwächter nicht verlassen. Edwin sagt einerseits, dass zum letzten Mal vor drei Jahren eingebrochen worden sei. Am Anfang sei öfter geklaut worden, auch tagsüber, weil das Tor für jeden offen stand. Jeder konnte in die Schlafsäle und Rucksäcke beziehungsweise herumliegende Handys mitnehmen. Jetzt würden sie das Tor häufiger geschlossen halten. Andererseits erzählt Edwin, dass seine Frau mit den Kindern nach Holland zurückgegangen sei, weil man in Südafrika niemandem mehr vertrauen könne, nicht mal dem eigenen Vater oder Bruder. Außerdem sagt er, man könne gar nicht in die Herberge eindringen, ohne den Stacheldraht durchzuschneiden, was vollkommener Unsinn ist, da sich um die Ecke bei meinem Zelt eine Eisentür befindet, die weder Sicherheitsdraht noch Zacken hat und die selbst ich mit etwas Übung erklimmen könnte, dank ihrer vielen Querstreben, auf die man bequem die Füße setzen kann. Ich esse meinen restlichen Reis und besorge mir den Schlüssel für den Schlafsaal, der aber nicht nötig ist, weil es zwei Schiebeschlösser gibt. Ich bitte die beiden Holländerinnen, mit denen ich den Saal teile, alles zu verriegeln, sobald sie schlafen kommen. Trotzdem bin ich unruhig und kontrolliere nachts, ob Tür und Fenster verschlossen sind. Ich schlafe nicht gut. Sonntag, 24.10.2010 Heute möchte ich einen ruhigen Tag verbringen. Zuerst gehe ich einkaufen, dann mache ich den Graskop Day Walk zusammen mit François, der mitkommen will, weil er den Weg bisher nur mit dem Mountainbike gefahren ist. François ist mir irgendwie trotz seiner extremen Freundlichkeit nicht so ganz koscher. Ich frage mich sogar, ob er mit dem Dieb zusammengearbeitet hat. Oder ob er einfach feige ist. Seine Betäubungstheorie nehme ich ihm jedenfalls nicht ab. Wir laufen ein gutes Stück durch den von Menschen angelegten Wald über Hügel zu den Wasserfällen, wo man auch baden kann. Ich trete fast auf eine kleine giftgrüne Schlange, die schon den Kopf gehoben hat. François klärt mich auf, dass es sich um eine ungefährliche grüne Wasserschlange handelt. Er erzählt, dass er ausgebildeter Ranger ist und schon viel erlebt hat. Er ist Nashörnern und Elefanten ausgewichen, die ihn angegriffen haben. Vor allem dürfe man keine Angst zeigen, müsse Lärm machen und sich möglichst groß aufbauen oder auf einen Baum klettern. Einmal sei ein Nashorn auf ihn zugerannt, und ein Kollege habe es mit seinem Gewehr geschlagen, nicht an- oder erschossen, weil hinterher angeblich strengstens geprüft werde, ob ein Schuss wirklich notwendig gewesen sei. Falls dabei herauskäme, dass dieser nicht notwendig gewesen sei, müsse man die Kosten für ein Nashorn, circa 100.000 €, abarbeiten. Sogenannte Tracker lesen die Spuren und können angeblich sehr genau nachvollziehen, was passiert ist. In Südafrika gibt es drei alte ausgezeichnete Tracker. Ich erzähle François, dass ich von Touristen gehört habe, dass man in Swasiland bis auf 3 m an Nashörner zu Fuß heran dürfe und dass der Führer nur einen Stock mit sich führe, kein Gewehr. Das erscheint auch ihm unglaubwürdig. [...]
| Erscheinungsdatum | 31.12.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Dessau |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 149 x 210 mm |
| Gewicht | 290 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Literatur |
| Reisen ► Reiseberichte ► Afrika | |
| Reisen ► Reiseführer ► Afrika | |
| Schlagworte | Afrika • Alleinreise • Belletristik: allgemein und literarisch • Klassische Reiseberichte, Reiseliteratur • Rucksack • Rucksackreisen / Backpacking; Reisebericht/Erlebnisbericht • Rucksackreisen; Reisebericht/Erlebnisbericht • Südafrika (Region); Reise-/Erlebnisber. • Trampen • Zelt |
| ISBN-10 | 3-95544-046-X / 395544046X |
| ISBN-13 | 978-3-95544-046-6 / 9783955440466 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich