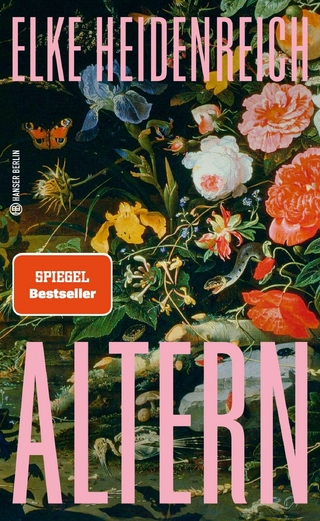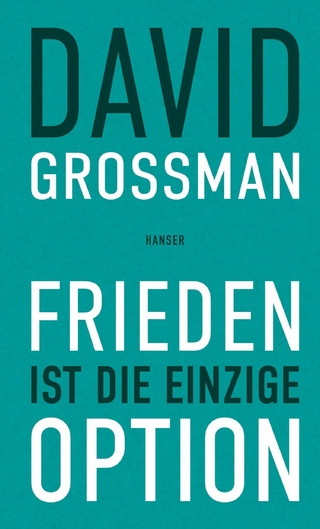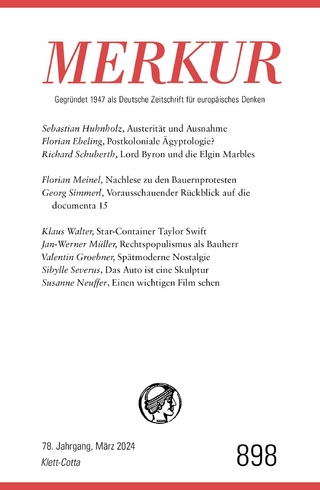Erzählen und kein Ende (eBook)
144 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-30877-8 (ISBN)
Uwe Timm, geboren 1940 in Hamburg, lebt in München und Berlin. Sein Werk erscheint seit 1984 bei Kiepenheuer & Witsch in Köln, u.?a.: »Heißer Sommer« (1974), »Morenga« (1978), »Der Schlangenbaum« (1986), »Kopfjäger« (1991), »Die Entdeckung der Currywurst« (1993), »Rot« (2001), »Am Beispiel meines Bruders« (2003), »Der Freund und der Fremde« (2005), »Halbschatten« (2008), »Vogelweide« (2013), »Ikarien« (2017), »Der Verrückte in den Dünen« (2020).
Uwe Timm, geboren 1940 in Hamburg, lebt in München und Berlin. Sein Werk erscheint seit 1984 bei Kiepenheuer & Witsch in Köln, u. a.: »Heißer Sommer« (1974), »Morenga« (1978), »Der Schlangenbaum« (1986), »Kopfjäger« (1991), »Die Entdeckung der Currywurst« (1993), »Rot« (2001), »Am Beispiel meines Bruders« (2003), »Der Freund und der Fremde« (2005), »Halbschatten« (2008), »Vogelweide« (2013), »Ikarien« (2017), »Der Verrückte in den Dünen« (2020).
2. Die Biographie der Wörter
oder
Alles O.K.?
Wann und wo ist die Currywurst entstanden? Und wer hat sie erfunden? Haben mehrere an diesem Rezept gearbeitet? Oder gibt es einen Entdecker der Currywurst? Mich beschäftigen diese Fragen schon seit Jahren. Jetzt schreibe ich eine Novelle darüber. Die Entdeckung der Currywurst. Etwas verrät uns der Name, das Kompositum. Der Curry, der über England aus Indien kommt, und die Wurst, bekanntlich eine deutsche Spezialität. Tatsächlich ist die Currywurst, die nach 1945 in Deutschland auftauchte, ein Beispiel von Akkulturation, wie die Ethnologen sagen würden. Ich behaupte zu wissen, wie es zu dem Rezept der Currywurst kam, übrigens nicht in Berlin, sondern in Hamburg, und auch wer sie entdeckt hat, kurz nach Kriegsende, in der beginnenden Schwarzmarktzeit. Die Entdeckerin heißt Frau Brücker und sagt – das steht in keinem Zusammenhang zur Currywurst – zu ihrem wesentlich jüngeren Geliebten »O.K.«. Sie sagt es zum ersten Mal. Was den Mann aus einem verständlichen, aber hier nicht erklärbaren Grund aufhorchen lässt.
Wie spricht sie dieses O.K. aus? Ganz beiläufig? Wie betont sie es? Wahrscheinlich kommt ihr dieses kleine Wort wie unter einem Zwang der Neugierde über die Lippen, wie man es manchmal an sich selbst beobachten kann: Man hört ein ungewöhnliches, ein bisher nie gehörtes Wort und probiert es aus, geradezu widerwillig, aber man will es einfach einmal vor Zeugen aus dem eigenen Mund hören.
Sagte man damals O.K.? Vor dem Krieg? Während des Krieges? Nein, sagen alle, die es wissen müssen, also die Zeit bewusst erlebt haben, das O.K. war ausgesprochen ungebräuchlich, man sagte: Jawoll. Geht in Ordnung.
Die nächste Frage: Wie soll das O.K. geschrieben werden, groß oder klein? Als Kürzel oder ausgeschrieben? Der Duden bietet alle drei Möglichkeiten an. Die beiden Buchstaben, also O und K, groß wie klein, beide aber mit Abkürzungspunkten. Und im Gegensatz zum gesprochenen O.K., das mir im Gespräch, gebrauchen es andere, meist gar nicht auffällt, sticht es mir in einem Text buchstäblich ins Auge.
Im Duden, der 20., völlig neu bearbeiteten und erweiterten Auflage, steht: »o.k., O.K. = okay«, und hinter okay steht: (amerik.). Damit ist die Herkunft des Wortes angegeben. Aber das O.K. ist längst eingedeutscht, kaum noch auffällig im Gespräch, höchstens, wenn es noch einmal im Dialekt gebrochen wird. Sie müssten einmal den Schuhmacher bei mir in Herrsching hören, wenn der, sage ich ihm, er möge die Schuhe neu besohlen, O.K. sagt.
Geschrieben, zumal im Prosatext, ist es immer noch selten und wird dann meist ausgeschrieben zum Okay.
Ich habe in einigen Romanen aus den fünfziger und sechziger Jahren geblättert, in denen ich ein O.K. oder okay vermutet hatte: Andersch, Koeppen, Grass, Walser. Sie sehen, es ist schon eine bestimmte Auswahl, nicht habe ich bei Ernst Jünger nachgeschlagen, auch nicht bei Bergengruen. Ich habe es nirgends gefunden, nicht einmal in einer direkten Rede, gestehe aber, dass ich nicht alle Bücher systematisch daraufhin durchgelesen habe. Warum taucht es, sozusagen realistischerweise, nicht bei den Realisten auf?
Diese Diskrepanz zwischen der Selbstverständlichkeit des O.K. im alltäglichen Sprachgebrauch und seiner Abwesenheit beziehungsweise Sperrigkeit in der Literatur hat unter anderem auch etwas mit der Optik zu tun.
Ich lasse es zum Beispiel einmal den Ingenieur Wagner in Der Schlangenbaum sagen, ok, zusammengeschrieben und gleich zweimal hintereinander, damit das Ungewöhnliche, im Text Ausgefallene, immer noch fremd Wirkende beiläufiger erscheint.
Ok, sagte Wagner, ok.
Ohne Abkürzungspunkte. Für Wagner, einen Ingenieur, 1948 geboren, im Ausland arbeitend, ist das, stelle ich mir vor, ein Wort, das ihm ganz leicht über die Lippen geht, während es Frau Brücker, der Entdeckerin der Currywurst, wie eine Kartoffel im Mund gelegen haben muss. So, wie sie es sagt, muss es groß geschrieben werden und mit zwei Punkten auch, selbstverständlich, und dudenmäßig korrekt.
Das Druckbild zeigt nicht nur auf etwas Fremdes, sondern zugleich auf etwas Befremdliches, ja Unverständliches. Denn die Abkürzungspunkte deuten etwas an, was so gar nicht stimmt. O.K. als Abkürzung von all correct müsste doch A.C. heißen. Dieses O.K. erscheint mir also nicht zufällig immer noch fremd, ein wenig auch, wenn ich es gebrauche, und das hat einen biographischen Grund. Mich erinnert dieses Wort an Coburg. Dorthin waren meine Mutter und ich 1943 evakuiert worden. Im April 1943 näherten sich amerikanische Panzerspitzen der Stadt. An der Mohren-Brücke wurde eine Barrikade gebaut. Hier sollte der amerikanische Vormarsch gestoppt werden. Direkt vor unserem Haus. Ein paar alte Männer vom Volkssturm, ein paar Hitlerjungen und der Rest einer Infanteriekompanie sollten die Brücke verteidigen. Die Barrikade war sorgfältig aus Pflastersteinen aufgeschichtet worden. Daneben hatten die Soldaten Schützengräben ausgehoben. Am Morgen war ich beim Spielen in einen Schützengraben gefallen und erst nach langem Schreien von einem deutschen Soldaten wieder herausgezogen worden. Die Frauen, auch meine Mutter, redeten auf den Oberleutnant ein, unter dessen Kommando die Barrikade stand. Der solle doch um Gottes willen die Brücke nicht verteidigen. Er hatte die Bitte abgelehnt, erzählte später meine Mutter. Wir können uns vorstellen, mit welchen Worten: Pflicht. Befehl. Gehorsam. Der Oberleutnant wischte sich, das hat sich mir eingeprägt, die Stirn mit einem besonders großen weißen Taschentuch ab. Es war allerdings auch ein ungewöhnlich warmer Apriltag.
Am Abend war der Oberleutnant mit seinen Soldaten verschwunden. Die Volkssturmmänner zogen sich die Armbinden ab und warfen die Karabiner in die Itz. Die Frauen hängten weiße Laken zu den Fenstern hinaus. Die Panzerspitze der Amerikaner kam, schob einen in der Barrikadendurchfahrt quer gestellten Möbelwagen beiseite. Kurz darauf klingelte es an der Wohnungstür. Die Frauen öffneten, ängstlich aneinandergeklammert, draußen standen drei GIs. Wie leise die waren, man hatte sie gar nicht kommen hören. Dagegen das Dröhnen der genagelten Knobelbecher. Die drei Amis waren, betonte meine Mutter später immer wieder, freundlich. Und einer von den dreien war, was in einer literarischen Erzählung wie ein Klischee wirken würde, tatsächlich schwarz. Die drei blickten kurz durch die Wohnung (von der aus man die Brücke hätte beschießen können) und gingen dann zum nächsten Stockwerk hoch. Wenig später schlugen sie uns fast die Wohnungstür ein, brüllten amerikanische Flüche, bedrohten die Frauen mit der MP. Was war geschehen? Sie hatten oben die Uniformen von sechs deutschen Soldaten gefunden. Die hatten einfach alles liegen lassen, sogar zwei Panzerfäuste, und hatten sich aus den Schränken mit Zivilsachen bedient.
Die Frauen versuchten mit Zeichensprache und einigen Brocken Englisch den GIs klarzumachen: Die deutschen Soldaten sind geflohen. Schließlich beruhigten sich die Amis, und der eine sagte dann, was meine Mutter später für mich in einer besonders breiten Aussprache nachmachte: O.K.
Das hieß ins damalige Deutsch übersetzt: alles in Ordnung.
Aber das war es von da an eben nicht mehr: alles in Ordnung.
Unter Androhung von Strafe durfte ich nicht mehr Heil Hitler sagen und auch nicht mehr die Hacken zusammenschlagen, wenn ich einem Erwachsenen die Hand gab.
Ich gehöre zu der Generation, die eine längere Zeit ohne Väter aufgewachsen ist, weil die im Feld standen, wie es hieß. Für mich war das ein prägendes Erlebnis – vielleicht gibt es sogar Zusammenhänge zu der späteren antiautoritären Bewegung, die von dieser Generation, also meiner, getragen wurde. Ich erlebte die Erwachsenen, die Großen, plötzlich klein. Der allgewaltige Kreisleiter in seiner kackbraunen Uniform stand auf der Straße und musste die Gosse fegen. Männer mit donnernder Kommandostimme baten flüsternd um eine Gefälligkeit. Die Erwachsenen steckten die Köpfe zusammen. Es wurde viel geflüstert. Ich denke, es war die Zeit, als alle sagten: Das haben wir nicht gewusst. Und es gab ein Wort, das seinen Numerus wechselte. Man sagte nach 45 nicht mehr der Jude, sondern die Juden. Ein Wechsel vom Singular in den Plural, aber das bedeutete noch nicht unbedingt einen Wechsel der Mentalität, denn was dieser Plural auch freigab, war die grauenvolle Diskussion über die Zahl der Opfer.
Mein Vater kam aus der Gefangenschaft und begann wieder, an mir herumzuerziehen: So wurde mir auch das O.K. verboten. Amerikanismus. Man sagt: Jawoll oder In Ordnung. Reiß dich zusammen! Nimm die Knochen hoch!
Aber das O.K. hielt sich besonders hartnäckig. Es wurde, da verboten, in den sprachlichen Untergrund, also ins Außerhäusige gedrängt. Wurde dort aber um so lustvoller ausgesprochen, lang gezogen und gut betont. So hielt es sich, jedenfalls bei mir, wurde später von einem Gemeinschaftskundelehrer moniert, einem Altnazi, der in Lederstiefeln und Breeches zu seinen Kameradschaftsabenden radelte.
In der Studentenbewegung, als die Kongresse, Tagungen, Versammlungen gegen den US-Imperialismus abgehalten wurden, verlor sich das O.K., dafür aber kamen Begriffe auf wie Teach-in, Sit-in, Go-in. Es war, jedenfalls am Anfang der antiautoritären Bewegung, die Zeit, als nicht nur neue Begriffe und Wörter übernommen, sondern gebräuchliche neu durchdacht wurden, spielerisch umgedreht, in ihrer Bedeutung erweitert und verändert. In der Zeit gab es in Hamburg einen Graffiti-Künstler namens Eiffe, von dem in der Stadt Sprüche zu...
| Erscheint lt. Verlag | 5.3.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Ästhetik • Autor • Belletristik • Erzählen • Freitisch • Kiepenheuer & Witsch • Literatur • Montaignes Turm • Poetik-Vorlesung • Roman • Schriftsteller • Universität Paderborn • Uwe Timm • Vogelweide |
| ISBN-10 | 3-462-30877-7 / 3462308777 |
| ISBN-13 | 978-3-462-30877-8 / 9783462308778 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich