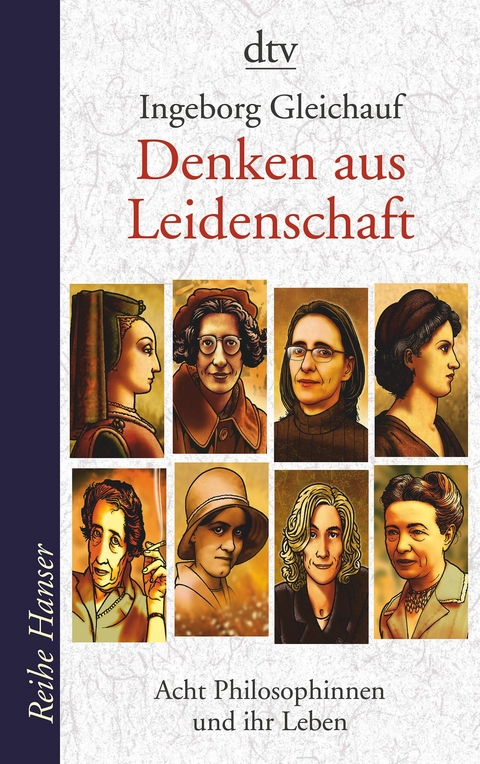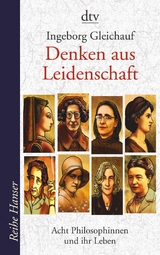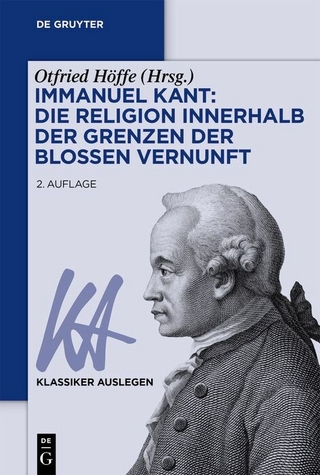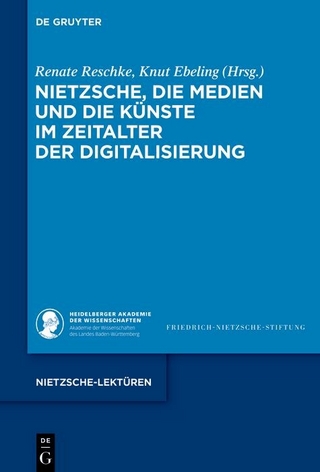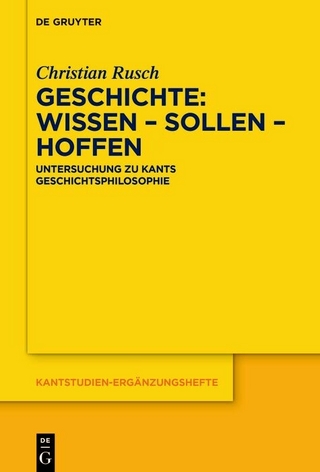Denken aus Leidenschaft (eBook)
288 Seiten
dtv Deutscher Taschenbuch Verlag
978-3-423-40414-3 (ISBN)
Ingeborg Gleichauf studierte Germanistik und Philosophie in Freiburg. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Philosophinnen und verfasste u.a. Biografien über Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Sie lebt in Freiburg und steht für Veranstaltungen zur Verfügung.
Ingeborg Gleichauf studierte Germanistik und Philosophie in Freiburg. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Philosophinnen und verfasste u.a. Biografien über Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Sie lebt in Freiburg und steht für Veranstaltungen zur Verfügung.
EINES TAGES BETRITT EINE JUNGE FRAU die Wohnung ihrer Freundin und fliegt ihr freudig erregt entgegen. »Gestern habe ich einen Chirurg gesprochen, der hat mir gesagt, dass es sehr leicht ist, sich umzubringen.«1 Sie öffnet ihr Kleid und zeigt auf den Fleck unter der Brust, wo der Dolch seinen tödlichen Stoß vollbringen könnte. Die Freundin ahnt Schlimmes angesichts der funkelnden Augen, die sie so begeistert anblicken.
Diese Geschichte hat uns Bettine von Arnim überliefert. Bei der Person mit den gefährlichen Ideen handelt es sich um die von ihr so sehr bewunderte und geliebte Karoline von Günderrode. Wozu würde diese Frau fähig sein? Zwar ist Bettine von Arnim allerhand exzentrische Gedanken und Taten gewöhnt von ihr, was ihr bisher gefallen hat, ist sie selbst doch ebenfalls keine Anhängerin von Langeweile und Alltagstrott. Aber hier scheint Karoline nun doch entschieden zu weit gegangen zu sein. Bettine wird zum ersten Mal unheimlich zumute beim Zusammensein mit der Freundin.
Karoline von Günderrode wird am 11. Februar 1780 in Karlsruhe geboren. Sie ist die Älteste von sechs Geschwistern. Vier Schwestern werden in den Jahren 1781 bis 1784 geboren, der Bruder Hektor 1786. Wurzeln der Adelsfamilie lassen sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen. Das kulturelle und literarische Engagement hat in dieser Familie immer eine große Rolle gespielt. Karolines Großvater beispielsweise, der 1713 geborene Geheimrat und Oberamtmann Johann Maximilian Freiherr von Günderrode, gründete eine bedeutende Bibliothek. Der Vater Hektor Wilhelm von Günderrode ist Hofrat und Kammerherr am Karlsruher Hof, verfasst aber nebenher historische Biografien sowie geschichtswissenschaftliche und staatsrechtliche Schriften. In seinem Charakter wird die Spannung, die zu dieser Zeit innerhalb der Gesellschaft herrscht, besonders deutlich. Er besitzt den kritischen Geist der Aufklärung und bleibt dennoch den Werten seines Standes verhaftet. Er fühlt sich unfrei bei Hof und möchte trotzdem einem Fürsten dienen. Dem Adel gehört er bewusst an, fühlt sich aber nicht mehr so ganz wohl dabei. Dieser Zwiespalt ist typisch für die Zeit des so genannten aufgeklärten Absolutismus.
Auch die Mutter, Louise von Günderrode, greift gern zur Feder und beschäftigt sich zudem mit Philosophie. Sie ist begabt und vielseitig gebildet, wie es für Frauen des Adels und des Bürgertums seit der Mitte des 18. Jahrhunderts üblich ist. Dass Louise von Günderrode neben der Führung des Haushalts und der Erziehung der Kinder überhaupt Zeit findet zum Lesen und Schreiben, ist allerdings erstaunlich, denn noch immer ist die erste Pflicht der Frau, ihrem Mann eine treu sorgende Gattin und den Kindern eine gute Mutter zu sein. Daneben darf sie sich auch mit Lesen, Schreiben und ein wenig Musizieren beschäftigen. Eine ganz und gar ungebildete Gattin ist dem Mann nicht zuzumuten, aber zu lebendig und ungebunden sollte der Verstand sich nicht gebärden.
Über die frühe Kindheit Karoline von Günderrodes weiß man wenig. Der Vater stirbt bereits 1786 an Schwindsucht, woraufhin die Mutter mit den Kindern nach Hanau zieht. Obwohl Louise von Günderrode nicht arm ist, beginnt mit dem Tod des Gatten der soziale Abstieg. Der berufliche Erfolg des Mannes und das damit verbundene gesellschaftliche Ansehen fehlen nun. Man tritt sozusagen auf der Stelle und ist abhängig vom Wohlwollen der Gesellschaft. Hanau ist zu jener Zeit ein aufstrebender Kurort, in dem es sich gut leben lässt und der nicht geizt mit allerhand kulturellen Zerstreuungen. Die Mutter bekommt eine Stelle als Hofdame beim Landgrafen Wilhelm von Hessen. Das ist wichtig für sie und die Familie, bedeutet aber, dass Karoline als ältestes Kind die meiste Zeit des Tages allein für ihre Geschwister verantwortlich ist.
Die Beziehung zwischen Karoline von Günderrode und ihrer Mutter ist kühl. Louise hält sich gern außerhalb der Familie auf. Auch erzählt man sich von einem Verhältnis mit einem Hauslehrer. Von einem starken geistigen Einfluss der Mutter auf die Tochter kann nicht die Rede sein. Die beiden stehen sich eher fremd gegenüber.
Als Karoline von Günderrode vierzehn Jahre alt ist, stirbt ihre Schwester Louise wie der Vater an Tuberkulose. Karoline hat sie bis zu ihrem Tod gepflegt. Was das für ein junges Mädchen bedeutet, kann man gut nachvollziehen. Diese frühe Auseinandersetzung mit dem Sterben wird ihren weiteren Lebens- und Denkweg prägen. Bei der Pflege hat sie sich ein Augenleiden zugezogen, das sie bis zu ihrem Tod begleiten wird, zeitweise verbunden mit heftigen Kopfschmerzen. Die Tuberkulose ist ein weitverbreitetes Übel. In den Jahren 1801 und 1802 werden Charlotte und Amalia, zwei weitere Schwestern Karolines, der sogenannten »Auszehrung« zum Opfer fallen.
Karoline von Günderrode hat ein apartes Äußeres. Ihre Freundin Bettine von Arnim hat sie nach ihrem Tod in ihrem Briefroman Goethes Briefwechsel mit einem Kinde genau beschrieben: »Sie war so sanft und weich in allen Zügen, wie eine Blondine; sie hatte braunes Haar, aber blasse Augen, die waren gedeckt mit langen Augenwimpern; wenn sie lachte, so war es nicht laut, es war vielmehr ein sanftes, gedämpftes Gurren, in dem sich Lust und Heiterkeit sehr vernehmlich aussprach; – sie ging nicht, sie wandelte, wenn man verstehen will, was ich damit auszusprechen meine.«2
Eine Spur Idealisierung steckt wahrscheinlich in dieser Charakterisierung, sieht Bettine in der Freundin doch das, was sie selbst nicht ist: eine sanfte, anmutige Person, deren Füße die Erde nicht eigentlich berühren. Diese Karoline hat etwas Schwebendes, Überirdisches. Einen Nachteil bringt das sanfte, weiche Aussehen allerdings für sie: Sie wird von ihrer Umgebung unterschätzt. Denn hinter diesem anmutigen Äußeren verbirgt sich eine Person mit einem abgründigen und widerspenstigen Inneren, die zudem mit einem scharf denkenden Verstand ausgestattet ist. Diese Mischung wird selbst ihre besten Freunde zeitlebens aufs Höchste verwirren.
Das ist verständlich, wenn man bedenkt, wie Frauen sich zu jener Zeit zu benehmen hatten. 1803 lässt uns der romantische Dichter Clemens Brentano, seit drei Jahren befreundet mit Karoline von Günderrode, in einem Brief an seine Schwester Gunda teilhaben an seinem Blick auf die Frau, und zeigt sich damit voll und ganz als Kind seiner Zeit: »Alles, was ihr tut, muss Liebreiz werden oder Pflege und hängt einzig mit eurer Bestimmung zusammen, uns zu locken und aus dem Staat in jedem Augenblick zum bloßen Leben zurückzuführen und dann Mutter zu werden.«3
Dem kann und will Karoline von Günderrode nicht entsprechen. Sie hat durchaus viel Familiensinn, immerhin ist sie lange Zeit für ihre Geschwister fast Mutterersatz gewesen. Genauso stark entwickelt ist aber ihr forschender Verstand. In ihrem Bildungsbestreben sind deutliche Parallelen zu ihren Vorfahren festzustellen. Geschichte, Literatur und Philosophie sind die Gebiete, die sie am meisten interessieren. Die Zeit, in der sie lebt, ist besonders reich an genialen Philosophen und Dichtern. Dabei herrscht aber keine Eindeutigkeit in der geistigen Ausrichtung. Eine für die Philosophiegeschichte ungemein wichtige Strömung ist der Idealismus, dessen Vertreter davon ausgehen, dass die gesamte Wirklichkeit metaphysisch, das heißt von jenseits des sinnlich Gegebenen aus, erkannt und begründet werden muss. Am weitesten hinein in metaphysische Bereiche wagt sich Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831). Kein Philosoph vor ihm und nach ihm hat ein derart schlüssiges, in sich fest gefügtes Denksystem geschaffen. Er gehört dem »Objektiven Idealismus« an. Im Gegensatz zu ihm ist ein zweiter Vertreter des Idealismus zu sehen: Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814). Er überhöht das Ich des Menschen, die Subjektivität, bis diese zu einer metaphysischen Instanz wird, und geht so weit zu sagen, alles Wirkliche sei eine »Setzung« des Ich.
Karoline von Günderrode liest sie beide. Außerdem beschäftigt sie sich mit Dichtung von Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin, Novalis, Johann Wolfgang von Goethe und Clemens Brentano.
Dabei ist sie gerade einmal neunzehn Jahre alt, ein für damalige Verhältnisse so genanntes »altes Mädchen« mit wenig Chancen auf eine gute Partie. Eine Heirat gilt als einzige wirklich sichere Quelle des Glücks, wobei man die Liebesheirat mittlerweile als Möglichkeit akzeptiert. Für Karoline von Günderrode ist neben der finanziellen Misere aber noch ein zweites Problem vorhanden. Die Männer, auch wenn sie auf dem Papier und in ihren Reden die kühnsten Gedanken äußern, wollen als Ehefrau doch lieber ein, wenn auch nicht ungebildetes, so doch »gezähmtes« Weib. Günderrode hat für die Zeit höchst »unweibliche« Gedanken. Ihr Verstand will sich nicht in den Grenzen der Schicklichkeit halten.
1797 ergibt sich für die Mutter eine wunderbare Möglichkeit, die unangepasste Tochter loszuwerden. Im Cronstetten-Hynspergischen Stift zu Frankfurt, in dem die Familie von Günderrode auf drei Stiftsplätze Anspruch hat, wird überraschend ein Platz frei. Louise von Günderrode greift zu und ist damit die Sorge um die Zukunft ihrer Tochter los, die nun vor allem mit alten Damen zusammenwohnt.
Das Stift war 1753 gegründet worden und ist nur für mittellose adelige Witwen oder Fräulein bestimmt. Die Regeln sind sehr streng. Besuche oder gar Feste sind nicht erlaubt. Die Frauen müssen dunkle Kleider tragen, feste Essenszeiten einhalten und dürfen nicht ins Theater gehen. Man beschäftigt sich mit Hauswirtschaft, Gesellschaftstanz und Handarbeiten. Ein wenig Musizieren oder ein...
| Erscheint lt. Verlag | 1.4.2010 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Kinder- / Jugendbuch ► Biographien | |
| Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Geschichte der Philosophie | |
| Schlagworte | Biografien • Christine de Pizan • Denkerinnen • eBook • Edith Stein • Frauenporträts • Hannah Arendt • Jugendsachbuch • junior Sachbuch • Karoline von Günderrode • Lebensgeschichten • Martha Nussbaum • Petra Gehring • Philosophie • Philosophiegeschichte • Simone de Beauvoir • Simone Weil • weibliche Philosophen |
| ISBN-10 | 3-423-40414-0 / 3423404140 |
| ISBN-13 | 978-3-423-40414-3 / 9783423404143 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich