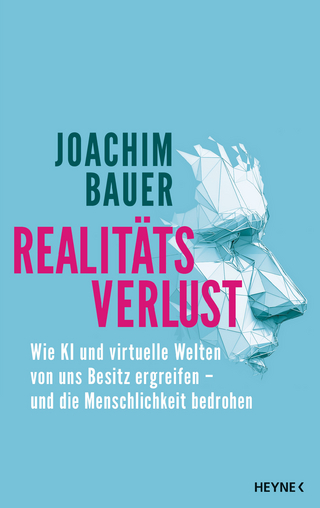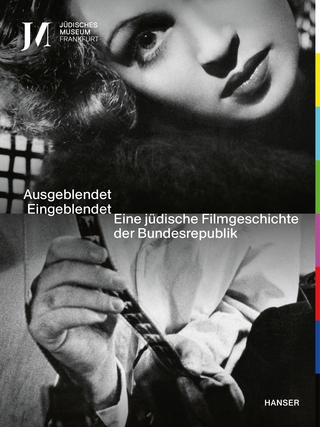Politik und Bild
Tectum Wissenschaftsverlag
978-3-8288-3741-6 (ISBN)
Arthur Engelbert ist seit 1996 Professor für Medientheorie und Kunstwissenschaft an der FH Potsdam und habilitierte 1998 im Fach „Medientheorie und Kunstwissenschaft“. Neben seiner Lehrtätigkeit leitete Arthur Engelbert über zehn Jahre hinweg ein Multimediaunternehmen (MIB) in Berlin, war viele Jahre im Vorstand des Werkbund-Archivs in Berlin und hat seit 1999 ein interdisziplinäres Forschungsprojekt (cultrans) aufgebaut, das Transfers zwischen den Kulturen und Künsten untersucht. Seit 2010 gehört er dem DFG-Graduiertenkolleg „Sichtbarkeit und Sichtbarmachung“ an der Universität Potsdam an. In 2012 gründete er mit anderen das Institut für angewandte Realitätsveränderung.
EINLEITUNG
DEKADE I
PASTICCIO I 1980–1989
1980.01 Fritz Cremers Galileo Galilei
1982.02 Bald finden wir den Ausdruck unserer Zeit. Die Darstellung des Menschen
bei Wilhelm Lehmbruck
1987.03 Nutzungsvorschläge für das Völklinger Hochofenensemble
1987.04 Drei japanische Künstler: Aki Kuroda – Hidetoshi Nagasawa – Keiji Uematsu
1987.05 Der vergessene Gebrauch
.
1987.06 Industrie im Bild – Bild der Industrie
1987.07_A Rezension zu: Katalog Münster, Die deutschen, niederländischen
und italienischen Tafelbilder bis um 1530
1987.07_B Gespräch in der Arena-Kapelle Padua
1988.08 Die Tastatur der Zeichnung
1988.09 Aktion Painting und Informel. Überlegungen zum Verständnis
der Zeichnung bei Pollock und Wols
1989.10 Für eine Betriebskunde der Kunst
1989.11 Aufenthalte im Jetzt
DEKADE II
PASTICCIO II 1990–1999 .
1990.01 Variation – Serie – Simulation
1990.02_A Metamorphosen in Stein
1990.02_B Fußball im Lande Michelangelos
1990.02_C Detlef Günther. Der Tag Heute Davor und Dahinter und Mittendrin
1991.03_A Kunst als Medium der Botschaft?
1991.03_B Die Spannkraft des Sehens
1993.04 Bauanleitung des Sehens
1993.05 Technisches Sehen – ein Fragment
1995.06 Von Eleusis nach Las Vegas. Anmerkungen zur Phänomenologie des Sehens
1995.07 Freitag und Sonntag. Ein Brief an den Leser
1996.08 Der virtuelle Augenaufschlag
1996.09 Denn sie wissen nicht, was sie tun. Zur Vorgeschichte von Multimedia I.
1996-
2002.10 O. Winston Link. Zur Vorgeschichte von Multimedia II
1999.11 Die Grenzen der Reflexion im Spiegel des Bildes
DEKADE III
PASTICCIO III 2000 – 2009
2001.01 Verbundenheit. Netzwerke
2001.02 Content First. Ein Manifest für den Inhalt
2002.03 Es besteht kein Grund an Sichtbarkeiten festzuhalten – eine Polemik
2003.04 Bildanalyse und technologischer Standard – ein kritischer Rückblick
auf Multimedia
2004.05 Die Kunst, nicht das Spiel entscheidet
2005.06 Die Unkultur der Einmischung
2005.07 Das Kunstwerk und die Rolle des Betrachters
2008.08 Die sprechende Stadt
2008.09 Über das Lachen
2009.10 Kleine Philosophie des Gehens
2008-2010.11 Zwölf Jahre "Digitale Galerie" in der Gemäldegalerie Berlin
DEKADE IV
PASTICCIO IV 2010 – 2015
2010.01 Schönheit und Vitalität
2011.02 Glossar zu Bildbegriffen
2012.03 Die Wahrnehmung der Katastrophe als Medienereignis
2012.04 Urbane Differenz – kreative Gemeinschaften im globalen Kontext
2013.05 Kunstvermittlung – zwei Ausstellungsformate in der Kritik
2014.06 Bildmigration
2013 – 2015.07 Briefe aus Havanna
2015.08 Meme, Gene und Codes
NACHWORT
Bildnachweis
Index
Anmerkungen
Nachwort Politik und Bild hat einen Zeitraum von 35 Jahren abgedeckt und ist mit den beiden Hauptlinien der Diskussion in der Jetztzeit angekommen. Die Auseinandersetzung zeigt, dass erstens die zeitgenössische Kunst mit der ökonomischen Entwicklung gleichgezogen hat und dass zweitens aus dem Übergang von industriell-technischen zu technologisch-bedingten Produktionsformen keine neue Epoche hervorgegangen ist, die Begriffe wie „globalisierte Postmoderne“ oder „Siliziumzeitalter“ nahelegten. Dennoch weisen viele Anzeichen darauf hin, dass in absehbarer Zeit eine Revolution aller Lebens- und Arbeitsbedingungen in einer Größenordnung ansteht, wie es zuletzt um 1800 in Europa mit dem sich ankündigenden Industriezeitalter der Fall war. Woher die Überzeugung für diese vorausblickende Einschätzung kommt, ist schnell gesagt. „Hinter“ den Displays und Interfaces laufen zunehmend Programme, die beispielsweise jede Datenanfrage, jeden Link registrieren. Sehr wahrscheinlich lassen sich schon recht bald die persönlichen Gewohnheiten eines jeden Bürgers noch genauer erfassen. Das Spektrum der persönlichen Datenerfassung wird es ermöglichen, das Gesicht, die Körpereigenschaften, das Konsumverhalten, die Mobilität und möglicherweise auch die Denkbewegungen jedes einzelnen Bürgers zu identifizieren, auszuwerten und vorherzusagen, vielleicht noch etwas unscharf, aber weltumspannend und in Echtzeit. Wir werden also zunehmend mit unseren eigenen Daten und indirekt mit anderen, die darauf Zugriff haben, kommunizieren. Das Verhältnis von Mensch und Umwelt wird sich immer starker verändern. Dieses Verhältnis ist bereits regulierbar geworden. Die Bezugsgrößen Mensch und Umwelt werden durch technologische Parameter erfasst und manipulierbar. Während das „gute alte Wahrnehmungsmodell“ von einem überschaubaren persönlichen Umfeld und einem kontrollierbaren Gesichtsfeld ausging, sind die kommunikationsfähigen Daten der intelligenten Dinge weitestgehend unsichtbar. Warum sollten sie auch sichtbar sein, wenn die Kommunikation auf der Ebene der Benutzeroberfläche erfolgreich abläuft? Es wird einfach noch eine weitere Ebene in das Verhältnis von Mensch und Umwelt eingefügt. Das ist letztlich nicht weiter bedenklich, sondern wird durchaus das Leben und Arbeiten angenehmer und einfacher gestalten. Wie verhält es sich mit der Frage der Quantifizierung? Im Prinzip ist auch die Vermassung und Einebnung nichts Neues. Das Industriezeitalter sowie die Einführung von Sozialsystemen haben bereits überaus deutlich gezeigt, dass die Quantität in qualitative Vorteile überführt werden kann. Das sich abzeichnende Problem liegt demzufolge woanders. Dazu muss man die Beziehung von Quantität, die nichts bedeutet, wenn sie nicht auch qualitativ bewertet wird, zur Qualität, die ebenfalls wenig aussagt, wenn sie sich nicht inhaltlich begründet, genauer betrachten. Die Kritik gegenüber der neuen Quantifizierung nimmt an Folgendem Anstoß: Sie gipfelt in der Forderung, dass der generellen Quantifizierung dort entschieden Einhalt geboten werden müsse, wo Recht und Unrecht gelten. Damit sind große gesellschaftspolitische Spannungen vorhersagbar. Vereinheitlichung, technologische Intelligenz und Quantifizierung haben dort ihre Grenze, wo die bereits bestehenden Grundrechte anfangen und demokratische Gesetze verletzt werden. Die Idee der Qualität war und ist eine Konstruktion, die entweder mit der Idee des ‚Weniger ist mehr’, gegen das Zuviel polemisiert oder die die Menge bzw. Masse bewertet, d.h. auf- und abwertet. In der europäischen Tradition ist die Qualität außerdem mit dem humanistischen Konzept des Individuums verbunden. Das quantitativ bestimmbare wird zu einem als qualitativ zu bewertenden Individuum, wenn es seine Freiheit und Einzigartigkeit selbst in die Hand nimmt, sprich, wenn es Qualität definiert, diese für sich behauptet und durchsetzt. Quantität ist also nicht per se negativ und Qualität nicht per se positiv. Das Verhältnis beider ist im Begriff, auf einer neuen Ebene politisch ausgehandelt zu werden. „Das Galilei-Problem ist das geistige Problem unserer Zeit“ – womit wir auf die von Bertolt Brecht herausgearbeitete These einer notwendigen Ethik der wissenschaftlichen Intelligenz zurückkommen. Dies stand ganz am Anfang von Politik und Bild. Blickt man auf die Anfange des einbrechenden Industriezeitalters zurück, werden die Visionen von Weltliteratur (J. W. von Goethe), Weltausstellung (Messe) und Weltkunst (Pariser Salons) wieder virulent. Man sollte sie auf die sich verändernde globale Bühne der Gegenwart beziehen. Möglicherweise konnte das tradierte Theater, weil es heutzutage am wenigsten korrumpiert ist oder auch das digitale Museum, das sich noch erfinden muss, eine kulturelle Drehscheibe für alle anderen Kultureinrichtungen werden. Entbildlichung Die Konsequenz bildorientierten Denkens und Handelns ist, dass nicht mehr die Welt zum Bild wird, wie Cusanus es vor fünf Jahrhunderten angesichts des europäischen Tafelbildes auf eine Formel gebracht hat, sondern das tätige Weltverhältnis des gesellschaftlich eingebundenen Einzelnen ist selbst bildanleitend. In der Alltagssprache hört man bereits, dass es real wie in der Welt der Bilder zugehe oder eine Situation wie in einem Film ablaufe. Damit ist eigentlich ausgeschlossen, dass es noch Bilder im tradierten Verständnis gibt, die eine ikonische Differenz anzeigen. Die Welt sieht so aus, wie sie bildlich geworden ist bzw. wie sie in Übereinstimmung mit dem bildlichen Entwurf schon bald aussehen wird. Bilder machen nichts mehr sichtbar, sondern drängen von Bild zu Bild auf Verwirklichung. Die Umkehrung von der ansichtigen Welt dort zur Umsetzung des bildhaften Tuns hier ist gegenwärtig der Fall. Um das weiter zu diskutieren, muss man die Logik der Langzeitstudie von Politik und Bild einbeziehen. Dadurch wird verständlich, dass die Analysen des bildorientierten Denkens und Handelns auf einem nachvollziehbaren Entstehungsraum basieren. In Politik und Bild werden Studien zusammengefasst und für eine darüber hinausgehende Fragestellung zugänglich gemacht. Anhand des Reflexionsraumes von 35 Jahren lassen sich die Beobachtungen und Auseinandersetzungen als ein Prozess begreifen. Während der einzelne Wissenschaftler immer in seinen Kontext eingebunden ist, eröffnet die Zusammmenschau die Möglichkeit, diese Kontexte zu thematisieren und zu verschieben. Es ist also möglich, eine kritische Infragestellung dieses Prozesses selbst vorzunehmen. Der zur Disposition stehende Prozess enthält den Übergang von alten zu neuen Bildmedien. Dies wurde u.a. anhand der Digitalen Galerie in der Gemäldegalerie Berlin deutlich. Die Navigation der neuen Schnittstellen leitet sich, formelhaft gesagt, aus den alten Bildmedien ab. Das digitale enthalt technische Errungenschaften des analogen Bildes. Wenn man gegenwärtig vom bildorientierten Denken und Handeln spricht, so ist damit die Dauerpräsenz des medialen Bildes in den Übergangstufen von Fernseher, Computerbildschirm oder Display der Smartphones gemeint. Darin ist der Übergang vom Raum auf den Körper angezeigt. Die Smartphones sind eine Vorstufe medial projizierbarer Gehirnbilder. Bezieht man diese Entwicklung auf den einzelnen Wissenschaftler bzw. Zeitgenossen, muss man feststellen, dass jeder Einzelne nur seine medial bzw. technisch vermittelte Umgebung kennt. Es gibt die wissenschaftlichen Grenzen der Disziplin und die Grenzen des persönlichen, vertrauten Erfahrungsraumes. Dass die mediale zunehmend in die persönliche Umgebung des Einzelnen eingreift, ist durch die skizzierte Ubiquität medialer Bilder angesprochen worden. Jedes einzelne Individuum ist auf die Grenzen seiner Umgebungen zurückgeworfen, jeder ist Teil einer Indienstnahme, die den hier angesprochenen Vermittlungsprozess kennzeichnet. Das bildorientierte Denken und Handeln ist ein gesellschaftlich sanktioniertes und ausbildungstechnisches Gefüge, in dem der Einzelne seinen funktionalen Platz hat. Die Idee des Individuums, welches selbstbestimmt als Glied die Summe aller gesellschaftlichen Bezüge durch die Hervorhebung seiner einzigartigen, z.B. künstlerischen Umgebung, bildet, gehört der Vergangenheit an. Das Gefüge gleicht einem totalitären Kastensystem, in dem (politisch verstanden) Entscheider, Lobbyisten und Experten den Ton angeben und in dem (bildlich verstanden) die Einfügung des Einzelnen eine Differenzierungsfalle ist. Es gibt für dieses politische Kalkül der Indienstnahme kein Bild, außer man weist mit einer Geste auf die vielen anderen hin, die ständig ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen vor und mit medialen Bildern abgleichen und durch sie unterhalten, gesteuert, informiert und geprägt werden. Das digitale Bild in Form seiner aktuellen Entwicklungsstufe zeigt rückblickend, dass die visuelle Einbeziehung erst der Lithografie und Fotografie in die Zeitung bzw. die Illustrierte, dann des Filmes bzw. des Videos ins Fernsehen und schließlich die Vereinheitlichung aller digitalisierbaren Medien auf die Bildschirmoberflachen „als Rechnung“ aufgegangen ist. Die Grenzen der Denkfabrik wurden hier anhand mechanisierter Produktionsformen diskutiert, wobei sich ergab, dass die arbeitsteilige Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften die binäre Logik verschärft hat, und dass demzufolge die assoziative, visuelle Argumentation in den technisch basierten Zwängen der Produktion gefangen bleibt. Sie stellt keine Alternative zur ästhetischen Produktion dar. Lineare und nicht lineare Produktionsformen gehen gleichermaßen aus der digitalisierten Denkfabrik des Geistes und der Dinge hervor. Will man das auf den hier untersuchten Prozess beziehen, muss das deformierte Individuum notgedrungen lernen, seiner historisch erkennbaren Indienstnahme ins Gesicht zu sehen und sich selbst die mediale Machtfrage stellen. Galileis Problem der persönlichen und wissenschaftlichen Unabhängigkeit existiert in abgewandelter Form noch immer. Bezogen auf den Prozess der Digitalisierung ist der politische Druck ähnlich; er hat sich nur verlagert und verlangt eine andere Definition des Verhältnisses zur Umgebung des Einzelnen. Man muss die Umgebung, in der sich das Persönliche und das Mediale überlagern, sozusagen verlassen und sich von der erdgebundenen Schwerkraft des bildgesteuerten Denkens und Handelns lösen. Das schwerelose (bezugsoffene) Individuum wäre eigens zu entdecken. Galileis Problem ist eine erkennbare Herausforderung an den Einzelnen geworden, über die Erkenntnis seiner Anpassung an diese hinauszugehen.
| Erscheinungsdatum | 16.08.2016 |
|---|---|
| Zusatzinfo | teils farbige Abbildungen |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 170 x 240 mm |
| Gewicht | 1388 g |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Allgemeines / Lexika |
| Sozialwissenschaften ► Kommunikation / Medien ► Medienwissenschaft | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie | |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | 1980 bis 1989 n. Chr. • 1990 bis 1999 n. Chr. • 2000 bis 2009 n. Chr. • 2010 bis 2019 n. Chr. • Arthur Engelbert • Bildforschung • Bildinhalt • Bildmigration • Bildwissenschaft • Blick • Cultrans - Ansichts-Sachen der Kunst • Deutschland • DFG Graudiertenkolleg Sichtbarkeit und Sichtbarmachung • Digitalisierung • Fotografie • Galileo Galilei • Inhaltsanalyse von Bildern • Insitut für angewandte Realitätsveränderung • Kunsttheorie • Medienwissenschaften • Politik • Politik und Bildmedien • Politikwissenschaft • Sozialtheorie • Zeitgenössische Kunst |
| ISBN-10 | 3-8288-3741-7 / 3828837417 |
| ISBN-13 | 978-3-8288-3741-6 / 9783828837416 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich