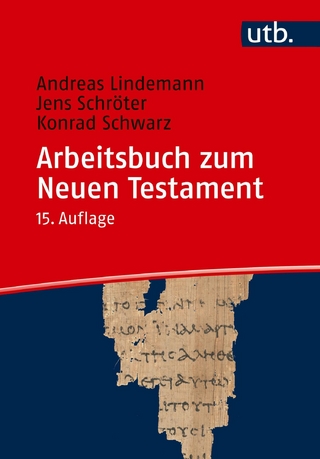Warum ich an Gott glaube (eBook)
208 Seiten
Verlag Herder
978-3-451-84105-7 (ISBN)
Doch verwoben mit dieser Geschichte seines Lebens behandelt er in der ihm eigenen spannenden und anschaulichen Art und Weise Fragen, die in jedem christlichen Leben eine entscheidende Rolle spielen: die Frage nach der Wahrheit in der Bibel, nach der Rolle der Vernunft im christlichen Glauben, nach dem Umgang mit Gott, wenn es zu den wirklichen Lebensentscheidungen kommt. Im letzten Teil seines Buches stellt er sich der immer drängender und herausfordernden Frage, wie der christliche Glaube in einer Welt bestehen kann, die voll Hass, Krieg und Vernichtung ist. Kann man in einer solchen Welt noch an Gott glauben?
Gerhard Lohfink (1934-2024), bis 1986 Professor für Neues Testament an der Universität Tübingen. Veröffentlichte zahlreiche Bücher, die meisten davon bei Herder (zuletzt: Warum ich an Gott glaube, 2024); viele Übersetzungen in andere Sprachen.
| Erscheint lt. Verlag | 10.6.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Christentum |
| Schlagworte | Altes Testament • Autobiografie • Biblische Theologie • Glaubensbekenntnis • Glaubenserfahrung • Glaubensfragen • Glaubensleben • Glaubenspraxis • Jesus Christus • Katholische Theologie • Neues Testament • Seelsorge |
| ISBN-10 | 3-451-84105-3 / 3451841053 |
| ISBN-13 | 978-3-451-84105-7 / 9783451841057 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 972 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich