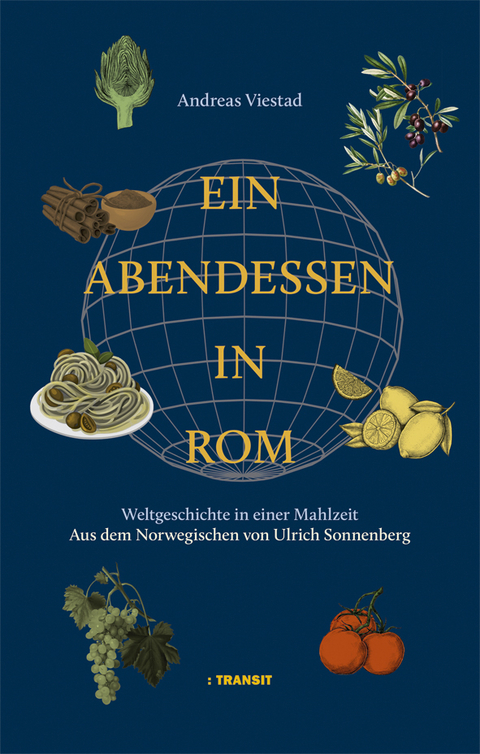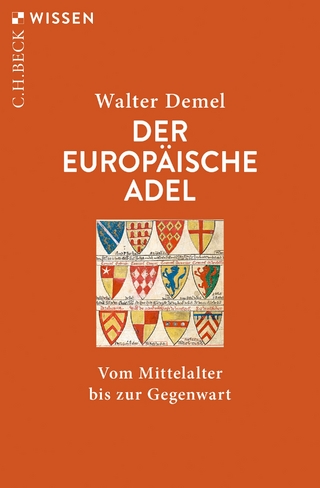Ein Abendessen in Rom
Transit (Verlag)
978-3-88747-409-6 (ISBN)
»Ein Abendessen in Rom« ist ein ganz besonderes, sehr inspirierendes Buch übers Kochen und Essen. Ausgehend von der traditionellen Speisekarte in seinem Lieblingslokal »La Carbonara« am Campo de`Fiori, schreibt Andreas Viestad über das Brot, über den Getreideanbau; über das daraus entstehende römische Weltreich, über das Salz in den verschiedensten Regionen der Welt, über neue Handelswege und alte Kriege in Europa und der ganzen Welt, über den Wein, das Öl, den Pfeffer und den Zucker - und darüber, wie diese Nahrungsmittel und Gewürze uns verändert und bis heute geprägt haben. Eine originelle, gut recherchierte und abenteuerliche Reise durch die kulinarische Geschichte der Menschheit.
ANDREAS VIESTAD, 1973 in Oslo geboren, lebt als Autor und Kolumnist (u.a. für die »Washington Post und die Sunday Times) zu gastronomischen Themen auf einem Bauernhof nahe Oslo und in Rom. Seine Fernsehserien in Norwegen, in den USA, Italien, oder Deutschland über kulinarische und ernährungspolitische Themen wurden und werden hochgelobt. Er betreibt mehrere Restaurants und hat in Norwegen Zentren für Kinder gegründet, in denen sie Kochen und etwas über die wichtigsten Nahrungsmittel lernen können. Sein Buch »Ein Abendessen in Rom« wurde u.a. ins Englische, Indische, Polnische, Spanische und jetzt ins Deutsche übersetzt.
Ulrich Sonnenberg lebt in Frankfurt am Main und übersetzt Prosa und Sachbücher aus dem Dänischen und Norwegischen, sowohl Gegenwartsautoren wie Carsten Jensen und Karl Ove Knausgaard als auch moderne Klassiker wie Hans Christian Andersen, Herman Bang, Knut Hamsun, Johannes V. Jensen und Tom Kristensen. 2013 erhielt Ulrich Sonnenberg den Dänischen Übersetzerpreis.
Der Mittelpunkt des Universums
Brot
Antipasto
Öl
Salz
Pasta
Pfeffer
Wein
fleisch
Feuer
Zitrone
Anhang
Der Mittelpunkt des Universums Das La Carbonara ist nicht das beste Restaurant Roms. Dafür gibt es dort zu viele Gäste, das Tempo ist zu hektisch und der Umsatz zu hoch. Es liegt einfach zu gut. Trotzdem ende ich nach meinen langen Wanderungen auf Pflastersteinen, vorbei an Ruinen und Palästen und durch die Museen der ewigen Stadt, immer wieder hier. Das Restaurant liegt an der Nordseite des Campo de’ Fiori, einem hektischen Platz mitten in Roms historischem Zentrum. Morgens kommen die Gemüsehändler mit kleinen Lastwagen und überladenen dreirädrigen Mopeds. Danach die Blumenhändler und diejenigen, die die Touristenbuden mit Salami, Trüffelöl und Bandnudeln füllen. Den ganzen Tag über ist der Platz voller Menschen, Römern und Touristen. Jetzt, gegen Abend, packen die Verkäufer zusammen, und ich laufe über abgerissene Nelken und abgezogene Blumenkohlblätter. Eine kleine Kehrmaschine, unerheblich effektiver als ein gewöhnlicher Besen, bewegt sich ungeschickt zwischen den Buden. James Joyce behauptete verächtlich, »Rom kommt mir vor wie ein Mann, der davon lebt, dass er die Leiche seiner Großmutter für Reisende zur Schau stellt«. Aber man kann hier auf denselben Marmorstufen sitzen, auf denen Kaiser gesessen haben, über Pflastersteine gehen, die mit Gladiatoren- und Heiligenblut bespritzt sind, Monumente der Schaffenskraft und des Wahnsinns einzelner Menschen besuchen und sich Orte ansehen, die für die Entwicklung unserer westlichen Kultur entscheidend waren. Bei meinen ersten Aufenthalten in Rom lief ich mit glänzenden Augen umher. Wenn ich durch die Stadt lief, um mir irgendeine Sehenswürdigkeit anzusehen, stolperte ich ständig über irgendwelche andere historische Denkmäler. Es war faszinierend, aber auch ermüdend. Und es wurde nicht unbedingt besser, als ich eine Archäologin heiratete. Für einen Beruf, der davon lebt, nicht die Leiche seiner Großmutter zu studieren, sondern die Leichen der Urururururgroßmütter und ihre Hinterlassenschaften, ist Rom der ideale Ort. Indem ich Rom durch die Augen meiner Frau erlebte, lernte ich, den Geschichten zuzuhören, die von den Gebäuden und Ruinen erzählt werden. Wenn sie mich herumführt, bleiben wir bisweilen an einem Pflasterstein, einer unebenen Oberfläche oder den Resten einer uralten Säule in einem weit neueren Haus stehen. Meine Frau hat mir gezeigt, wie Rom mit Materialien aus den vielen früheren Leben der Stadt auf uralten Grundmauern erbaut ist – und dass selbst heruntergekommene Bauten und Ruinen ihre eigene Würde haben. Ein ewig wiederkehrendes Thema unter den Archäologen, mit denen ich zu tun habe, ist die Feldarbeit. Die Monate oder Jahre, die sie mit Graben verbringen, geben ihnen eine Perspektive und einen Fundus, von dem sie lange zehren, auch wenn sie – wie die meisten von ihnen – hinter dem Schreibtisch einer öffentlichen Institution enden. Die Feldarbeit ist der Grund, warum sie sich als etwas Besonderes sehen, denn sie haben trotz allem den jubelnden Triumph erlebt, der Geschichte so nah wie überhaupt möglich zu sein. »Du stehst genau dort, wo die Menschen, die früher hier gelebt haben, standen, und du hältst die gleichen Gegenstände in den Händen«, erklärt mir meine Frau mit derselben Begeisterung, mit der sie versucht, ihre Studierenden zu motivieren. Die Geschichte kann zu uns durch die Kunst, durch Gebäude, durch Pflastersteine und Ruinen sprechen, einfach dadurch, dass wir in einer Stadt wie Rom, die so viel Vergangenheit enthält, unmittelbar vor Ort sind. Und außerdem kann man die Geschichtsstunde bei gutem Essen und Trinken schwänzen, mit langen Abenden voll sorgenfreiem und gedankenlosem Genuss. Endlich befreit vom Joch der Vergangenheit, von der niemals endenden Geschichtsstunde! In einer flüchtigen Stunde am Tisch, mit einem Teller Pasta und einem Glas Wein, konnte sich selbst James Joyce entspannen und einräumen, dass Rom ein schöner Aufenthaltsort ist. Nur ist es nicht wahr, dass Essen flüchtig sein soll, während Marmor und Pflastersteine beständig sind. Denn wenn ich es recht bedenke, findet sich die Geschichte auch im Essen, ja, vielleicht sogar in einem noch viel höheren Maß. Die Gegenstände, mit denen sich die Archäologen befassen, sind im Wesentlichen stabiler Natur – Waffen und Schmuck, Mauern und Münzen. Die meisten historischen Quellen, die wir nutzen, handeln von Dingen, die für wichtig genug angesehen wurden, um darüber zu schreiben. Wie Gold und Generäle, Siege und Eroberungen. Ich bin jedoch überzeugt, dass Essen das Potenzial hat, eine andere Geschichte zu erzählen: Woher kommen wir, wie haben wir gelebt, was hat uns motiviert und inspiriert. Meine Feldarbeit fand am Tisch statt. Mehr als fünfzigtausend Mahlzeiten haben mein Inneres geformt – und mein Äußeres. Ich habe gegessen, ich habe über das Essen gelesen, ich bin gereist, um mehr übers Essen herauszufinden, ich habe Essen zubereitet, und ich hatte das Glück und war clever und listig genug, mein weit gefächertes Interesse am Essen zu meinem Beruf zu machen. Wo Archäologen versuchen, durch das Loch eines Pfahls oder die Reste einer Grundmauer Licht auf die Vergangenheit zu werfen, werde ich ein Salzkorn, einen Teller Pasta und ein Glas Wein nutzen. Nennen wir dieses Verfahren – und wenn ich damit auch nur meine Frau ärgere – kulinarische Archäologie. Ungefähr in der Mitte des Campo de’ Fiori steht die Statue Giordano Brunos. Hier bleiben Touristenführer für gewöhnlich stehen, um die Geschichte des Dominikanermönchs, Mathematikers und Astrologen zu erzählen, der an der kopernikanischen Revolution weiterarbeitete. Bruno erklärte, die Sterne hätte man nicht auf das Himmelsgewölbe gezeichnet, damit wir uns etwas anschauen können. Sie wären Sonnen wie unsere eigene, nur sehr, sehr weit entfernt. Außerdem behauptete er, das Universum hätte kein Zentrum, und die Welt würde durch Naturkräfte gesteuert. Eine gewagte These, denn sie besagt in der Konsequenz, dass Gott nicht allmächtig und das Wort der päpstlichen Kirche nicht unfehlbar ist. Es kam, wie es kommen musste: Giordano Bruno wurde verhaftet, verurteilt und schließlich am 17. Februar 1600 auf dem Campo de’ Fiori verbrannt. Damit er die Anwesenden mit seinen gefährlichen Ansichten nicht vergiftete, wurde eine Metallplatte an seiner Zunge befestigt, bevor er zur Richtstätte geführt wurde. Als eine Gruppe Intellektueller mit Walt Whitman, Victor Hugo und Henrik Ibsen an der Spitze 1889 die Statue von Bruno auf dem Platz errichten ließ, hagelte es heftige Proteste der Kirche. Es zirkulierte sogar die Drohung, der Papst wolle den Heiligen Stuhl aus Rom verlegen, wenn die Stadt mit einer Statue des ketzerischen Mönchs geschändet würde. Seit dieser Zeit war der Campo de’ Fiori ein Versammlungsort von Gegnern der päpstlichen Kirche. Immer wieder mussten die Behörden Graffiti mit der Botschaft »A basso il Papa!« – »Nieder mit dem Papst« – von den Hauswänden rund um die Statue entfernen lassen. Eine überholte Darstellung der Vergangenheit, auf die ich bisweilen stieß, als ich Geschichte studierte, und die in Reiseführern und klassischen Geschichtsbüchern noch immer kursiert, stellt Geschichte als die Summe der Handlungen und Entscheidungen großer Männer dar. Ein moderneres Geschichtsverständnis legt jedoch Wert auf die materiellen Verhältnisse, auf tiefere Machtstrukturen, auf Ideen, Ideologien und Besitzverhältnisse. Die wenigsten Historiker erwähnen das Essen, abgesehen von Ereignissen, die zu Hungersnöten und Krisen oder dem Erschließen neuer Ressourcen führten. Aber das Essen ist nicht nur ein Resultat der Geschichte. Ich behaupte, dass das Essen manchmal, ja, eigentlich ziemlich oft, ein bewegender Faktor war, hin und wieder sogar der auslösende Faktor, der dazu führte, dass wir sesshaft wurden und uns so organisierten, wie wir es getan haben – wir also zu den Menschen wurden, die wir heute sind. Wir müssen nur, wie Giordano Bruno es so ketzerisch empfahl, die Perspektive ändern, um es zu erkennen. Dieses Buch handelt von einem Abendessen in einem Restaurant in Rom, und diese Mahlzeit kann uns wie alle anderen Mahlzeiten etwas über unsere Vergangenheit erzählen. Es geht um Geschmäcker, die uns verändert haben, um Ausgangsprodukte, die uns geformt haben, um Lebensmittel, die ein Imperium ernährten, und um die Jagd nach dem Ursprung des weltbesten Gerichts. Mit diesem Blick ist – um es auf die Spitze zu treiben, aber nicht zu übertreiben – mehr Geschichte in einem Kotelett oder einem Teller Pasta als im Kolosseum oder eine der anderen historischen Denkmälern. Und im Gegensatz zu den Pflastersteinen und Gebäuden ist ein Essen immer wieder etwas Neues, egal, welch lange Geschichte es hat. Ein Straßensänger hat sich an die Südseite des Campo de’ Fiori gesetzt und konkurriert mit der Musik aus einer nahegelegenen Bar. Der Duft von Espresso und Bratfett vermischt sich mit Zigarettenrauch, und die letzten Sonnenstrahlen des Tages flimmern über den Platz. Für eine kleine Weile lässt das Licht und der Taubendreck auf dem Kopf Giordano Brunos Statue aussehen, als hätte der Mönch einen schimmernden Heiligenschein. Welche Ironie! Für seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde Giordano Bruno vom Papst verbannt und von den Protestanten in Deutschland exkommuniziert. Seine Bücher kamen auf den Index Librorum Prohibitum, die Liste der von der Kirche verbotenen Bücher, und wurden erst 1966 vom Index gestrichen. Die Nachwelt hat – aus gutem Grund – Brunos Richter und Henker verurteilt, die ihn kopfüber am Pfahl festbanden, den Scheiterhaufen anzündeten und ihn verbrannten. Heute sind die meisten seiner Behauptungen allgemein akzeptiert, ja, sie sind Teil unserer gemeinsamen Weltanschauung. Aber in einem Punkt irrte er sich: An diesem milden Juniabend ist es ganz offensichtlich, dass das Universum ein Zentrum hat, und das ist hier, auf dem Campo de’ Fiori.
Kaum habe ich mich gesetzt, wird der Brotkorb auf den Tisch gestellt. Der Kellner Angelo läuft auf dem Weg zur Terrasse an mir vorbei und wirft mit einer fast nicht wahrnehmbaren Handbewegung den Korb in meine Richtung, sodass er mitten auf dem Tisch landet. In vielen Restaurants in Italien muss man für Brot und Gedeck separat zahlen, es heißt pane e coperto und beträgt in der Regel zwei Euro pro Person. Diese Praxis ist verhasst bei den Restaurantgästen, die der Ansicht sind, dass man coperto eigentlich mit »wir haben dich übers Ohr gehauen« übersetzen müsste. In Rom ist es jetzt verboten, Coperto zu verlangen, aber egal, ob man bezahlen muss oder nicht, häufig ist das Brot, das man serviert bekommt, nichtssagend. Manchmal ist es sogar in Plastik verpackt und leblos wie Pappe. Das ist bei dem copertofreien Brot im La Carbonara nicht der Fall. Es ist luftig und fluffig, mit genau dem richtigen Widerstand beim Kauen, mit einer krossen Kruste und einer weichen, etwas zähen Krume. Das Brot wird im Nebenhaus gebacken, bei Forno Campo de’ Fiori, eine der wenigen traditionellen Bäckereien, die die Invasion der großen Industriebäckereien überlebt haben, von denen Italien nun dominiert wird. Meine Wohnung liegt im Häuserblock nebenan und verfügt über einen Balkon zum Platz. Morgens stehe ich manchmal auf dem Balkon und betrachte die Menschen, wenn ich meinem ersten Kaffee trinke. Sieht man sich den Platz von oben an, bemerkt man, wie die Laufrichtung der Menschen sich mit einem Mal ändert, wenn die Bäckerei um halb acht öffnet – wie ein Damm oder ein See, der einen neuen Ablauf bekommt. In der Bäckerei Forno Campo de’ Fioro ist es immer voll. Tagsüber wechselt das Angebot, von Cornetti, Keksen und Pizza alla Romana – ein dünnes, pizzateigartiges Brot mit Mortadella – am Morgen bis hin zu meterlanger Pizza al taglio, sorgfältig hergestellten Arten von süßem Gebäck und mehreren verschiedenen Broten, wenn die Bäckerei am Nachmittag wieder öffnet. Die Kundschaft besteht, wie überall im Centro Storico, aus einer Mischung aus Römern und Touristen. Doch obwohl die Touristen ein bedeutender und vermutlich erwünschter, ja, essentieller Teil der Kundenbasis der Bäckerei sind, wird so getan, als gäbe es sie nicht. Es wird ausschließlich Italienisch gesprochen. Und damit nicht genug: So gut wie alle Kunden, die zum ersten Mal die Bäckerei betreten, haben Probleme mit dem komplizierten System der Bestellung und Bezahlung. Trotzdem gibt es keinerlei Versuche, es zu vereinfachen oder zu erklären. Jedem neuen Kunden, der unsicher ist, wird mit mürrischer Ungeduld begegnet, als wäre er der Erste, dem es schwerfällt zu begreifen, wie man sich zu verhalten hat. Bestellen hier, bezahlen dort, die Ware wird an einer dritten Stelle abgeholt. Das weiß doch jeder! Kein Grund, es zu erklären oder mit einem Schild darauf hinzuweisen. Ich weiß nicht, wie viele Male ich selbst »dieser Idiot« war, der alle anderen aufhält, weil ich vergessen habe, dass man in einer Bar erst bezahlen und dann seinen Espresso entgegennehmen muss, während man in einer Bäckerei erst bestellen und dann bezahlen muss. Erst danach bekommt man die Ware gegen Vorzeigen der Quittung ausgehändigt. Dieser Widerwille, Teil der englischsprachigen, globalisierten Gemeinschaft zu werden, in der sich unkompliziert einkaufen lässt, in der es möglich ist, Kaffee und Milch auch am Abend zu besorgen und in der Geschäfte nicht plötzlich mitten am Tag für ein paar Stunden schließen, ist ein Quell unendlicher Frustration für die in Rom lebenden Ausländer, die ich kenne, ja, tatsächlich auch für viele Italiener. Gleichzeitig gibt diese Haltung der Stadt auch ihre besondere Prägung. Die stolze Aufsässigkeit hat durchaus etwas Attraktives, zumindest, wenn man nicht jeden Tag damit leben muss. Dass es aber auch zu einem Gefühl des Ausgegrenztseins führen kann, spürt man sofort, wenn man mit schamroten Wangen dasteht, weil man als Bäckereikunde einen Ablauffehler gemacht hat und vor der versammelten Kundschaft einen Rüffel bekommt. Sobald man das System jedoch gelernt hat, glaubt man, es meisterhaft zu beherrschen. Wenn ich jetzt mein Cornetto kaufe, sehe ich nachsichtig auf die amerikanische Erstkundin, die alles falsch macht. Ist sie freundlich und hilflos, helfe ich ihr. Ist sie aber arrogant und vorlaut, bleibe ich zusammen mit den anderen Eingeweihten wie ein Römer unter Römern ungerührt in der Schlange stehen. Aus dem gleichen Grund wie an anderen Orten ist Brot in Rom fester Bestandteil einer Mahlzeit: Es ist das universale Lebensmittel unserer Kultur. Vor einigen Jahren arbeitete ich in Simbabwe. Dort ist sadza, eine Art klebrige Maissuppe, das Grundnahrungsmittel, das die Menschen jeden Tag essen, häufig sogar mehrmals am Tag. Nach einer Weile war ich es leid, Tag für Tag sadza zum Mittagessen zu bekommen, daher nahm ich stattdessen ein paar belegte Brote mit. »Was ist eure Hauptspeise in Norwegen?«, fragte einer meiner Kollegen, fasziniert und bestürzt darüber, dass es ein Land gibt, in dem sadza nicht geliebt wird. »Wir haben keine derartige Hauptspeise wie ihr«, antwortete ich und begann aufzuzählen, was in meinem Heimatland alles gegessen wird: Kabeljau, Lachs, Lamm, Kohl, Schweinefleisch sowie Wild wie Elch und Rentier. Eine Menge verschiedener Dinge. Was wir mögen und worauf wir Lust haben, sei auch abhängig von der jeweiligen Saison, erklärte ich. Ein anderer Kollege brach in Gelächter aus. »Du nimmst uns doch auf den Arm! Ihr esst Brot. Zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, zum Mittagessen und zum Abendessen. Ihr seid abhängig vom Brot! Sieh doch nur, was du da vor dir hast, Mann!« Beschämt blickte ich auf mein Butterbrotpaket. Mein ganzes Leben habe ich jeden Tag Brot gegessen. Normalerweise esse ich es tatsächlich mehrmals am Tag, zum Frühstück, zum Mittagessen, und manchmal sogar zwischen den Mahlzeiten. Häufig ist es langweilig, und ich denke oft, ich sollte etwas Interessanteres essen. Aber durch Brot funktioniere ich. So ist es seit vielen hundert Jahren in Norwegen gewesen. Und seit über tausend Jahren hier in Rom. Im Restaurant ist Brot des obligatorische Zubehör, das den größten Hunger stillen soll oder dafür sorgt, dass die letzten Reste der Pasta- oder Bratensauce, die nach dem Fleisch noch übrig ist, aufgetunkt werden können. Am Nebentisch hat eine Frau in einer Gruppe von Freunden gegrillten Wolfsbarsch bestellt, das dezidiert teuerste Gericht des Restaurants. Die übrigen begnügen sich mit einem einfachen Pastagericht. Isst man auswärts, verlangt die Tradition pagare alla romana, also auf römische Art zu bezahlen. Das heißt, alle bezahlen den gleichen Anteil der Rechnung, es wird nicht auseinander gerechnet, wer wieviel gegessen oder getrunken hat. Vermutlich wissen alle, dass sie den exklusiven Geschmack ihrer Freundin mitbezahlen müssen. Einer nach dem anderen taucht ein Stück Brot in die Mischung aus Fischfond, Öl und Zitronensaft, die zu dem Fisch serviert wird. Wenn sie schon bezahlen müssen, wollen sie zumindest probieren. Brot und Korn haben in der Geschichte Roms eine zentrale Rolle gespielt. Das Getreide war nicht nur ein Lebensmittel, sondern die Voraussetzung für die Entwicklung der Stadt, ja, tatsächlich für die Entwicklung des gesamten römischen Reichs. Die Geschichte der Stadt Rom beginnt ihrer Legende nach mit der Ankunft einer kleinen Gruppe von Menschen an der Westküste des Landes, des heutigen Italiens. »Waffen besing ich«, schreibt der Dichter Vergil zu Beginn des römischen Nationalepos Aeneis, »und ihn, der zuerst von Trojas Gestaden durch das Geschick landflüchtig Italien und der Laviner Küsten erreicht, den lange durch Meer’ und Länder umhertrieb Göttergewalt ob des dauernden Grolls der erbitterten Juno. Vieles erduldet’ er auch im Krieg, bis die Stadt er gegründet. Und die Penaten gebracht nach Latium, dem die Latiner, Albas Väter, entstammt und Roms hochtragende Mauern.« Die Geschichte beginnt damit, dass der Königssohn Aeneas und sein Gefolge sich in der Gegend des heutigen Roms ansiedeln. Zu dieser Zeit war das Land noch unerschlossen und unzivilisiert. Es war bewaldet, und die Menschen, die hier lebten, kannten weder Ackerbau noch Viehzucht und stammten von Eichbäumen ab, weiß Vergil zu berichten. Die eigentliche Stadt wurde einige Generationen später gegründet, als zwei Nachkommen von Aeneas, die Zwillingsbrüder Romulus und Remus, auf den Plan traten. Sie hatten eine komplizierte Familiengeschichte und waren das Resultat einer Vergewaltigung ihrer Mutter durch den Kriegsgott Mars. Als Säuglinge wurden sie von einem eifersüchtigen Onkel ausgesetzt, doch von einer Wölfin und einem Specht gerettet. Die Wölfin säugte sie, welche Rolle der Specht spielte, ist mir nicht recht klar, er wird in der Erzählung häufig unterschlagen. Als die beiden Brüder erwachsen waren und die Stadt gründen wollten, kam es zum Streit über deren Lage: Auf dem Palatin, wie Romulus es wollte, oder auf dem Aventin, den Remus bevorzugte. Der Streit endete damit, dass Romulus seinen Bruder tötete und der neuen Stadt seinen eigenen Namen gab – in aller Bescheidenheit. Romulus soll die Stadt am Feiertag des Hirtengottes Pales am 21. April 753 vor unserer Zeitrechnung gegründet haben. Auch noch lange, nachdem der Mythos nicht mehr so wörtlich genommen wurde, war es üblich, diesen Zeitpunkt zugrunde zu legen, wenn das Alter der Stadt benannt werden sollte. Noch immer sind die beiden von einer Wölfin gesäugten Kleinkinder das Symbol der Stadt. Das Motiv ist überall zu finden. An der Wand vor dem La Carbonara hängen die Reste eines Plakats des Fußballclubs AS Roma – das Logo des Clubs ist die Wolfsmutter mit den beiden Säuglingen. Die Römer sind also nicht wie die meisten ihrer Nachbarvölker Nachkommen der einfachen Urbevölkerung oder der Eichbäume. Sie stammen von Aeneas Geschlecht aus Troja ab und haben Götterblut in den Adern. Und die Stadt wurde mit einem Brudermord begründet. Was wir über die früheste Geschichte der Stadt wissen, basiert auf Mythen, von denen die meisten Ereignisse vermutlich niemals stattgefunden haben. Mangels anderer Quellen stützt man sich dennoch auf diese Märchen, vielleicht in der Hoffnung, sie könnten Ausdruck einer tieferen Wahrheit sein. Auch wenn es sich vielleicht nicht genau so und mit exakt diesen Akteurern abgespielt hat, wäre doch möglicherweise etwas Ähnliches denkbar gewesen. Der römische Historiker Titus Livius, der ungefähr zu Beginn unserer Zeitrechnung lebte, räumt ein, dass dieser Teil der offiziellen Stadtgeschichte eher charmant und poetisch als wahr ist, dennoch argumentiert er dafür, ihn zu verwenden: »Es ist das Privileg der Vergangenheit, das Göttliche und das Menschliche zu vermengen, es trägt zur Würde der Vergangenheit bei. Und wenn etwas einen göttlichen Ursprung verdient, dann ist es unsere Nation.« Was zu Beginn vermutlich eine ziemlich schäbige Ansammlung von Kriegern war, die sich auf die armen Hirten in einer kleinen Ansiedlung auf und um den Palatin stürzten, wuchs nach und nach zu einem bedeutenden Stadtstaat und einer regionalen Macht heran. Rom war ein brutaler und militaristischer Staat, der mit seinem aggressiven Vorgehen ausgesprochen erfolgreich war. Zwischen den Jahren 300 und 200 vor unserer Zeitrechnung hatte Rom die gesamte italienische Halbinsel erobert und unterworfen. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Expansion mit einer enormen Geschwindigkeit in den sogenannten Provinzen fortgesetzt, zu denen die Inseln Korsika, Sardinien, Sizilien und die Balearen, die iberische Halbinsel, das Gebiet des heutigen Frankreichs und Belgiens, der südliche Teil der britischen Inseln, Teile Germaniens, der Balkan, Griechenland, einige Gebiete Kleinasiens sowie die Mittelmeerküste Afrikas gehörten. Rom wurde nicht in einem Tag erbaut, das bestätigen die Mythen als auch die eher auf Tatsachen beruhende jüngere Geschichte. Das gierige Imperium wurde ständig größer, Haus um Haus, Mensch um Mensch, Stadt um Stadt, Provinz um Provinz, Land um Land – bis das römische Reich am Ende fünfzig Millionen Einwohner umfasste. Bereits im Jahr 100 vor Christi Geburt war Rom eine Millionenstadt. Vergil besingt Waffen und einen Mann, und so funktionieren die meisten Geschichten über das römische Reich. Es gibt Generäle, Staatsmänner, verrückte Kaiser, die eine oder andere Frau – häufig Verführerinnen –, Philosophen und Verräter. Es gibt Intrigen, Invasionen, Schlachten und Berichte über ein Imperium, das so groß wurde, dass schließlich die gesamte damals bekannte Welt dazugehörte. Aber wovon lebten all diese Menschen? Was aßen sie? Eine Information darüber fehlt in so gut wie allen klassischen Erzählungen über Rom und in den meisten touristischen Darstellungen, viele moderne Historiker sind jedoch der Ansicht, dass es eine wesentliche Voraussetzung für die gewaltige Expansion Roms gab: das absolut einzigartige Versorgungssystem des Imperiums. Rom wurde nicht von Königen, Senatoren, Konsuln oder Generälen gebaut. Die Stadt wurde, wie Evan Fraser und Andrew Rimas in ihrem Buch Empires of Food schreiben, mit Weizen erbaut. Das bedeutet nicht, dass es nur um Weizen ging, aber Weizen war der Treibstoff für die gesellschaftliche Maschinerie, Weizen war eines der wichtigsten Elemente, die dazu führten, dass die Stadt diese Entwicklung nehmen konnte. Roms geographische Lage ist eigenartig. Warum entstand das mächtige römische Reich genau hier, dreißig Kilometer vom Meer entfernt, inmitten eines Gebiets, das von Natur aus nicht das reichste oder fruchtbarste ist? Am Anfang, als die Stadt lediglich eine von vielen mittelmäßig erfolgreichen Orten war, wurde Rom durch seine Lage benachteiligt. Die Römer mochten vornehmer gewesen sein als ihre Nachbarn – ihr Stammbaum weist ja immerhin trojanische Könige und Götter auf –, aber ihre natürlichen Ressourcen waren eher erbärmlich. Jeder, der einmal durch Italien gereist ist, hat die Fruchtbarkeit in vielen anderen Teilen des Landes gesehen: die Üppigkeit der Po-Ebene, die enormen Felder in Süditalien und auf Sizilien, die fruchtbare Toskana und das schillernd grüne Umbrien. Diese Gegenden konnten große Volksmengen ernähren. Rom hingegen hatte nur begrenzte Ackerbaumöglichkeiten und eine Bevölkerungszahl, die rasch und unaufhörlich wuchs. Um die ständig größer werdende Zahl der Einwohner zu ernähren, wurde Rom schon früh abhängig vom Getreideimport. Daher wurde ein avanciertes Handelssystem entwickelt. Der Staatsmann und Philosoph Marcus Tullius Cicero vertrat die Ansicht, gerade die Lage der Stadt und ihre Abhängigkeit vom Handel hätten die Grundlage für ihren späteren Erfolg geschaffen: »Ein Fluss ermöglicht es der Stadt, das Meer zu nutzen, um zu importieren, was ihr fehlt, und zu verkaufen, was sie produziert und im Überfluss besitzt; und über den Fluss kann man vom Meer und vom Land aus auf dem Wasser transportieren, was die Stadt für ihr Leben und ihre Zivilisation benötigt. Daher ist es für mich offensichtlich, dass Romulus zu Beginn eine göttliche Eingebung gehabt haben muss, die ihm sagte, dass die Stadt eines Tages der Sitz und das Herz eines mächtigen Imperium sein würde.« Ständig war Rom in den einen oder anderen Krieg mit seinen Nachbarn verwickelt; Kriege und Konflikte waren der Normalzustand der damaligen Zeit. Zuvor hatte jedoch die Regel gegolten, dass man das Schlachtfeld und die Besiegten verließ, nachdem man ihnen ein gebotenes Maß an Demütigungen zugefügt und sich eine angemessene Beute verschafft hatte. In einigen besonderen Fällen, zum Beispiel, als Rom Karthago nach mehr als einhundert Jahren Krieg endlich besiegte, nahm man alles, was man bekam, machte die Stadt dem Erdboden gleich und streute auf den Feldern Salz – pure Auslöschung und Vernichtung des Gegners. Das war allerdings die Ausnahme. Im Großen und Ganzen begnügte man sich normalerweise damit, den Feind zu besiegen und zu schwächen, um selbst reicher und stärker nach Hause zurückzukehren. Rom allerdings unterschied sich von früheren Großmächten, in denen die Sieger mit ihrer Beute heimkehrten, dadurch, dass die Römer die unterworfenen Gebiete nicht wieder verließen, sondern blieben. Ehemalige Gegner wurden in das ständig größer werdende Staatsgebilde eingegliedert, und nachdem sie sich angepasst hatten, bekamen sie nach und nach auch mehr Rechte. Roms Einfluss konnte brutal sein, aber es war durchaus möglich, darin auch Vorteilhaftes zu sehen. Wie im Monty Python-Klassiker Das Leben des Brian, in dem Reg, der Leiter des Widerstands, rhetorisch fragt: »Was haben die Römer für uns getan?«, und seine Genossen die Frage ernst nehmen und alles aufzählen – vom Aquädukt und besserer Medizin bis hin zu den sanitären Verhältnissen, dem Rechtssystem, der Ausbildung, besserem Wein und Frieden. Mit der allmählichen Entstehung des römischen Reichs entwickelte sich ein effektives bürokratisches System, das sich immer tiefer in die Provinzen ausdehnte, mit Verwaltungsbereichen und Posten, die nicht länger von einzelnen Personen abhingen, sondern bei denen jeder austauschbar war. Hatte man zuvor nach dem Allianzprinzip regiert – die Besiegten wurden Bündnispartner, und so lange sie sich loyal verhielten, konnten sie im Großen und Ganzen machen, was sie wollten –, setzte der neue römische Staat auf Assimilation. Die Eliten der besiegten Provinzen fingen an, Lateinisch zu sprechen und zu schreiben, sie nahmen römische Werte und Angewohnheiten an, wohnten in römischen Häusern, gingen ins römische Bad und bekamen das römische Bürgerrecht. Die Römer besaßen die Fähigkeit, ein immer größer werdendes Reich zu regieren. Und sie hatten einen Grund, in den eroberten Gebieten zu bleiben: Das Reich war in hohem Maße gezwungen, Steuern zu erheben in Form von Getreide, Olivenöl, Metall oder was die eroberten Gebiete sonst noch zu bieten hatten. Waren die Umstände günstig, wurden neue Gebiete erschlossen, sodass noch mehr Steuern erhoben werden konnten. In vielerlei Hinsicht war dies die eigentliche Dynamik des ständig wachsenden Imperiums. Das Getreide sorgte für die Lebensmittelrationen des Heeres, das für die Ruhe in den Provinzen verantwortlich war und neue Gebiete erobern sollte. Dies ermöglichte weitere Expansionen, die wiederum zu noch mehr Einnahmen in Form von Korn führten. Das größte Reich, das die Welt je gesehen hatte, wuchs wie ein Sauerteig, der immer größer und gieriger aufquillt, je mehr er gefüttert wird. Genau wie der heutige Kapitalismus abhängig vom wirtschaftlichen Wachstum ist – einem positiven Rückkopplungseffekt, bei dem Geld Geld erzeugt und Wachstum in dem einen Sektor zu Wachstum in einem anderen Sektor führt –, war das römische Reich abhängig von immer mehr Getreide. Der Schriftsteller und Journalist H. E. Jacob schreibt: »Mehl war der Zement des Lebens, das, was die Nation zusammenhielt.« Das römische System hatte reichlich Gold und Silber, denn Plünderungen und Steuererhebungen waren an der Tagesordnung – und man war wahrlich nicht wählerisch. Aber das Wachstum wurde vor allem durch Getreide ermöglicht. Hatten die Römer ein Gebiet ohne besondere Getreideproduktion erobert, begannen sie im großen Stil mit der Urbarmachung des Landes: Die Böden wurden schlichtweg in Kornfelder verwandelt. Als sie nach England kamen, trafen sie auf Gebüsch, Wald und kleine Höfe, doch damit war es schnell vorbei. Die Römer legten die Sümpfe trocken und vervielfachten die Produktion von Getreide. Lange war England die wichtigste Kornquelle im nördlichen Teil des Imperiums. Schottland, wo die Möglichkeiten, Getreide anzubauen, deutlich geringer waren, ließen sie in Ruhe. Der Transport von Getreide über große Entfernungen übers Meer erforderte eine fantastische Logistik – Tausende von Schiffen, die sich ständig durch die Wellen kämpften, sowohl von Norden als auch von Süden her. Es erscheint umständlich – bis man über die Alternativen nachdenkt. Während ein Schiff zehn Tonnen Getreide transportieren konnte, in einigen Fällen sogar mehrere hundert Tonnen, konnte ein Ochse nicht mehr als zweihundert Kilo über eine größere Distanz ziehen. An einem Tag legte er bestenfalls zwanzig Kilometer zurück, und bei diesen Entfernungen benötigte ein Ochse fünf Kilo Getreide am Tag als Futter, man kam also nicht sehr weit, bis große Teile der Ladung bereits aufgefressen waren. Die Römer hatten ein nahezu perfektes System, solange es funktionierte: Umfangreich, sicher und stabil, mit einem Heer, das die meiste Zeit gut ernährt und zufrieden war, und einer Hauptstadt, in der die armen Massen sich im Großen und Ganzen ruhig verhielten, solange sie genug zu essen hatten. Doch die Nahrungsmittelbeschaffung war immer der Punkt der größten Verletzbarkeit der Stadt. Dies zeigte sich im Jahr 68 vor unserer Zeit, als ein Angriff auf die Hafenstadt Ostia das römische Reich in eine Krise stürzte. Große Teile der römischen Flotte wurden von Seeräubern versenkt, die – denkt man darüber nach – im Grunde genommen nicht mehr Seeräuber waren als die Römer selbst, wenn sie ein Land eroberten. Ostia wurde geplündert, und was sich nicht stehlen ließ, wurde in Brand gesteckt. Darunter die Getreidelager. Die Nahrung von Hunderttausenden von Römern wurde in riesigen Hallen in der Nähe des Hafens gelagert, die nun in Flammen standen. Innerhalb weniger Tage vervielfachte sich der Preis für Getreide. Die Versorgungslinien von außen waren unterbrochen, die Flotte versenkt. Das starke und mächtige Rom war mit einem Mal hilflos. »Panik brach in der Stadt aus, als die Bevölkerung erkannte, dass sie, gefangen in einem urbanen Umfeld aus Backsteinen und Marmor, hungern könnten«, schreiben Fraser und Rimas. Der britische Schriftsteller und Journalist Robert Harris vergleicht die Plünderung Ostias mit dem 11. September 2001: »Die Täter hinter dem spektakulären Angriff waren keine Repräsentanten einer fremden Macht: Kein Staat hätte es gewagt, Rom auf eine so provozierende Weise anzugreifen.« Die Seeräuber waren Banditen, locker organisierte Terroristen, die in der Lage waren, über ihre eigentliche Stärke hinaus weit größeren Schrecken zu verbreiten. Wer sie waren, ist bis heute ungeklärt. Einzelne Historiker behaupten, der Angriff sei an sich nicht besonders ungewöhnlich oder dramatisch gewesen, sondern wurde als Vorwand für die Maßnahmen genutzt, die sich daran anschlossen. Der Angriff auf Ostia führte auf jeden Fall zu erheblichen internen Konsequenzen. Wie nach dem 11. September wurden die Vollmachten von Polizei, Militär und Geheimdiensten in einem Umfang erweitert, der die Grenzen des modernen Rechtsstaates und das Prinzip der Gewaltenteilung herausforderte. Der Angriff auf Ostia führte zu einer Machtkonzentration, die die Grundlage für den Fall der römischen Republik und für das sich anschließende Kaiserreich legte. Bis zu den Plünderungen der Seeräuber war die römische Republik von einem komplizierten Prinzip der Gewaltenteilung regiert worden, das die Entwicklung zu einer permanenten Diktatur oder einer Wiedereinführung des Königtums verhindern sollte. In Krisenzeiten wurde gewöhnlich ein Führer mit erweiterten Vollmachten ernannt. Diese Position, die tatsächlich dictator genannt wurde, war zeitlich begrenzt, und der Betreffende hatte nur die Befugnis, innerhalb des ihm zugewiesenen Zuständigkeitsbereichs für Ordnung zu sorgen. Es gehörte für einen ehrgeizigen Politikern zu den schlimmsten Vorwürfen, König werden zu wollen. Obwohl die Prinzipien der Gewaltenteilung häufig gebrochen wurden, waren sie bis dahin stabil genug gewesen, um zu verhindern, dass die gesamte Macht sich auf eine Person oder eine Familie konzentrierte. Es wurden immer zwei regierende Konsuln ernannt, häufig aus rivalisierenden Gruppen, um sich gegenseitig zu kontrollieren. Auch Militärkommandos gab es in bestimmten Phasen, aber mit einem deutlich begrenzten Mandat. Allerdings hatte dieses System nicht unbedingt optimal funktioniert und war mehrfach nahezu zusammengebrochen. Nach dem Piratenangriff auf Ostia wurde es abgeschafft – endgültig, wie sich herausstellen sollte. Dem populären General Pompeius gelang es mit Hilfe verschiedener Strohmänner, ein Notstandsgesetz durchzusetzen: Lex Gabinia de piratis persequendis – Das Gesetz des Gabinius über die Verfolgung (und Bestrafung) der Piraten. Das Gesetz verlieh Pompeius nahezu unbegrenzte Macht und damit auch ein passendes Budget. Es dauerte nicht lange, bis Pompeius die Piraten in der östlichen Ecke des Mittelmeers, der heutigen Türkei, stellte. Nach einer kurzen Belagerung besiegte er sie und »löschte sie aus«. Bei seiner Heimkehr wurde er mit allen Ehrenbezeugungen des römischen Reichs gefeiert. Die Ordnung war scheinbar wiederhergestellt. Obwohl dies ganz und gar nicht der Fall war, sie war eher auf den Kopf gestellt. In den Jahren danach regierte Pompeius mit seinen beiden Partnern, Marcus Licinus Crassus und Julius Caesar. Hatte zuvor der Senat die oberste Macht und Autorität gehabt, wurde das Reich nun von einem Triumvirat regiert, das aus drei Generälen bestand. Der Staat hatte nicht länger die Kontrolle über das Heer, stattdessen verfügte das Heer jetzt über den Staat. Pompeius war der Mächtigste der drei Herren, und als die Reibereien, die es immer gegeben hatten, in offene Feindschaft umschlugen, sah es lange so aus, als würde Pompeius den Sieg davontragen. Bekanntlich wollte es die Geschichte anders. Crassus wurde bei einem missglückten Versuch, neue Landgebiete für das Reich zu erobern, im Kampf gegen die Parther getötet. Sein Kopf wurde als Requisite bei Theatervorstellungen der Parther verwendet. Pompeius wurde von einem Attentäter in Ägypten getötet, auch ihm wurde der Kopf abgeschlagen. Caesar, der Einzige, dessen Kopf noch auf den Schultern saß, erntete die Früchte dieses schleichenden Staatsputsches. Danach war die Alleinherrschaft – die ewig währende Tyrannei – eine Tatsache. Die Furcht vor einer Bedrohung der Nahrungsmittelversorgung und einem möglichen Aufstand der armen Massen führte dazu, dass die herrschende Elite das Gleichgewicht der Republik gegen die Sicherheit der Diktatur eintauschte. Sie glaubten, dies würde nur für eine Interimszeit gelten, doch es stellte sich heraus, dass es das Ende der Republik werden sollte. Und im Übrigen auch Caesars Ende. Im Jahr 44 vor Christus – also nach weniger als fünf Jahren mit der vollen Machtfülle – wurde Julius Caesar ermordet. Während einer Sitzung des Senats im Pompeius-Theater wurde der Diktator vor der Statue seines ehemaligen Verbündeten erstochen. Das Restaurant Da Pancranzio, das an der Verlängerung des Campo de’ Fiori liegt, wirbt damit, man könne dort ein Gericht namens »Caesars Tod« essen. Getreide war ein ganz wesentlicher Faktor, denn abgesehen von seinem Wert als Handelsware trugen die Rationen für das Heer dazu bei, dass die Soldaten für Ruhe sorgten, sowohl in den Provinzen als auch in der Hauptstadt. Eine Million Menschen in einer Stadt mit extremen Unterschieden zwischen Armen und Reichen – und die Mehrzahl der Bevölkerung war arm – war ein potenziell explosives Gemisch. Die Herrscher der Stadt lebten in der ewigen Furcht vor Aufständen und Unruhen, die Überschüsse an Getreide aus den Provinzen errichteten jedoch eine Brandmauer: Dadurch ergab sich die Möglichkeit, Kornrationen an die armen Massen umsonst oder zu stark subventionierten Preisen zu verteilen. Vom Jahr 123 vor Christus bis zum Fall des Reichs gab es Getreiderationen für alle Einwohner der Stadt. »Brot und Spiele« waren entscheidend für die Zufriedenheit der unteren Klasse, am wichtigsten aber war das Brot. Die Nahrungsmittelversorgung blieb die Achillessehne des Reichs. In einem Artikel mit dem sprechenden Titel »A starving mob has no respect« schreibt der Historiker Paul Erdkamp über fünfhundert Jahre mit Hungeraufständen in der römischen Welt. Die Kaiser Tiberius und Claudius erlebten beide Angriffe der Volksmassen in Zeiten von Nahrungsmittelmangel. Zeitweise genügten sogar Gerüchte über fehlende Lebensmittel, um Unruhe zu erzeugen. Kaiser Commodus’ Heerführer und Stellvertreter Cleander galt im Jahr 190 als der Schuldige für erhöhte Lebensmittelpreise, und die rasende Volksmenge war erst zufrieden, als sein abgeschlagener Kopf öffentlich zur Schau gestellt wurde. Um die Nahrungsmittelversorgung zu gewährleisten, wurde der Handel mit Getreide dem prefectus annonae übertragen, einem mächtigen staatlichen Organ, das als eine Mischung aus einem Ministerium für Nahrungsmittel und Innere Sicherheit operierte. Es wurde ein System von mehr als dreihundert verschiedenen Lebensmittellagern eingerichtet, um sich gegen Krisensituationen oder Angriffe auf einzelne Anlagen wie in Ostia abzusichern. Die Bäckereien wurden ebenfalls kontrolliert, denn auch wenn es keinen Mangel an Nahrungsmitteln gab, war die Gefahr von Unruhen permanent vorhanden, da die Bäcker im Verdacht standen zu betrügen, indem sie die Preise erhöhten oder Brot rationierten. Sie hatten eine sichere Einnahmequelle, gleichzeitig aber waren auch sie aufgebracht, weil ihnen die Möglichkeit für märchenhafte Profite verwehrt wurde. »Alexander der Große war nach Ägypten aufgebrochen, um sich selbst zum ›Sohn der Sonne‹ auszurufen«, schreibt H. E. Jacob in Six Thousand Years of Bread. »Caesar und Marcus Antonius hatten allerdings nicht das Bedürfnis nach dieser Ehre, als sie auf dem Nil segelten. Ihnen ging es um nichts anderes als Getreide.« Ägypten war die wichtigste Kornkammer des gesamten Reichs und so entscheidend für Wohlstand und Stabilität, dass es keine gewöhnliche Provinz war. Ägypten unterstand dem Kaiser direkt – es war praktisch sein persönliches Eigentum. Er konnte nicht riskieren, dass ein eigensinniger General oder Gouverneur Ägyptens Getreide nutzte, um in Rom die Oberhand zu gewinnen. Stattdessen nutzte der Kaiser das Korn, um seine Popularität bei den Massen zu steigern. »So wurde ein einträgliches Verhältnis zwischen dem Milliarden schweren Kaiser, den größten Landbesitzern im Imperium und den Arbeitslosen und Armen in Rom geschaffen«, schreibt Jacob. »Ägypten war der Zauberstab, der den Kaiser mit dem Proletariat verband, und das Proletariat mit dem Kaiser. Der eine gab Brot, die anderen ihre arbeitenden Hände.« Ich trinke ein Glas Wein und entspanne mich, während ich das Treiben der Menschen auf dem Platz beobachte. Aus meiner Zeit als Restaurantkritiker habe ich die Angewohnheit beibehalten, einige Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt einzutreffen, statt einige Minuten später, wie es bei den meisten Gästen üblich ist. Beginnt ein Abendessen um acht Uhr, bin ich um fünf vor acht da. Damit entgehe ich dem Gedränge bei der Ankunft, und es ist möglich, sich lächelnd um einen anderen Tisch zu bemühen, sollte man mich weit entfernt vom Zentrum des Geschehens oder an dem kleinen, wenig attraktiven Tisch direkt neben der Toilette platziert haben. Nicht zuletzt ist es möglich, schon mal einen Schluck zu trinken und etwas Brot zu essen, um nicht ganz ausgehungert zu sein. Als ich ankam, war das La Carbonara allenfalls halbvoll. Nun sind hier im Erdgeschoss beinahe sämtliche Stühle besetzt. Die meisten Plätze gibt es allerdings in der ersten Etage. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei es ein Restaurant für etwas über zwanzig Gäste, obwohl man vier- oder sogar fünfmal so viele Menschen bewirten kann. Ein ständiger Strom von Gästen steigt die Treppe hinauf. Neuankömmlingen ohne Reservierung wird erklärt, es gäbe keinen Platz mehr. Sie zeigen auf die wenigen, noch freien Tische, doch ihnen wird beschieden, dass die Tische bereits reserviert sind. Die Kellner laufen mit Speise- und Weinkarten, Wasser und Wein hin und her. Mir haben diese delikaten Minuten immer gefallen, in denen ein Restaurant an seine Kapazitätsgrenzen gerät, wenn allzu viele Gäste gleichzeitig hereinströmen, hungrig und voller Erwartungen. Diejenigen, die bereits eine Weile hier sitzen, sollen ihr Hauptgericht bekommen, die frisch Angekommenen ihre erste Bestellung abgeben, und gleichzeitig kommt weitere Kundschaft. Das ist der große Restauranttest: Gelingt es, das Tempo anzuziehen, doppelt so hart zu arbeiten und schneller zu laufen, ohne die Gäste zu stressen und gleichzeitig mit den Speisen unbeschadet durch die Menge der Besucher zu bugsieren? Viel wurde über den Untergang des römischen Reiches geschrieben, der ungefähr fünfhundert Jahre nach Caesars Tod begann. Wie konnte ein so großes und mächtiges Reich sich einfach auflösen? Normalerweise wird auf die Bedrohung durch äußere Feinde verwiesen, auf Hunnen, Germanen und andere barbarische Volksstämme. Sie wussten sich tüchtiger zu organisieren und hatten sich geschickte Tricks der Kriegsführung angeeignet, unter anderem, indem sie als römische Söldner gedient hatten. Es gibt auch die Theorie, Roms Herrscher seien durch das Blei, das für die Rohre der fortschrittlichen Wasserversorgung benutzt wurde, schwach und geisteskrank geworden. Bei einer anderen, recht verbreiteten Erklärung geht es um die Weltfremdheit und Dekadenz der römischen Elite. Die Dekadenz des römischen Reichs ist durchaus bekannt, mit einer extravaganten Sexualmoral, Inzucht und einem Konsum, bei dem es schwerfällt, ihn nicht als ein Zeichen der Endzeit zu sehen. Der oströmische Historiker Prokopios aus dem 6. Jahrhundert erzählt eine Geschichte, die sicher nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber dennoch sehr bezeichnend ist. Es geht um die Reaktion des Kaisers Honorius, als er vom Fall Roms hörte, nachdem es um das Jahr 410 geplündert und gedemütigt worden war: »Entsetzt rief der Kaiser: ›Der hat mir doch gerade noch aus der Hand gefressen!‹ Denn er hatte einen sehr großen und stattlichen Hahn mit dem Namen Rom. Der Eunuche [der die Nachricht überbracht hatte] erklärte, es handele sich um die Stadt Rom, die durch Alarichs Hände gefallen sei, worauf der Kaiser mit einem Seufzer der Erleichterung antwortete: ›Oh, und ich dachte, mein Vogel Rom sei umgekommen.‹ So groß, heißt es, war die Dummheit des Kaisers.« Die Kritik an der Art und Weise, wie Rom regiert wurde, ist durchaus korrekt. Nach unseren Standards, ja, man kann sagen, nach den allermeisten Standards war sie ineffektiv und dumm, mit einem extremen Schwergewicht auf dem Konsum von Luxusgütern zu Lasten von – eigentlich allem. Gleichzeitig ist diese Erklärung aber eine eher moralische Verurteilung – als sei es richtig, dass die Römer für ihre Ausschweifungen und ihre Verschwendungssucht bestraft wurden. In Wahrheit aber war der Fall des römischen Reiches wahrscheinlich das Resultat von »tausend Nadelstichen«. Oder, wie Fraser und Rimas behaupten, von tausend Nadelstichen und einem Dolchstoß. Die Barbaren, die das Reich überfielen, waren gefährlich, aber nicht gefährlicher als früher. Das Imperium hatte mehr oder weniger ständig Krieg gegen äußere Feinde geführt, und im Großen und Ganzen hatte man immer einen Weg gefunden, sie zu schlagen, zu bestechen oder abzuschrecken. Sicherlich war die Exzentrik der Elite zeitweise schockierend, aber letztendlich kann man wahrscheinlich nicht behaupten, dass Honorius’ Weltfremdheit schlimmer war als die Caligulas, der vierhundert Jahre zuvor sein Pferd zum Senator ernannt hatte. Die römische Oberklasse war überdies lange überdurchschnittlich besessen von Inzest und der Zubereitung exotischer Speisen von ungewissem kulinarischem und ernährungspraktischem Wert. Die Dekadenz der Elite machte es nicht einfacher, das Reich zu verteidigen, doch obwohl es in der Hauptstadt viele weltfremde Luxusgeschöpfe gab, sah es im Heer anders aus. Fraser und Rimas behaupten, die Steuererhebungen in Form von Getreide hätten zur Schwächung des gesamten römischen Systems geführt, denn der Boden in den Provinzen war mittelfristig erschöpft und brachte keine Erträge mehr. »Unter dem Imperium wurden die bestellten Felder erdrosselt. Sie wurden zu gierig bebaut, der Verlust von Nährstoffen im Boden ließ sie karg und unfruchtbar werden.« Obwohl die Autoren betonen, dass es keine monokausale Erklärung gibt, verweisen sie auf den Zusammenhang zwischen dem Wachstum und dem Fall des Imperiums und dem, was sie das Wachstum und den Fall des »Nahrungsmittelimperiums« nennen. An vielen Orten wuchs auf den Feldern einfach nichts mehr. Der Boden war in einer Weise ausgebeutet worden, dass die Ernten immer geringer ausfielen. Die Steuern wurden für diejenigen erhöht, die sie bezahlen konnten, und dies führte dazu, dass die Auszehrung des Bodens in den verbliebenen Ackerbaugebieten noch schlimmer wurde, bis das System schließlich kollabierte. Große Teile der einstigen Kornkammern Roms – die Provinzen in Nordafrika – sind heute Wüstengebiete. Der Weizen, der zu Roms Größe beigetragen hatte, sorgte auch für dessen Fall, so Fraser und Rimas. Bei weitem nicht alle Historiker sind einverstanden mit dieser Darstellung des Einbruchs von Bodenqualität und Ernten. Doch sieht man sich die übrigen Einflüsse an, die zum Fall des römischen Reiches beigetragen haben könnten, so hatten auch diese Faktoren letztendlich Konsequenzen für das Nahrungsmittelsystem. Klimaveränderungen – ja, auch die damalige Zeit hatte darunter zu leiden – bewirkten, dass einzelne der eher abseits gelegenen Gebiete nicht länger sonderlich viele Lebensmittel produzierten. Nicht zuletzt die Teilung des römischen Reiches in ein Ost- und ein Westreich führte dazu, dass Rom nicht länger Zugang zur ägyptischen Kornkammer hatte. Anstelle des geschwächten Roms übernahm Konstantinopel den Platz als Zentrum der Alten Welt. Brot ist ein Lebensmittel. Brot ist Macht. Aber es ist auch ein Symbol. »Der Bauer sät das Korn in die Erde wie ein Begräbnis eines seiner Toten, und dann wird es wiedergeboren als eine Pflanze, die selbst Korn in sich trägt«, schreibt die Autorin Maguelonne Toussaint-Samat. Vor einigen Abenden besuchte ich Sant’Andrea della Valle. Die Kirche liegt nordöstlich des Campo de’ Fiori an einem Ort, an dem eine Frau im 12. Jahrhundert den Körper des Heiligen Sebastian aus einem Abwasserkanal zog, in den er nach seinem Tod geworfen worden war. Diese Kirche ist aus einem mir unverständlichen Grund aber nicht Sebastian geweiht, sondern den beiden Andreassen: Sankt Andreas, dem ersten Jünger Jesu’ und Schutzheiligen der Seiler, der Schlachter und der schwangeren Frauen. Außerdem schützt er vor rauem Hals. Und Sankt Andreas von Avellina, dem Schutzheiligen von Sizilien, der vor Gehirnschlag bewahren soll. Von der Straße aus sieht die Kirche nicht sonderlich interessant aus: grauer Marmor zwischen anderem grauen Marmor. Aber innen wurde sie mit all dem Geld, mit dem man im 17. Jahrhundert Kunst und Prunk kaufen konnte, prachtvoll ausgestattet, unter anderem mit einem Relief von Jesus auf dem Weg zum Limbus. Ein deprimierendes Motiv ohne besondere Verankerung in der Bibel, außerdem gibt es ein ebenso unheimliches Gemälde von Sebastians Leiche, die aus dem Abwasserkanal gezogen wird. Ich stand allein in der Kirche und fragte mich, ob ich Anzeichen für einen rauen Hals oder eines Gehirnschlags verspürte, als ich eine Abendmahloblate entdeckte, die auf einem kleinen Absatz neben der Krypta von Sankt Fortunatus lag. Mich hat die Idee des Abendmahls schon immer fasziniert – vor allem die katholische, beinahe kannibalische Interpretation, dass das Brot nicht nur den Leib Jesu symbolisiert, sondern tatsächlich dazu wird. Als Nicht-Christ mit einem gewissen grundsätzlichen Respekt vor dem Glauben anderer Menschen habe ich allerdings das Abendmahl nie empfangen wollen, nur um das Brot zu probieren. Nun aber lag die Oblate dort, direkt vor mir. Ich hatte die Möglichkeit, sie zu probieren, ohne mich mit einem Priester oder einer Gemeinde auseinandersetzen zu müssen. Zu allem Überfluss merkte ich, dass ich durchaus ein wenig Hunger hatte. Es steht nirgendwo, wofür Sankt Fortunatus der Schutzheilige ist, aber ich habe das Gefühl, er ist für Handlungen zuständig, die sich nicht gehören – und für Zwischenmahlzeiten. Die Oblate klebte an meiner Zunge, als ich sie – versuchsweise diskret – in den Mund steckte. Es stellte sich heraus, dass das Brot gar kein Brot ist. Im ersten Moment hatte ich das Gefühl, als handele es sich um einen trockenen Keks, doch dann wurde er schlapp und glitschig und löste sich vollkommen auf. In einem Restaurant hätte ich es zurückgehen lassen. Ich wunderte mich. Wenn man schon in der Kirche Brot essen soll, muss es dann so langweilig sein? Die kurze Antwort lautet leider ja, jedenfalls wenn man Katholik oder Protestant ist. Die meisten Gemeinden haben angefangen, industriegefertigte Oblaten zu verwenden, und einige Kirchengemeinden sind sogar noch weiter gegangen. Die norwegische Kirche ist nach einer Empfehlung des Kirchentags 2011 zu glutenfreien Oblaten übergegangen. Diese Oblaten sind aus Maisstärke gemacht – bei der man den Geschmack von Mais entfernt hat –, die aus Rücksicht auf Gluten-Allergiker keine Spuren von Weizen oder anderem Getreide enthält. Es handelt sich mit anderen Worten nicht mehr um Brot, sondern lediglich um ein Symbol für Brot. Die Änderungen wurden vollzogen, ohne dass jemand protestiert hat. Offenbar stört es niemanden. So war es nicht immer. Früher war Brot ein zentrales Thema, gleichbedeutend mit anderen wesentlichen Fragen. Theologen waren nicht nur uneins über die Bedeutung des Brotes, sondern auch über das eigentliche Rezept für den Leib Jesu. Im 11. Jahrhundert hatten sich zwei ausgesprochen unterschiedliche Backtraditionen entwickelt. Im Osten bevorzugten sie etwas, das Stewart Lee Allen in seinem Buch In The Devil’s Garden »eine gut aufgegangene, konsistente Ausgabe von Gottes Sohn« nennt, mit anderen Worten ungefähr so wie ein gutes Sauerteigbrot. Die römisch-westliche Seite zog einen trockenen Keks vor, der nicht mit Hefe versetzt war, ein Vorgänger der maschinengefertigten Oblate. Beide Parteien meinten, die andere Seite habe etwas missverstanden und reiche zum Abendmahl das falsche Brot. Man sollte meinen, es wäre leicht, einen Kompromiss zu finden. Entweder hätte man ein gemeinsames Rezept erarbeiten oder akzeptieren können, dass das Brot an den verschiedenen Orten ein wenig unterschiedlich war. Aber eine derartige Jeder-nach-seinem-Geschmack-Logik funktioniert nicht, wenn es sich um den Erlöser in Brotform handelt. Außerdem war es um die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Kirche des 11. Jahrhunderts schlecht bestellt. Die besten Theologen versuchten, eine Lösung zu finden, doch statt die Unstimmigkeiten zu verringern, spitzte sich der Konflikt mit immer neuen Definitionen und Erklärungen zu. Die römische Kirche verstand sich als dem östlichen Teil übergeordnet, schließlich war der Papst ja trotz allem ein direkter Nachkomme des Heiligen Petrus. Die Ostkirche ihrerseits sah sich als das wahre Zentrum der christlichen Welt, zumal Konstantinopel sich als Zentrum der Macht begriff. Sie blickte auf Rom herab, das nach sechshundert Jahren Zerfall eine Provinzstadt mit zweifelhaftem Ruf und einer Geschichte geworden war, die nicht unbedingt nur ruhmreich war. »Nichtaufgegangenes Brot ist tot und leblos«, schrieb der orthodoxe Patriarch in Konstantinopel, Michael Kerularios, an Papst Leo IX., »denn es fehlt das Triebmittel, das heißt die Seele, und das Salz, das Gemüt des Messias«. Auf römischer Seite hatte man Kardinal Humbert zum Experten der Westkirche für Backwaren ernannt. Er war als ein Fanatiker mit problematischem Temperament bekannt, und seine Antwort an den Patriarchen stimmt mit diesem Eindruck durchaus überein: »Wenn Du nicht mit Trotz und Unwillen Deinen Geist in Opposition zur Wahrheit stehen lassen willst, bist Du gezwungen, so zu denken wie wir und musst zugeben, dass Jesus Christus während des letzten Abendmahls kein aufgegangenes Brot verteilt hat.« Wäre Humbert ein Heiliger, dann höchstwahrscheinlich der Schutzheilige der Zurechtweisungen und Vorwürfe. Die römische Tradition, die aus Kardinal Humberts Brief deutlich abzulesen ist, basiert auf der jüdischen Mazze – nicht aufgegangenes (oder ungesäuertes) Brot, das die Juden beim Pessachfest als Erinnerung an die Flucht aus Ägypten essen. Humbert hat vermutlich recht, dass Jesus dieses Brot gegessen hat. Den Orthodoxen ging es jedoch nicht darum, das letzte Abendmahl nachzustellen, sondern eher um den symbolischen Zusammenhang vom Aufgehen des Brotes und der Auferstehung. Außerdem wollten sie sich vom jüdischen Ursprung der Religion distanzieren und warfen der Westkirche vor, »Judaisten« zu sein. Irgendwann ließ Kerularios sämtliche römischen Kirchen in Konstantinopel schließen. Seine Männer stürmten die Kirchen und zertrampelten alles an Abendmahlbrot, was sie fanden. Für einen Nichtgläubigen ist es einigermaßen unverständlich, welche Kraft in zwei verschiedenen Brotbrocken liegen kann, von denen keiner besonders wohlschmeckend ist. Aber der Konflikt um das Brot war – zusammen mit der Aufnahme des Wortes filioque (und des Sohnes) in das Glaubensbekenntnis – der Auslöser für das Große Schisma, die endgültige Aufsplitterung zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. »Die erste und wichtigste Ursache für den Bruch zwischen ihnen und uns ist das Brot ohne Hefe«, schrieb Johannes VII., einer der Anführer der griechisch-orthodoxen Kirche, als er gegen Ende des 12. Jahrhunderts das Schisma beschreiben sollte. »Dieses Thema beinhaltet in sich die gesamte Frage über den wahren Glauben an Gott. Wenn dies nicht geheilt wird, kann die eigentliche Krankheit der Kirche auch nicht geheilt werden.« Ich nippe am Wein und esse ein wenig Brot, während ich das kontrollierte Chaos im Restaurant genieße. Von frisch gebackenem Brot, das weich und hart zugleich ist, kann ich nie genug bekommen. Dieses gewöhnliche, säkulare Brot, das wir jeden Tag essen, ist ganz anders als das Brot, das meine Vorfahren auf ihren kleinen Bauernhöfen im Süden Norwegens aßen. Ihr Brot war grob und hart. In schwierigen Jahren (von denen es viele gab) wurde das Getreide weggelassen. Fischmehl war die übliche Zutat zum Strecken des Teigs, aber auch Borke, Tang und Kartoffeln wurden von den armen Bauern in den verschiedenen Gegenden Skandinaviens verwendet. Das Brot wurde auf den Höfen in einfachen Backöfen gebacken, ähnlich dem Backofen unter dem Kamin in der alten Küche auf dem Hof meiner Familie. Der Hof wurde Ende des 18. Jahrhunderts gebaut. Man kann den Ofen mit Brennholz oder Zweigen anfeuern, bis die Wände genügend Hitze gespeichert haben, um darin backen zu können – ein Prozess, der viele Stunden dauert, die ganze Küche verräuchert und kein Brot hervorbringt, das wirklich optimal ist. Das norwegische Bauernbrot der Vergangenheit war meist hart und flach. Man konnte nicht jeden Tag backen, also geschah es nur einmal in der Woche, daher wurde das Brot häufig trocken. Manchmal wurde es auch über der Feuerstelle aufgehängt, damit es nicht schimmelte oder von den Mäusen gefressen wurde. Wenn es gegessen werden sollte, wurden harte Brocken abgebrochen beziehungsweise abgeschlagen und in Suppe oder Brühe eingeweicht. Das römische Brot jedoch muss dem heutigen Brot, wie wir es kennen, sehr ähnlich gewesen sein. Es wurde von professionellen Bäckern in großen Bäckereien gebacken. Aus der Literatur wissen wir, dass die alten Römer wie wir viele verschiedene Brotsorten und -qualitäten schätzten. Außerdem unterschieden sie zwischen Broten mit unterschiedlichen Mahlgraden. Gerste lieferte guten Geschmack, ging aber schlecht auf, bevorzugt wurde Weizen. Je heller, desto feiner. Zunächst war das helle Brot den Reichsten vorbehalten, doch nach und nach erwartete die gesamte Bevölkerung helles Brot. Für das Alltagsleben der römischen Zeit ist Pompeji eine der wichtigsten Quellen, die wir haben; eine Stadt, die bei seinem Ausbruch im Jahr 79 von der Asche des Vulkans Vesuv versiegelt wurde – bis im 19. Jahrhundert Ausgrabungen begannen. Dadurch wissen wir genau, wie die Bäckereien und das Brot der damaligen Zeit aussahen, und im Grunde hat sich daran bis heute nicht sehr viel geändert. Der alte römische Backofen war ein Meisterwerk der klassischen Baukunst. Obwohl er zweitausend Jahre alt ist, lässt er meinen zweihundert Jahre alten Backofen genau so aussehen, wie er ist: bäuerlich und einfach. Er gehörte isoliert lebenden Bauern am Rande der Welt. Die römische Variante hatte jedoch ein gewölbtes Dach, eines eigenes Aschefach, eine Ofenklappe und einen Behälter für Wasser, um während des Backvorgangs Feuchtigkeit hinzuzufügen und so eine feine, goldene Kruste zu erhalten. Das klassische römische Brot war – und ist – rund mit feinen Rillen oder einem doppelten Kreuz, sodass es sich leicht in acht gleich große Stücke brechen lässt. Zwar hat sich die Technologie in den meisten Bereichen in den zweitausend Jahren, in denen der Backofen in Pompeji unter der konservierenden Ascheschicht lag, erheblich verändert, doch der Ofen, den sie bei Forno Campo de’ Fiori verwenden, ist dennoch seit der Römerzeit beinahe unverändert. Unglücklicherweise habe ich aus reiner Zerstreutheit den größten Teil meines Brotes aufgegessen. Ich verwünsche mich dafür. Als Restauranttester hatte ich mich eisenhart daran gewöhnt, mich vom Brot fernzuhalten. Einen Bissen probieren, dann liegenlasen. Platz lassen für das, was noch kommt.
| Erscheinungsdatum | 21.11.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Ulrich Sonnenberg |
| Zusatzinfo | Vignetten |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | En middag i Roma |
| Maße | 140 x 220 mm |
| Gewicht | 450 g |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Essen / Trinken |
| Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Kulturgeschichte | |
| Schlagworte | Geschichte der Lebensmittel • Kulinarik • kulinarische Archäologie • Kulturgeschichte • Restaurants • Überleben • Weltgeschichte |
| ISBN-10 | 3-88747-409-0 / 3887474090 |
| ISBN-13 | 978-3-88747-409-6 / 9783887474096 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich