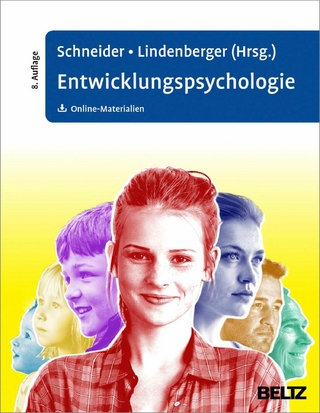Letzte Gefühle (eBook)
256 Seiten
Beltz (Verlag)
978-3-407-86786-5 (ISBN)
Sabrina Görlitz ist ausgebildete Journalistin und Sterbebegleiterin. Seit 2019 begleitet sie als Geschichtenpflegerin tödlich erkrankte Menschen in ihren letzten Lebenswochen. Gemeinsam mit ihnen schreibt sie auf Grundlage der Würdezentrierten Therapie ihre Biografie auf. Sie ist außerdem Dozentin im Studiengang »Palliativ begleiten« an den Fernschulen Hamburg. Über ihre besondere Form der Biografiearbeit berichten zahlreiche Medien wie Spiegel, SZ und DLF. www.storycare.de
Vorgeschichte: Am Anfang war das Wort
Ich weiß noch genau, wie ich von der Unausweichlichkeit des Todes erfuhr. Es war Herbst, ich war drei oder vier Jahre alt. Mein Bruder, meine Mutter und ich waren auf dem Weg in die Innenstadt, und wir liefen wie immer an der Friedhofsmauer entlang. Der Bürgersteig war von knisternden braunen und gelben Blättern übersät, durch die ich mir tanzend den Weg bahnte. Die beiden unterhielten sich über einen älteren Bekannten, der bald sterben würde.
»Warum muss er denn sterben?«, fragte ich.
Mein Bruder, fast sechs Jahre älter, antwortete: »Weil wir alle einmal sterben müssen.«
Meine Mutter sagte nichts, ich auch nicht, und schon war das Gespräch wieder vorbei. Ich hörte auf, durch die Blätter zu tanzen, das weiß ich noch. Ich lief nur noch geradeaus, mit hängendem Kopf.
An diesem Tag, an dem ich erfahren hatte, dass das Leben vergänglich ist und alle Menschen sterblich sind, ist irgendetwas in mir zerbrochen. Ich weiß heute, dass das nicht hätte sein müssen. An diesem Tag wurde aber auch meine Sehnsucht nach Reparatur geboren, und deswegen ist es auch der Tag, an dem diese Geschichte beginnt. Ja genau, sie beginnt mit fehlenden Worten.
In jedem Leben kommt eine Zeit, in der wir erfahren, dass wir sterblich sind. Und als wäre das nicht schon an profunder Information genug, geht dieser Moment in der Regel auch mit der Erkenntnis einher, dass dieses universale Gesetz auch die Menschen betrifft, die wir lieben. Unsere Eltern zum Beispiel. Oft sind sie es, die uns dann versichern, dass es aber noch ganz lange dauert, bis es so weit ist. Irgendwann. Nicht jetzt.
Heute weiß ich, dass dieses zunächst beruhigende »Irgendwann, aber nicht jetzt« auch eine unangenehme Kehrseite hat. Es kann sein, dass wir uns immer noch daran festklammern, wenn aus diesem unbestimmten Irgendwann in der Zukunft ein zum Greifen naher Tag geworden ist. Es fällt schwer, an die Gegenwart zu glauben, wenn es ums Sterben geht. Manchmal denke ich, wir glauben nicht einmal ans Sterben selbst. Wir wissen darum, aber wir glauben nicht daran. Dass es tatsächlich passiert, geschweige denn uns selbst.
Bei mir war das schon immer ein bisschen anders. Ich habe mich bereits in meiner Kindheit obsessiv mit dem Sterben beschäftigt, und obwohl ich nicht sterben wollte, hat mich dieses Vertrösten aufs Irgendwann eher verstört. Wenn der Tod etwas ist, was uns alle betrifft, was niemanden ausschließt – warum schließen wir ihn dann aus der Gegenwart aus und geben uns der Illusion hin, ihn auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verschieben zu können?
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich in der Grundschule einmal all meinen Mut zusammennahm und meine Religionslehrerin auf den Tod ansprach. Doch als ich mich ihr mitten im Unterricht offenbarte, war sie überfordert.
»Ich denke oft an den Tod«, sagte ich, »und der Gedanke daran macht mir Angst. Ich frage mich, was dann wird, ob es ein Leben danach gibt.«
Wenn man jemandem so eine Frage stellen konnte, dann doch einer Religionslehrerin, dachte ich. Doch Frau Andresen ließ die Gelegenheit verstreichen.
»Du bist noch so jung, Sabrina, lebe erst einmal dein Leben.«
Ich wusste nichts mit dieser Aussage anzufangen. Wie sollte ich denn »erst einmal mein Leben leben«, wenn ich mir nicht sicher sein konnte, dass es in ein großes Ganzes eingebettet war, sodass am Ende alles doch irgendwie einen Sinn ergab?
Natürlich, es ist nicht leicht, Kindern, vor allem seinen eigenen, sagen zu müssen, dass man eines Tages nicht mehr bei ihnen sein wird – im Idealfall, denn andersherum möchte man es ja auch nicht erleben. Und als Überbringerin von schlechten Nachrichten hat man tendenziell auch ein schlechtes Gewissen, selbst wenn man für die Nachricht selbst gar nichts kann, und möchte sich schnell wieder besser fühlen. An der Stelle kommt dann die Hoffnung ins Spiel.
»Es dauert sicherlich noch ganz lange«, und wenn wir »sicherlich« sagen, meinen wir eigentlich »hoffentlich«. Hoffentlich werden wir noch viel Zeit miteinander haben. Aber die wenigsten nutzen diese Zeit, um sich und ihre Liebsten vorzubereiten auf das, was mit Sicherheit irgendwann kommt.
Auch ich war über dreißig Jahre mehr oder minder allein mit meinen Gedanken an den Tod, ein Umstand, mit dem ich mich einigermaßen arrangiert hatte. Es gab Zeiten, in denen er präsenter war als in anderen, und das waren in der Regel die Phasen, die von Veränderungen gekennzeichnet waren. Die Pubertät, das Ende einer Beziehung, ein Ortswechsel, der Studienabschluss, solche Sachen. Übergänge fielen mir besonders schwer. Bevor ich einen unwiderruflich verstrichenen Lebensabschnitt loslassen und mich auf einen neuen einlassen konnte, fiel ich in ein tiefes Loch, in dem die Grübeleien über den Tod viel Raum einnahmen. Sie ließen kaum Platz übrig für Lebensfreude und Leichtigkeit. Das Nachdenken über den Tod nahm mir regelmäßig die Energie, mich konstruktiv mit meinem Leben zu beschäftigen. Gleichzeitig war es sicherlich auch eine sogenannte »aufrechterhaltende Bedingung«, wie es in der Psychologie heißt, um es gar nicht erst zu tun. Warum leben, wenn man sterben muss?
Im Sommer 1995 fingen die Depressionen an. Ich war gerade fünfzehn geworden. Während meine gleichaltrigen Freundinnen gegen alles Mögliche rebellierten, kapitulierte ich als Teenagerin innerlich vor dem Nichts. Was für einen Sinn machte das Erwachsenwerden, wenn es mich in erster Linie bloß dem Tod näherbringt?
Es gab niemanden in meinem Umfeld, dem ich mich getraut hätte, diese Frage zu stellen. Oder andersherum: Es gab niemanden, dem ich zugetraut hätte, sie zu beantworten.
Als ich mit einundzwanzig einen Working Holiday Trip in Australien nach ein paar Monaten abbrechen musste, weil für die Depression kein Weg zu weit war und sie mich sogar dorthin verfolgt hatte, wies ich mich auf Drängen meiner Familie in eine psychiatrische Klinik ein. Ich weiß noch genau, wie ich am ersten Tag zur Visite in einen Raum gebeten wurde, in dem eine Handvoll Menschen in weißen Kitteln im Halbkreis um mich herumsaß. Ich wurde gefragt, was aktuell mein Hauptproblem wäre. Ich hätte alles Mögliche vorschieben können, so wie ich es zuvor immer gemacht hatte. Wie mein geringer Selbstwert die Beziehung zu meinem australischen Freund, den ich im vorherigen Jahr in Irland kennengelernt hatte, überschattete, zum Beispiel. Wie ich mich hin- und hergerissen fühlte zwischen dem Wind in meiner Heimat Schleswig-Holstein und der Sonne in Sydney. Ich hätte es ihnen leichter machen können, aber ich spürte, ich brauchte dringend jemanden, der das Schwere halten konnte. Also entschied ich mich für die Wahrheit.
»Ich beschäftige mich andauernd mit dem Tod, ich denke darüber nach, dass eigentlich alles sinnlos ist, wenn wir sowieso alle sterben müssen.«
Als ich in die Runde blickte, saßen sie alle mit gesenktem Kopf da, starrten auf ihre Klemmbretter und machten sich Notizen. Alibi-mäßig, glaubte ich, damit sie mich bloß nicht anschauen mussten. Niemand sagte ein Wort oder fragte nach. Wahrscheinlich waren meine Gedanken in ihren Ohren nur ein zu vernachlässigendes Symptom. Für mich jedoch waren sie der Ursprung allen Übels, und ich fühlte mich mal wieder darin bestätigt, dass es sich nicht lohnte, über den Tod zu sprechen. Seine Existenz war eine unumstößliche Wahrheit, die auch kein Halbgott in Weiß vom Thron stoßen konnte. Niemand von ihnen hatte Worte dafür, geschweige denn ein Medikament dagegen, und deswegen wandten sie sich lieber ab. Vielleicht hatte ich sie auch an ihren eigenen Tod erinnert, und sie hatten es als Kränkung empfunden. Jedenfalls checkte ich noch am selben Tag wieder aus der Klinik aus.
Irgendwie schaffte ich es aus den tiefsten Tälern aber auch immer wieder hinaus, und ich hatte auch viele gute, intensive Momente in meinem Leben, die ich sicher nicht erlebt hätte, wenn mir in stabilen Zeiten der Tod nicht auch ein Antrieb gewesen wäre. Ich glaube, er hat mich unbewusst auch immer motiviert, mich auf die Suche nach Augenblicken zu machen, die einen Funken Unsterblichkeit in sich trugen und natürlich dennoch flüchtig blieben.
Durch dieses ständige Auf und Ab dauerte vieles etwas länger in meinem Leben. Ich war Anfang dreißig, als ich mich das erste Mal in...
| Erscheint lt. Verlag | 13.9.2023 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften |
| ISBN-10 | 3-407-86786-7 / 3407867867 |
| ISBN-13 | 978-3-407-86786-5 / 9783407867865 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich