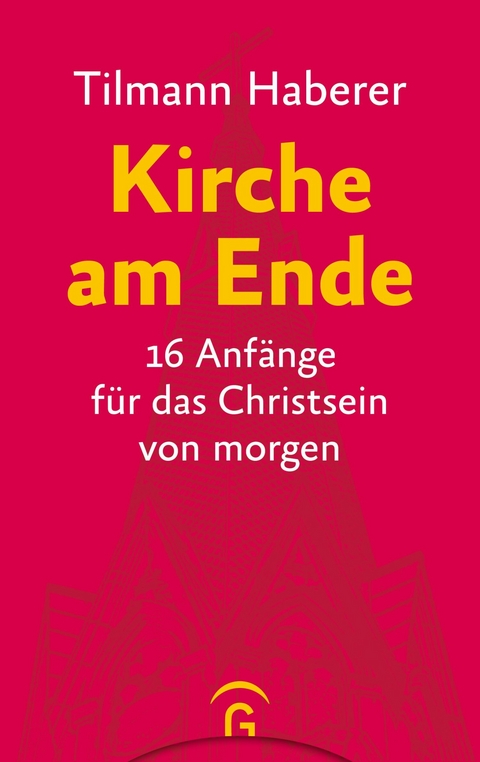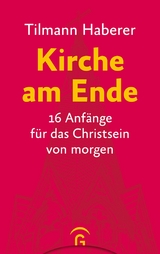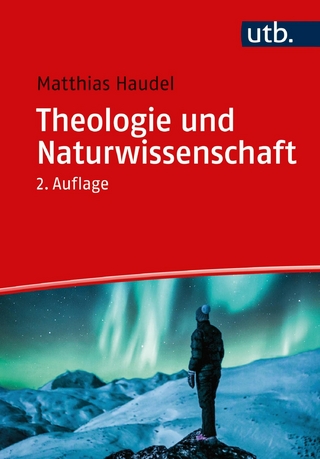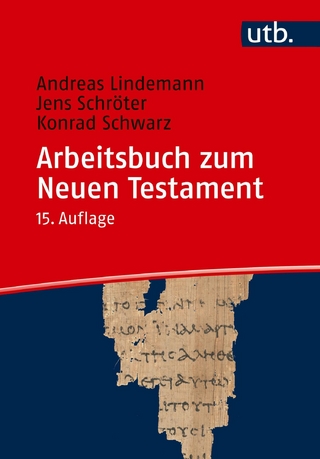Kirche am Ende (eBook)
288 Seiten
Gütersloher Verlagshaus
978-3-641-30959-6 (ISBN)
2022 sind zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Bürger*innen, die keiner der christlichen Kirchen angehören, in der Mehrheit. Es kann keinen Zweifel geben: Die Kirche, wie man sie bisher kannte, ist eine sterbende Institution. Sie ist am Ende und das ist eine Chance!
Denn wenn ein alter Baum stürzt, fällt das Licht wieder auf den Boden, den seine Krone bisher beschattet hat und dort können neue Sprösslinge wachsen. So ist es auch hier: Mag die Institution auch schwächer werden, die Botschaft des Evangeliums bleibt. Und sie wird weitergetragen: Von neuen Initiativen, kleinen Gemeinschaften und in innovativen Projekten.
Tilman Haberer hat sich diese Orte des Aufbruchs angesehen. Er versucht zu begreifen, welche Lebensprinzipien ihnen zugrunde liegen und entdeckt 16 Anfänge für das Christentum von morgen.
- Der überfällige Abschied von einer verbrauchten Institution
- Kirche aufgeben, und das Christentum neu finden
- Ein mutiges und zukunftweisendes Buch
Tilmann Haberer, geb. 1955, evangelischer Pfarrer, Gestaltseelsorger und systemischer Berater. Nach langjähriger Tätigkeit als Gemeindepfarrer in einer Münchner Citykirche sieben Jahre lang freiberuflicher Seelsorger, Journalist, Übersetzer und Autor. Von 2006 bis 2021 evangelischer Leiter der ökumenischen Krisen- und Lebensberatungsstelle »Münchner Insel«.
2. Das Christentum von morgen hat kein verbeamtetes Personal
»Der Beamtenstatus der Pfarrer ist der Tod der Kirche.« Diesen Satz habe ich vor einem Vierteljahrhundert geschrieben, in einem Papier, in dem ich eine »Spirituelle Akademie« als Alternative zur Ortsgemeinde skizziert habe. Drei Jahre nach dieser kernigen Aussage zog ich persönlich die Konsequenz und ließ mich beurlauben. Für sieben Jahre ließ ich mein aktives Dienstverhältnis als Pfarrer ruhen und verdiente meinen Lebensunterhalt in der freien Wirtschaft. Als ich nach sieben Jahren dann doch wieder in den kirchlichen Dienst zurückkehrte, arbeitete ich nicht mehr in einer Kirchengemeinde, sondern in der Münchner Insel, einer niederschwelligen Krisen- und Lebensberatungsstelle.
Heute würde ich meine Kritik am verbeamteten Pfarrertum vielleicht nicht mehr ganz so bilderstürmerisch radikal ausdrücken. Nach wie vor meine ich aber, dass das überkommene Rollenverständnis von Pfarrerinnen und Pfarrern, ihre Stellung innerhalb der Gemeinde und die Rollenerwartungen, die Gemeindemitglieder an sie haben, dem Lebensgefühl einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit nicht mehr angemessen sind und darum die notwendige, grundlegende Transformation der Kirche verhindern.
Die Pfarrperson als Flaschenhals
Was ich meine, macht schon die Berufsbezeichnung »Pfarrer« deutlich. Das Wort leitet sich ab von »Pfarr-Herr«. Der Pfarrer ist Herr über die Parochie, die Ortsgemeinde. Auch die in Norddeutschland eher übliche Bezeichnung »Pastor« trägt ein ähnliches Bild mit sich. »Pastor« heißt auf Deutsch »Hirte«, die Gemeindeglieder sind also die Schafe, die vom Hirten geführt und geleitet werden müssen.
In einer Gesellschaft, die eher autoritätsfixiert und hierarchisch organisiert ist, mögen solche Rollenzuschreibungen und Leitungsmodelle funktionieren. Aber in einer pluralen, demokratischen Gesellschaftsordnung, die dem Individuum die Deutungshoheit über das eigene Leben zuerkennt und in der jeder Mensch ein Recht auf seine je eigene Lebensgestaltung in Anspruch nehmen kann, wirken sie wie aus der Zeit gefallen. Und sie führen in die Dysfunktionalität der Institution. Heinzpeter Hempelmann beschreibt es so: »Mittelpunkt kirchlichen Lebens ist das Pfarramt, sprich das Gemeindepfarramt. Konsequenz: der eine Geistliche wird zum Bottleneck [Flaschenhals, Anm. d. Verf.], der über Wohl und Wehe einer Gemeinde entscheidet.«1 Was dem Pfarrer oder der Pfarrerin nicht passt, wozu er oder sie keine Begabung oder auch keine Lust hat, worin er oder sie keinen Sinn sieht, was also nicht durch den Flaschenhals passt, das findet nicht statt. In wie vielen Gemeinden fällt ein vormals buntes und vielfältiges Gemeindeleben in sich zusammen, wenn ein neuer Pfarrer, eine neue Pfarrerin kommt! Und umgekehrt: Eine neue Pfarrerin, ein neuer Pfarrer kann eine dreivierteltot vor sich hinvegetierende Gemeinde schlagartig zu neuem Leben erwecken – solange und soweit ihre Lust und Tatkraft eben reichen.
Lust und Tatkraft sind meist die entscheidenden Faktoren, wichtiger noch als Ausbildung und theologische Ausrichtung. Denn der konkrete Arbeitsalltag von Pfarrerinnen und Pfarrern hat oft recht wenig zu tun mit dem, wofür sie ausgebildet sind. Sie haben Theologie studiert, sind für wissenschaftliches Arbeiten qualifiziert. Was aber im Gemeindealltag von ihnen erwartet und gefordert wird, ist oft etwas ganz anderes. Zeremonienmeisterin bei Familienfeiern sollen sie sein, allerhand Lustbarkeiten wie Gemeindefeste oder Flohmärkte müssen sie organisieren, dazu (in etlichen Landeskirchen) Religionsunterricht an öffentlichen Schulen erteilen, einen oft umfangreichen Finanzhaushalt aufstellen und kontrollieren, nicht selten sind sie Bauherr bei Um- und Neubauten, häufig haben sie Mitarbeitende zu führen und obendrein noch den Friedhof zu verwalten. Zu dem, wozu sie als Seelsorger oder »Geistliche« eigentlich berufen sind, kommen sie viel zu wenig: nämlich Menschen zu begleiten auf ihrem Lebensweg, sie bei ihrer spirituellen Suche zu unterstützen und in den Krisenzeiten des Lebens für sie da zu sein. Und oftmals sind sie ja auch dafür nicht oder nur höchst unzureichend ausgebildet. Zu meiner Zeit gehörte zur praktischen Ausbildung ein dreiwöchiger (!) Seelsorgekurs – ein Nichts im Vergleich zu meiner wissenschaftlich-theologischen Ausbildung, die volle sechs Jahre dauerte. Und so etwas wie spirituelle Praxis kam im Vorlesungsverzeichnis überhaupt nicht vor.
Ein weiteres Problem mit dem Beruf der Pfarrerin, des Pfarrers: Er gehört zu den wirklich gut bezahlten und bestens abgesicherten Professionen. Die Besoldung ist der der staatlichen Beamten gleichgestellt, und dabei reden wir nicht vom Mittleren Dienst. Die sogenannte Beihilfe macht den Zugang zur Privaten Krankenversicherung leicht, und die Pensionszahlungen liegen deutlich über der durchschnittlichen Rente. Das macht es für die verbeamteten Pfarrpersonen nicht einfacher, sich in die Lebensweise, in die Sorgen und Nöte eines gering verdienenden oder gar eines armen Menschen hineinzuversetzen. Mir selbst wurde das erst so richtig bewusst, als ich während meiner siebenjährigen Beurlaubung die Erfahrung machte, wie es ist, wenn der Geldautomat am 25. des Monats kein Geld mehr ausgibt, weil das Konto hoffnungslos überzogen ist. Mühsam musste ich lernen, was für viele Menschen auch in unserem reichen Land alltägliche Realität ist: sich zu überlegen, was man sich leisten kann, die Preise im Supermarkt zu vergleichen und die billigste Milch zu kaufen. Und drei Jahre lang keine Urlaubsreise machen zu können – wobei mir klar ist, dass eine Urlaubsreise für viele Menschen ohnehin überhaupt nie infrage kommt. Pfarrpersonen leben sehr bequem in einer Wohlstandsblase, man kann es nicht anders sagen. Hinzu kommt: Sie stammen meist aus einem gehobenen, vergleichsweise wohlhabenden, aber postmateriellen Milieu, haben eine akademische Ausbildung genossen, verstehen etwas von klassischer Musik und lesen das Feuilleton in DIE ZEIT. Erst vor Kurzem habe ich aus dem Mund einer Kollegin, als es um Musikstile in der Kirche ging, den Satz gehört: »Na, Bach geht doch immer. Bach mögen alle.« Ja, vielleicht alle, die noch in die Kirche kommen, und selbst da bin ich mir nicht so sicher. Mit der Alltagsrealität sehr vieler Menschen hat das Leben der Pfarrer und Pfarrerinnen wenig bis gar nichts zu tun. Kein Wunder, dass die Gottesdienste schwach besucht und Gemeindehäuser leer sind; wir sprechen ja nicht mal die Sprache eines Großteils der Bevölkerung, wir verstehen ihre Kultur nicht, verachten sie eher. Oder ist ein Pastor vorstellbar, der für Helene Fischer schwärmt, und eine Pastorin, die alle CDs von Beyoncé und Rihanna im Regal hat? Dann doch eher Schostakowitsch.
Und trotzdem geht in der Gemeinde an der Pfarrerin, am Pfarrer kein Weg vorbei. Das Bild vom Flaschenhals finde ich sehr zutreffend, drastischer noch spricht Michael Herbst von der »pastoralen Gefangenschaft der Kirche«.2 Was aber wäre die Alternative?
Die Fülle der Gaben
Die Antwort liegt nahe, wenn wir uns erst einmal von der bisherigen Logik, die Pastorinnen und Pfarrer in den Mittelpunkt stellt, verabschiedet haben. Dann sehen wir nämlich, dass es in jeder Kirchengemeinde eine Fülle von Talenten gibt, Menschen mit den unterschiedlichsten Begabungen. Der eine kann Jugendliche begeistern und motivieren, die andere einen Finanzhaushalt aufstellen und kontrollieren, es gibt musikalische Menschen und solche, die Feste organisieren können. So mancher oder manche hat sich durch Studieren und Leben ein vertieftes Verständnis der Bibel angeeignet, wieder jemand anderer hat Erfahrungen und Kenntnisse in Meditation und Kontemplation. Es gibt Menschen, die sich gern für andere einsetzen, Besuche oder Besorgungen machen – oder andere, die über juristische Kenntnisse verfügen, mit denen sie Geflüchtete oder Arbeitsmigrantinnen beim Gang aufs Amt unterstützen können. Das alles ist an sich eine Selbstverständlichkeit, aber es bleibt oft verborgen und wird für die Gemeinschaft nicht fruchtbar gemacht, weil sich alles auf die Pfarrpersonen bezieht. Damit sich hier etwas ändern kann, müssten Gemeindeleitungen sich klar machen, was Klaus Douglass pointiert als »die herausragende Eigenschaft eines guten Pfarrers« benennt: »Er ist in der Lage, sich selbst überflüssig zu machen. Er kann andere groß machen. Er nimmt nicht nur zähneknirschend hin, dass andere die Arbeit besser machen als er. Vielmehr ist das sein erklärtes Ziel.«3
Wenn nun aber andere die Arbeit besser machen, was bleibt dann noch für die Theologinnen und Theologen? Sehr viel. Und vor allem: das Eigentliche – das, worin sie spezialisiert sind. Gute Theologie ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt und der immer wieder als notwendige Korrektur allzu naiver oder populistischer Ansichten zum Einsatz kommen muss. Ja, es braucht in der Kirche gut ausgebildete Theologinnen und Theologen. Aber warum müssen diese die Gemeinde leiten? Dieser heute unauflöslich und gottgegeben erscheinende Zusammenhang lässt sich historisch verstehen und hatte in früheren Zeiten vielleicht auch Sinn – der Pfarr-Herr als Repräsentant der kirchlichen Hierarchie in einem feudalistischen System. Heute ist er aber schlicht nicht mehr tragfähig. Dieses Pfarrerbild steht für eine Kirche der Vollversorgung, in der die »Schäfchen« konsumieren, was die »Hirten« anbieten. Sie »besuchen« Gottesdienste, statt an ihnen teilzunehmen oder sie gar zu gestalten. Sie sind abhängig von dem, was sich die Gemeindeleitung ausdenkt oder was sie zulässt. So bleiben sie unmündig.
Das Christentum von morgen...
| Erscheint lt. Verlag | 27.9.2023 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Christentum |
| Schlagworte | 2023 • Architektur • Bekenntnisschriften • Christ und Welt • demokratie braucht religion • demokratie brucht religion • die zeit der leeren kirchen • eBooks • eine kirche für viele statt heiligem rest • Erik Flügge • Evangelische Kirche in Deutschland • Freikirche • Halik • Hans Küng • Hartmut Rosa • Katholische Kirche • Kirchenaustritt • Kirchenaustritte • Kirchenerneuerung • Kirchenkrise • Kirchenkritik • Kirchenreform • Kirche von morgen • Kunst • Lehren des Christentums • Maria 2.0 • Missbrauch Kirche • Neuerscheinung • Publik Forum • Religiöse Zeitfragen • Sexueller Missbrauch in der Kirche • Steuern • Woelki |
| ISBN-10 | 3-641-30959-X / 364130959X |
| ISBN-13 | 978-3-641-30959-6 / 9783641309596 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich