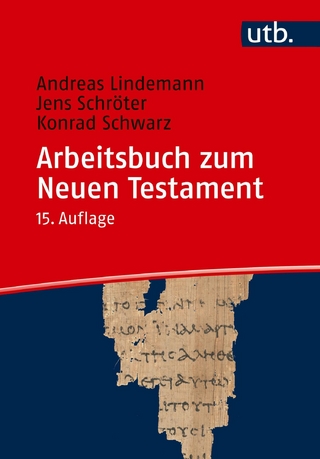Henri Nouwen hat in seinem (bis heute nicht auf Deutsch erschienenen) Band The Spirituality of Fundraising beschrieben, warum der Umgang mit Geld so verschämt oder gar tabuisiert ist und dessen geistliche Dimension beleuchtet: Geld berühre ein intimes Bedürfnis nach Sicherheit, das der Mensch im Herzen trägt. Jesu radikale Botschaft sei aber, dass es eben nicht möglich ist, seine Sicherheit gleichzeitig in Gott und im Geld zu finden. Man müsse sich also für eins von beiden entscheiden. Wenn man das getan habe, könne man entspannen: Wer frei vom Geld ist, der kann darum bitten, so Nouwen.
In der Kirche wird auch selten über Geld gesprochen. Vielleicht liegt das an genau jener Sicherheit, die es auch für die Institution bedeutet. Mit zwölf Milliarden Euro Kirchensteuereinnahmen – das ist fast soviel, wie VW und Daimler im Jahr 2020 zusammen an Gewinn gemeldet haben – und mit einem großen Vermögen sind die katholische und evangelische Kirche in Deutschland ein ökonomisches Schwergewicht.
Dieses Heft macht das Geld (in) der Kirche zum Thema. Die Frage, der die Autorinnen und Autoren nachgehen, lautet: Was heißt es für verschiedene kirchliche Akteure, gut mit Geld umzugehen? Es ist bemerkenswert, was sie an grundlegenden Einsichten und praktischen Aussichten zu Papier gebracht haben.
Bernhard Spielberg, Dr. theol., Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Universität Freiburg.
| Erscheint lt. Verlag | 28.7.2021 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Zusammenstellung: Bernhard Spielberg |
| Verlagsort | Würzburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Christentum |
| Schlagworte | Geld • Pastoral • Seelsorge |
| ISBN-10 | 3-429-06509-7 / 3429065097 |
| ISBN-13 | 978-3-429-06509-6 / 9783429065096 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 870 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich