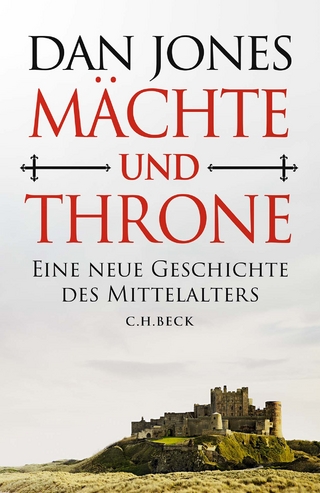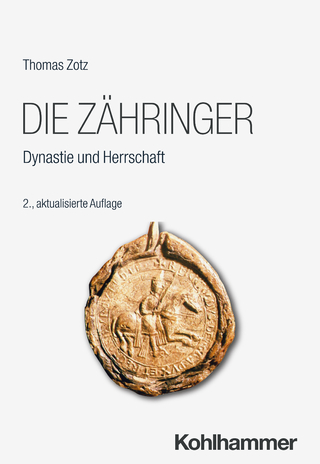Mittelalterliche Zisterzienserinnenklöster im südwestlichen Ostseeraum
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege (Verlag)
978-3-910011-98-4 (ISBN)
Der im Dominikanerkloster Prenzlau bewahrte reiche Fundus von Dingen aus der untergegangenen Frauenzisterze Seehausen wird derzeit wissenschaftlich erschlossen. Dies war Anlass zur Präsentation und Diskussion aktueller wissenschaftlicher Perspektiven auf die materielle Kultur mittelalterlicher Frauenkonvente. Ausgehend von den materiellen Relikten – vom profanen Alltagsgegenstand bis zur prachtvollen Architektur – werden die unterschiedlichen Ebenen behandelt, auf denen weibliche Ordensgemeinschaften des Mittelalters agierten: die Organisation des Alltags mit seinen liturgischen, profanen und sozialen Anforderungen, die sozialen Netzwerke, die klösterliche Ökonomie, der Ausdruck kollektiver, individueller und sozialer Identität sowie die Verwirklichung religiöser Überzeugungen. Dieses Themenspektrum beleuchtet der reich bebilderte Tagungsband in interdisziplinärer Vielfalt.
Aus Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, Heft 133, 2022, S. 620–622
Der Band ist eine Sammlung von 18 Vorträgen, die 2019 anl ässlich einer Tagung im Dominikanerkloster Prenzlau gehalten wurden. Prenzlau bewahrt eine Sammlung von Kulturgut aus der ehemaligen Frauenzisterze Seehausen. Das in der Uckermark gelegene Zisterzienserinnenkloster (auch als Marienwerder bekannt) bestand vom 13. bis ins 16. Jahrhundert und wird seit 1984 tiefergehend erforscht. Die Forschungslage um Marienwerder ist ein Beispiel dafür, wieviel wertvolle Information nachträglich aus dem Abfall eines Klosters gewonnen werden kann. Kulturhistorische Auswertungen von Alltagsobjekten erschließen in manchen Fällen Einsichten, die aus Briefen, Verwaltungsschriftgut und bildlichen Quellen nicht hervorgehen.
Die Herausgeber erklären im Vorwort die Absicht des Bandes, „die aktuelle Forschung zu Zisterzienserinnenklöstern und materieller Kultur im Südwesten der Ostsee zusammenzuführen"“ (11). Die Fachgebiete Archäologie, Geschichtsforschung, Kunstgeschichte, Architektur und Denkmalpflege sind durch kompetente und international anerkannte Forscher vertreten. Sechs von den Aufsätzen sind dem Kloster Seehausen gewidmet, drei der Architektur von Frauenklöstern generell und sechs dem Themenkomplex Frömmigkeitsgeschichte. Drei gehören zur Kategorie, die mit „Grundherrinnen“ überschrieben ist und sich mit Landesausbau, Verwaltung und Politik beschäftigt.
Das Ergiebige am Seehausener Ansatz ist sicher nicht das Bild eines Klosterbaus, denn erstens ist es nicht mehr sichtbar und zweitens war es in keiner konventionellen Hinsicht „bedeutsam“. Aber die Informationserschließung durch „Zeugs“ (so die Wortwahl von Herausgeberin Gleba auf 25) hat tat sächlich Neuigkeitscharakter. Verzeichnet sind Gegenstände von Obstkernen bis Buchschließen und Spielzeug (1500 Murmeln, Würfel und zahlreiche Tonfiguren wurden gefunden). Darauf folgt eine stolze Behauptung über das Kloster Marienwerder: „Nirgendwo sonst ist der zweite klösterliche Alltag so umfassend und buchstäblich greifbar wie in den tausenden von Fundobjekten, die aus dem Kontext des Zisterzienserinnenklosters stammen“ (27).
Der Griffel in der Form eines Hundes, zum Beispiel, erlaubt eine Verbindung zu einem sehr ähnlichem Objekt, das im Frauenkloster Wienhausen erhalten ist (128). Pilgerzeichen belegen eine spirituelle Topographie und Vernetzung (91). Rosenkranzperlen aus Knochen, Glasperlen und sogar Bergkristall sind erhalten (91). Auch die Fingerringe, die die Schwestern bei der Profess angesteckt bekamen, sind aufschlussreich. In diesem Fall ist zwar die Kunstfertigkeit nicht besonders hoch, aber ein starker Christusbezug ist auf jedem der abgebildeten Ringe zu erkennen, sei es durch Christusmonogramm oder durch Kreuzdarstellung (123).
Die Aufteilung der Referate bei der Seehausener Tagung war eindeutig um Abwechslung bemüht; diese löbliche Absicht fordert freilich auch Kompromisse: Manche Aufsätze (etwa die über die rezenten Ausgrabungen) sind sehr detailorientiert und nur für Spezialisten genießbar. Andere, dahingegen, sind thematisch so breit aufgestellt, dass sie für ein fokussiertes Fachpublikum wenig Relevanz haben. Es wird sich kaum eine Leserin finden lassen, die mit Interesse sowohl Biermann und Schifers Aufsatz über Neutronenaktivierungsanalyse und archäologisch- typologische Herkunftsbestimmung der Keramikfunde als auch Löfflers Aufsatz über liturgische Handschriftenfragmente aus dem Nonnenchor des Klarissenkonvents Ribnitz in Mecklenburg lesen werden.
Das Buch zeichnet sich durch Einsichten der Alltagsgeschichte aus, und es leistet der Forschung den guten Dienst, ein so gut wie „verschwundenes“ Frauenkloster ins farbenfrohe Leben zurückzurufen.
Der Tagungsband ist mit einer dreistelligen Zahl von Farbabbildungen ausgestattet. Er enthält ein Personen- (286-287) und Ortsregister (288-291). Den einzelnen Aufsätzen folgen gründlichste Literatur- und Quellenverzeichnisse.
Alkuin Schachenmayr, St. Peter/Salzburg
| Erscheinungsdatum | 13.04.2021 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in Brandenburg ; 35 |
| Verlagsort | Wünsdorf |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 210 x 297 mm |
| Gewicht | 1500 g |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Mittelalter |
| Schlagworte | Architektur • Religion • Tagungsband |
| ISBN-10 | 3-910011-98-5 / 3910011985 |
| ISBN-13 | 978-3-910011-98-4 / 9783910011984 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich