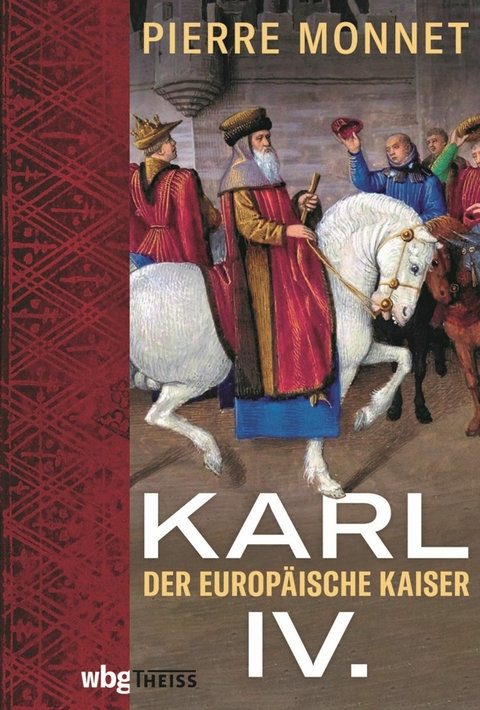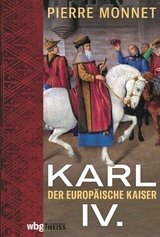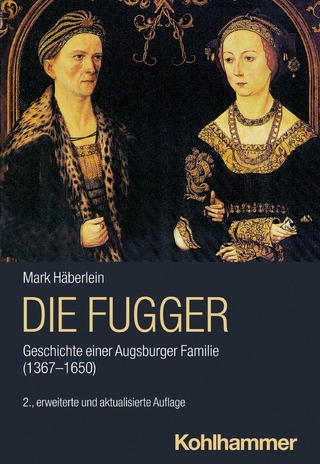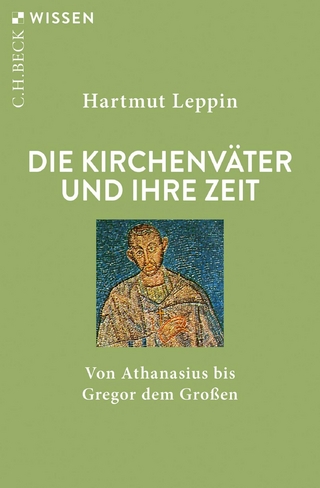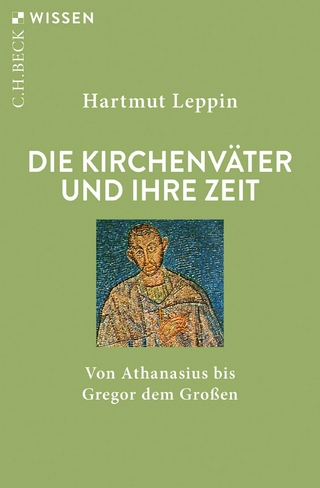Karl IV. (eBook)
416 Seiten
wbg Theiss (Verlag)
978-3-8062-4273-7 (ISBN)
Karl IV. hat viele Kronen getragen: König von Böhmen und Italien, römisch-deutscher König und später Kaiser. Er galt als sehr intelligent, hochgebildet und beherrschte fünf Sprachen. Karl IV. (1316-1378) war in jeder Hinsicht ein ungewöhnlicher Herrscher des Spätmittelalters und gilt vielen als früher Europäer.
Der Mediävist Pierre Monnet legt die erste moderne Biografie seit über 30 Jahren vor - elegant geschrieben und fundiert recherchiert:
- Ein Leben in drei Akten: Erobern - Herrschen - Überdauern
- Vom Prinzen zum römisch-deutschen Kaiser: Wie Karl IV. ein Reich schuf
- Hoheitliches Selbstverständnis: Einblicke in die Autobiografie von Karl IV.
- Die Goldene Bulle: die langlebigste Nachfolgeregelung der europäischen Geschichte
- Vermächtnis eines Herrschers: Von Kritik bis zu HeldenverehrungAusnahmeherrscher in einer krisenreichen Zeit
Das 14. Jahrhundert war geprägt von Pest, 100-jährigem Krieg und dem Abendländischen Schisma, der zeitweiligen Spaltung der Kirche. Vor diesem Hintergrund wirken der Lebenslauf Karl IV, seine lange Herrschaft und die Spuren, die er in Europa hinterließ, umso beeindruckender. Er schrieb nicht nur die einzige Autobiographie eines mittelalterlichen Herrschers und gründete die Karls-Universität in Prag. Die von ihm 1356 veröffentlichte Goldene Bulle behielt als einzige mittelalterliche "Verfassung" bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ihre Gültigkeit und prägte das politische Denken Europas.
Pierre Monnet zeigt in dieser spannenden Biografie die Wechselwirkung zwischen einem einflussreichen Herrscher und der Zeit, in der er lebte.
Pierre Monnet, geb. 1963, ist Mediävist und Professor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris. Seit 2011 ist er zudem Leiter des Institut Franco-Allemand de Sciences Historiques et Sociales (IFRA/SHS), angesiedelt an der Goethe-Universität Frankfurt.
Einleitung 11
Teil I: Erobern 22
Kapitel 1 Der Prinz: 1316-1346 24
Ein freudiges Ereignis 26
Im Schatten des Vaters 29
Zwischen Böhmen und dem Heiligen Römischen Reich: die römisch-deutsche Krone 36
Kapitel 2 Der König: 1346-1355 43
Böhmen: Karl IV. und sein Reich 44
Die Beilegung der Reichskrise 50
1355: Ein Kaiser wird gekrönt 54
Kapitel 3 Der Kaiser: 1356-1378 61
Auf dem Höhepunkt kaiserlicher Macht? Die Goldene Bulle 61
Die Konsolidierung der Hausmacht 72
Dauerbrenner Italien 79
Karl IV. und Frankreich 84
Erster Akt 1378: ein letztes Mal Paris 90
Teil II: Herrschen 104
Kapitel 4 Ländernamen 106
Das Luxemburg der Luxemburger 106
Böhmen: vom Herzogtum zum Königreich 108
Von den Premysliden zu den Luxemburgern 112
Drei Kronen für ein Reich 115
Kapitel 5 König sein 122
Identität als Person, Identität als König 122
Siegel und Kronen 127
Der König und seine Königinnen 134
Kapitel 6 Regieren 138
Die Reichsvikariate 141
Kanzler, Berater und Finanziers 144
Prag: der Regierungssitz 150
Nürnberg: die Nebenhauptstadt 158
Aufenthalte und Reisen 162
Kapitel 7 Karl IV. und die Städte 165
Ein vorhandenes Netzwerk 166
Eine flexible Politik 167
Verschleuderte Städte? 172
Städte als Regierungsstützpunkte 175
Zweiter Akt 1378: die letzte Station oder Tod in Prag 179
Teil III: Überdauern 184
Kapitel 8 Schriften und Reliquien 186
Ein gelehrter König: Gedenken und Autorität des Geschriebenen 186
Die Autobiografie: über sich selbst schreiben 190
Die Schriften des Herrschers 195
Die Leidenschaft für Reliquien 199
Kapitel 9 Karl IV. in seinen Porträts 210
Den König zeigen 213
Karl IV. in Bild und Wort 215
Porträts und Kryptoporträts unterschiedlicher Tradition 219
Karls Bild in Prag: Karlsbrücke und Veitsdom 222
Karlstein oder die Obsession für königlich-kaiserliche Erhabenheit 228
Das Bild des Königs im Schnittpunkt von Zeit und Raum 237
In Stein gemeißelt 242
Kapitel 10Der König der anderen 250
Pro und kontra: das facettenreiche Bild im 14. Jahrhundert 255
Im 15. Jahrhundert: Das Scheitern der Luxemburger befleckt Karl IV. - und wäscht ihn wieder rein 265
Nach dem 16. Jahrhundert: geografische Einengung und Wandel des karolinischen Andenkens 269
Karl IV. als romantischer Nationalheld des 19. Jahrhunderts 274
Karl IV. in den Turbulenzen des 20. Jahrhunderts 278
Dritter Akt In der Waagschale: Wer war Karl IV.? 287
Karl IV. - eine Bilanz 290
Dank 297
Anhang 301
Stammtafel der Luxemburger 303
Karten 304
Chronologie 309
Anmerkungen 312
Weiterführende Literatur 344
Personenregister 354
Ortsregister 360
Abbildungsnachweis 365
| Erscheint lt. Verlag | 15.3.2021 |
|---|---|
| Übersetzer | Birgit Lamerz-Beckschäfer |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Mittelalter |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Mittelalter | |
| Schlagworte | 100-jähriger Krieg • 100jähriger Krieg • 14. Jahrhundert • Ausnahmeherrscher • Chisma • Deutsche Könige • Europäische Geschichte • Goldene Bulle • Haus Luxemburg • Heiliges Römisches Reich • Hundertjähriger Krieg • Judenregal • Judenverfolgung im Mittelalter • Kaiser • Kaiser Karl IV • Kaiser Mittelalter • Karl IV • Karl IV. • König von Böhmen • Mittelalter • mittelalterlicher Herrscher • mittelalterlicher Kaiser • Pest • Pest im Mittelalter • Prix du livre d'histoire de l'Europe 2021 • Römisch-Deutscher Kaiser • Spätmittelalter |
| ISBN-10 | 3-8062-4273-9 / 3806242739 |
| ISBN-13 | 978-3-8062-4273-7 / 9783806242737 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 18,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich