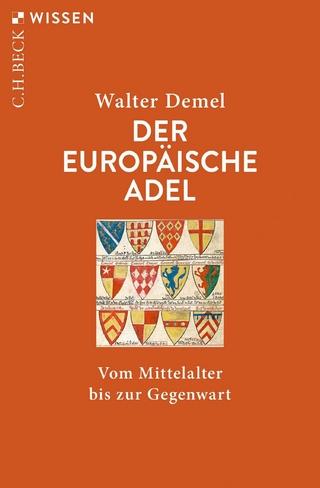1913 - Was ich unbedingt noch erzählen wollte (eBook)
304 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-490673-7 (ISBN)
Florian Illies, der »große Geschichtenerzähler« (»Süddeutsche Zeitung«), verwandelt die Vergangenheit in seinen Büchern in lebendige Gegenwart. Er verwebt in seinem mitreißenden und humorvollen Stil kurze Miniaturen zu großen historischen Panoramen und Epochenporträts. Mit seinem Welterfolg »1913. Der Sommer des Jahrhunderts« begründete Illies ein neues Genre. Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, leitete das Auktionshaus Grisebach und ist jetzt Mitherausgeber der »ZEIT«. Bei S. FISCHER erschien zuletzt das inzwischen in 18 Sprachen übersetzte Buch über die 1920er und 1930er Jahre »Liebe in Zeiten des Hasses«. Sein Kunst-Podcast »Augen zu« (gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo) gehört zu den meistgehörten Podcasts deutscher Sprache.
Florian Illies, der »große Geschichtenerzähler« (»Süddeutsche Zeitung«), verwandelt die Vergangenheit in seinen Büchern in lebendige Gegenwart. Er verwebt in seinem mitreißenden und humorvollen Stil kurze Miniaturen zu großen historischen Panoramen und Epochenporträts. Mit seinem Welterfolg »1913. Der Sommer des Jahrhunderts« begründete Illies ein neues Genre. Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, leitete das Auktionshaus Grisebach und ist jetzt Mitherausgeber der »ZEIT«. Bei S. FISCHER erschien zuletzt das inzwischen in 18 Sprachen übersetzte Buch über die 1920er und 1930er Jahre »Liebe in Zeiten des Hasses«. Sein Kunst-Podcast »Augen zu« (gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo) gehört zu den meistgehörten Podcasts deutscher Sprache.
1913 Band 2, wieder großartig, was für ein Jahr! Was für ein Buch!
ein großartiger Künstler- und Prominententratsch, indiskret, unterhaltsam, lehrreich
Alles ist im dramatischen Präsens erzählt, und alles ergibt den zweiten Roman eines Jahres, der genauso spannend ist wie der erste
Florian Illies hat auch ein zweites Mal schöner über 1913 geschrieben, als es vermutlich wirklich war.
Illies bietet wieder eine Fülle herrlicher Anekdoten, verblüffender Querverbindungen und geistreicher Bemerkungen.
Wer sich von den Geschichten und Anekdoten des ersten Bandes hat faszinieren lassen, den wird auch der zweite begeistern.
Sein bisweilen britisch anmutender, trockener Humor, gepaart mit Selbstironie und einem Hang zum Understatement, macht das Lesen zum Vergnügen.
Sternstunden der Glosse und des Aphorismus
Stanislaw Witkacy fotografiert die hinreißend schöne Jadwiga Janczewska. Doch sie hat sich schon einen Revolver besorgt.
In dieser Silvesternacht, in den Stunden zwischen dem 31. Dezember 1912 und dem 1. Januar 1913, beginnt unsere Gegenwart. Es ist für die Jahreszeit zu warm. Das kennen wir ja. Sonst kennen wir nichts. Herzlich willkommen.
Es ist spät geworden an jenem 31. Dezember in Köln, draußen leichter Regen. Rudolf Steiner, der Messias der Anthroposophie, hat sich in Rage geredet, er spricht am vierten Abend hintereinander in Köln, die Zuhörer hängen an seinen Lippen, gerade greift er zum Jasmintee, nimmt einen Schluck, da läuten die Glocken zwölf Mal, man hört die Menschen draußen auf den Straßen schreien und jubeln, aber Rudolf Steiner spricht einfach weiter und verkündet, dass eigentlich nur durch Yoga das verstörte Deutschland wieder zur Ruhe finden kann: »Im Yoga macht sich die Seele von dem frei, worin sie eingehüllt ist, überwindet das, worin sie eingehüllt ist.« Spricht’s, geht und hüllt sich in Schweigen. Prost Neujahr.
Picasso blickt hinab zu seinem aufschauenden Hund: Frika, diese seltsame Mischung aus bretonischem Spaniel und deutschem Schäferhund, mag es nicht, wenn er seinen Koffer packt, sie winselt und will dann immer unbedingt mit. Egal, wohin es geht. So nimmt er sie also kurzerhand an die Leine, ruft nach Eva, seiner neuen Geliebten, und zu dritt brechen sie in Paris auf, um mit dem nächsten Zug nach Barcelona zu fahren. Picasso will seinem alten Vater seine neue Liebe vorstellen (kaum ein Jahr später sind der Vater, der Hund und Eva tot, aber das gehört nicht hier hin).
Hermann Hesse und seine Frau Mia wollen es noch einmal versuchen. Sie haben ihre Kinder Bruno, Heiner und Martin bei der Schwiegermutter abgeladen und sind nach Grindelwald gefahren, es ist nicht weit von ihrem neuen Haus bei Bern hinauf in die Berge, zum kleinen Hotel »Zur Post«, das in diesen Tagen schon kurz nach drei Uhr am Nachmittag im Schatten der mächtigen Eigernordwand versinkt. Hesse und seine Frau hoffen, hier im Schatten die Leuchtkraft ihrer Liebe wiederzufinden. Sie kam ihnen abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Doch es nieselt. Wartet nur, balde, sagt der Hotelier, wird der Regen zu Schnee. Also leihen sie sich Skier aus. Aber es nieselt weiter. Und der Silvesterabend im Hotel ist lang und quälend und sprachlos, der Wein ist gut, immerhin. Irgendwann ist es endlich zwölf Uhr. Sie stoßen müde an. Dann gehen sie aufs Zimmer. Als sie morgens den schweren Vorhang zur Seite schieben und aus dem Fenster schauen, regnet es noch immer. Nach dem Frühstück bringt Hermann Hesse die unbenutzten Skier wieder zurück.
Rilke schreibt da gerade aus Ronda richtig Rührendes an den rüstigen Rodin.
Hugo von Hofmannsthal spaziert am 31. Dezember missmutig durch die Straßen von Wien. Ein letzter Gang durchs alte Jahr. Der Frost hält die Zweige der Bäume in den Alleen ummantelt, und auch auf den Fugen der Mauern sitzen die weißen Kristalle. Langsam senkt sich die dunkle Kälte über die Stadt. Als er in der Wohnung zurück ist, beschlagen seine Brillengläser, er reibt sie sauber mit seinem Taschentuch mit dem herrlich verschnörkelten Monogramm. Mit der noch kalten Hand streicht er über die Kommode, auf die er seinen Schlüssel legt. Ein Erbstück. Fasst dann auch den kunstvollen Spiegel an, der einst im Haus der Ahnen hing. Setzt sich an seinen prachtvollen handgearbeiteten Sekretär und schreibt: »Man hat manchmal den Eindruck, als hätten uns Spätgeborenen unsere Väter und unsere Großväter nur zwei Dinge hinterlassen: hübsche Möbel und überfeine Nerven. Bei uns ist nichts zurückgeblieben als frierendes Leben, schale, öde Wirklichkeit. Wir schauen unserem Leben zu; wir leeren den Pokal vorzeitig, und bleiben dennoch unendlich durstig.« Dann ruft er nach dem Diener. Und bittet um einen ersten Cognac. Er weiß aber längst: das wird auch nicht helfen gegen die Melancholie, die auf seinen müden Lidern liegt. Er kann nichts dagegen tun, aber er weiß den Untergang, wo andere ihn nur erahnen, er kennt das Ende, wo andere nur damit ihre zynischen Spiele treiben. Und so schreibt er an seinen Freund Eberhard von Bodenhausen, dankt für den Gruß »über das ganze große umdüsterte beklommene Deutschland hinweg«, um dann zu gestehen: »Mir ist so eigen zumut, alle diese Tage, in diesem konfusen, leise angstvollen Österreich, diesem Stiefkind der Geschichte, so eigen, einsam, sorgenvoll«. Auf mich, so heißt das, hört ja keiner.
Mit jungen Jahren war Hofmannsthal zu einer Legende geworden, seine Verse verzückten Europa, Stefan George, Georg Brandes, Rudolf Borchardt, Arthur Schnitzler, sie alle gerieten in den Bann dieses Genies. Doch Hugo von Hofmannsthal trug schwer an der Bürde des Frühvollendeten, er publizierte quasi nicht mehr, und jetzt, 1913, war er ein fast vergessener Mann, ein Relikt aus alten Zeiten, aus der »Welt von gestern« und so gründlich vergangen wie die Gesellschaft, deren Wunderkind er gewesen war. Er war der letzte Dichter des alten Österreichs, jenes Wiens, in dem im Jänner 1913 die Regentschaft von Kaiser Franz Joseph I. ins unglaubliche fünfundsechzigste Jahr geht. 1848 war er gekrönt worden, und 1913 trug er diese Krone noch immer, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Doch genau unter seiner ermatteten Regentschaft, die aus den Tiefen des 19. Jahrhunderts kam, übernahm in Wien die Moderne die Herrschaft. Mit den Revolutionsführern Robert Musil, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Arnold Schönberg, Alban Berg, Egon Schiele, Oskar Kokoschka und Georg Trakl. Die alle mit Worten und Tönen und Bildern die Welt umkrempeln wollen.
Hedwig Pringsheim, Thomas Manns mondäne Schwiegermutter, fährt, die Masseuse ist endlich gegangen, am frühen Abend von ihrer Villa in der Münchner Arcisstraße 12 aus zum Silvesteressen »bei Tommy’s« (das ist kein Restaurant in New York, sondern ihre patriarchalische Bezeichnung für die Familie ihrer Tochter Katia, verheiratete Mann, die in der Mauerkircherstraße 13 wohnt). Aber schon beim Setzen in der Mann’schen Wohnung jagt ihr der Schmerz erneut in den Rücken, der verdammte Ischias. Weil der gute Tommy am nächsten Tag nach Berlin reisen muss (was er noch bitter bereuen wird), bricht der alte Spielverderber den Silvesterabend um elf Uhr abrupt ab: »Ihr wisst, ich muss morgen früh raus.« Aber auch vorher schon war es, so die Schwiegermutter, höchstens »leidlich gemütlich«. In der ratternden Tram, auf der Heimfahrt, schlägt die Uhr vom Odeonsplatz dann zwölf Mal. Ihr Rücken schmerzt, ihr Mann, der Mathematiker Professor Alfred Pringsheim, sitzt neben ihr, schweigt und rechnet irgendetwas mit komplizierten Primzahlen. Wie unromantisch. Genau eine Straße weiter sitzt Karl Valentin und schreibt in dieser Nacht an Liesl Karlstadt: »Gesundheit und unser köstlicher Humor sollen uns nie verlassen, und bleibe fernerhin mein gutes braves Lieserl«. Wie romantisch.
Ja, genau, das ist eben jene Nacht, in der Louis Armstrong im fernen New Orleans damit beginnt, Trompete zu spielen. Und in Prag Franz Kafka am offenen Fenster sitzt und schmachtend und wundervoll und verstörend schreibt an Fräulein Felice Bauer, Immanuelkirchstraße 4, Berlin.
Der große ungarische Romancier, Freudianer, Morphinist und Erotomane Géza Csáth sitzt in dieser Nacht hingegen in seiner kleinen Arztwohnung im Sanatorium des winzigen Kurortes Stubnya, im letzten Zipfel des riesigen Habsburgerreichs, liest noch ein wenig in den Schriften Casanovas, steckt sich dann eine Luxor-Zigarre an, spritzt sich noch einmal 0,002 Gramm Morphium und zieht dann eine erfolgreiche Jahresbilanz: »360- bis 380-mal Koitus«. Geht’s noch konkreter? Aber ja. Csáth erstellt eine penible Auflistung seiner Beziehung zu seiner Geliebten Olga Jónás, die in ihrer Genauigkeit nur von der Robert Musils übertroffen wird: »424-mal Koitus an 345 Tagen, also täglich 1,268 Koitus«. Und weil er schon dabei ist: »Verbraucht an Morphium: 170 Zentigramm, also täglich 0,056 Gramm«. Und weiter geht es in der »Bilanz des Jahres«: »Einkommen von 7390 Kronen. Zehn verschiedene Frauen eingeheimst, darunter 2 Jungfrauen. Erscheinen meines Buches über Geisteskrankheiten«. Und was soll werden in 1913? Der Plan ist klar: »Koitus jeden zweiten Tag. Zähne machen lassen. Neues Jackett.« Na, dann mal los.
Alles ist neu im Jahr 1913. Überall werden Zeitschriften gegründet, die die Uhren auf null drehen wollen. Während Maximilian Harden schon seit 1892 in seiner Zeitschrift »Die Zukunft« dieselbige für sich reklamiert, nimmt sich die nächste Generation die Gegenwart vor. Gottfried Benn, der junge Arzt im Westend-Krankenhaus in Berlin, bietet gerade geschriebene Gedichte sowohl Paul Zechs Zeitschrift »Das neue Pathos« an wie Heinrich Bachmairs »Die neue Kunst«. Nur das ebenfalls 1913 neugegründete Blatt »Der Anfang« lässt er erst einmal aus. Dafür schreibt dort,...
| Erscheint lt. Verlag | 24.10.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Allgemeines / Lexika |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | Alma Mahler • Andre Gide • Anspruchsvolle Literatur • Capri • Coco Chanel • Duchamp • Egon Schiele • Else Lasker-Schüler • Felice Bauer • Franz Marc • Gallimard • George • Geza Csath • Hedwig Pringsheim • Hesse • Hofmannsthal • Julius Meier-Graefe • Kafka • Louis Armstrong • Marcel Proust • Matisse • Misia Sert • München • Otto Witte • Pablo Delavan • Paris • Paul Zech • Picasso • Puccini • Rasputin • Rilke • Rom • Schnitzler • Scott Fitzgerald • Thomas Mann • Venedig • Wien |
| ISBN-10 | 3-10-490673-4 / 3104906734 |
| ISBN-13 | 978-3-10-490673-7 / 9783104906737 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich