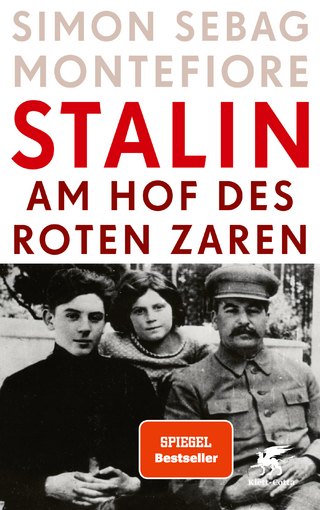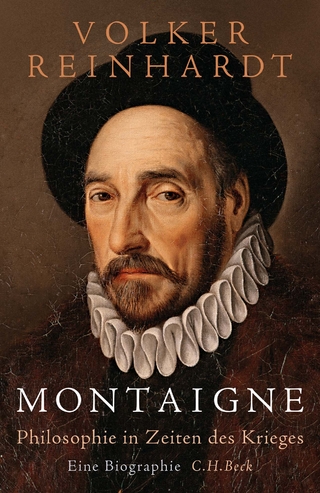Möglichkeitshorizonte
Welche aktiven Haltungen haben Menschen in den vergangenen Jahrhunderten gegenüber der Zukunft eingenommen? Die Beiträge dieses Bandes erschließen Zukunftserwartungen von Akteuren und daraus erwachsende Handlungsoptionen - von der Antike bis heute. Somit wird auf ganz unterschiedlichen Praxisfeldern der Vorsorge, der vorausschauenden Planung und der Erstellung von Vorhersagen eine grundsätzliche Pluralität gesellschaftlicher Möglichkeitshorizonte erkennbar.
Markus Bernhardt ist Professor für Didaktik der Geschichte an der Universität Duisburg-Essen, Wolfgang Blösel ist dort Professor für Alte Geschichte, Stefan Brakensiek Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit, Benjamin Scheller Professor für die Geschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit.
Inhalt
Vorwort9
Markus Bernhardt, Wolfgang Blösel, Stefan Brakensiek, Benjamin Scheller
Möglichkeitsweitung/Möglichkeitsschließung. Zwei Fälle aus der antiken Geschichte Europas21
Christian Meier
Incertus et inaestimabilis. Kontingenz und Risikopraxis in der mittleren römischen Republik45
Andrew van Ross
Planen - Vertrauen - Ignorieren. Die Unsicherheit der Zukunft und das Handeln des Aristokraten65
Jan Timmer
Nil mutandum censuerat. Wie aus religiöser Scheu antike Hochwasserprävention wird91
Jasmin Hettinger
Wie lassen sich Aussagen über Künftiges begründen? Argumentations-strategien des Pierre Dubois in De recuperatione Terre Sancte105
Barbara Schlieben
Viermal Ich in Avignon. Francesco Petrarca, Wilhelm von Ockham und Richard FitzRalph als Zeugen einer Explosion127
Jan-Hendryk de Boer
Zwischen Chance und Gefahr. Konversion vom Judentum zum Christentum als Kontingenz generierendes Moment in Mittelalter und früher Neuzeit167
Franziska Klein
Unsicherer Ausgang? Die Geschäftsmodelle von Lotterieunternehmen im 18. Jahrhundert193
Stefan Brakensiek
"Nothing should be left to chance". Ordnungsmodelle westlicher Friedensplanung im Ersten Weltkrieg223
Arno Barth
Ressourcenträume - Ressourcenräume. Zukunftsstrategien der deutschen Antarktispolitik in den langen 1970er Jahren249
Christian Kehrt
Bauen für die Forschung der Zukunft. Raumstrategien gentechnologischer Industrieforschung in den 1980er Jahren269
Dennis Gschaider
1984. François Mitterrand und die Suche nach Auswegen aus dem Kalten Krieg295
Frederike Schotters
Die Zukunft erzählen. Formen und Funktion von Zukunftsnarrationen in deutschsprachigen Schulgeschichtsbüchern der 1950er und 1960er Jahre319
Sabrina Schmitz-Zerres
Zwischen Vergangenheitsfixierung, Gegenwartsobsession, Zukunftsorientierung und Zukunftsvergessenheit. Geschichte im Schulgeschichtsbuch345
Holger Thüneman?
Autorinnen und Autoren364
Vorwort Die Beiträge dieses Bandes erschließen Zukunftserwartungen von Akteuren und daraus erwachsende Handlungsoptionen in verschiedenen historischen Konstellationen von der Antike bis heute. Die Autorinnen und Autoren hinterfragen theoretische Überlegungen, die von einem prinzipiell neuen Verhältnis zur Kontingenz als einem Charakteristikum der Moderne ausgehen. Sie setzen sich mit einem Narrativ auseinander, das eine kategoriale Differenz zwischen der westlichen Moderne und allen anderen Gesellschaften postuliert. Diese in den Sozial- und Kulturwissenschaften geläufige Meistererzählung bezieht sich in simplifizierender Weise auf das Sattelzeitkonzept von Reinhart Koselleck. Sie unterstellt, dass die dynamischen Veränderungen in Politik, Ökonomie und Sozialordnung, die sich in den westlichen Gesellschaften seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert fraglos zugetragen haben, in der Vorstellungswelt der Zeitgenossen eine bis dahin nie gesehene Weitung des Möglichkeitshorizontes bewirkt habe. Im Gegensatz zur westlichen Moderne sagt das Narrativ sowohl den älteren Epochen, als auch den Gesellschaften außerhalb des Westens nach, dass Kontingenz lediglich erlitten werde. Zwar gab es zweifellos unterschiedliche Formen des menschlichen Umgangs mit Kontingenz und Zäsuren in dessen Geschichte. Doch erscheint es zweifelhaft, ob diese auf der Basis von Unterscheidungen wie vormodern/ modern, passiv/aktiv und außerweltlich/innerweltlich angemessen beschreibbar sind. Das monolithische Verständnis von Gesellschaft, das dem Narrativ inhärent ist, das mit den genannten Unterscheidungen operiert, unterstellt, dass jede Gesellschaft nur einen Möglichkeitshorizont aufweist. Wie immer man Gesellschaft jedoch auch fasst, sie ist stets als differenziert zu denken: in soziale Gruppen, Stände, Klassen, Funktionssysteme etc., die alle ihre eigenen Erfahrungen und Erfahrungsräume besaßen und besitzen. Entsprechend ist davon auszugehen, dass es in jeder historisch gegebenen Gesellschaft eine Pluralität von Möglichkeitshorizonten als Folge der gegebenen Pluralität von Erfahrungsräumen gibt. In solch einer Perspektive ist damit zu rechnen, dass sich historischer Wandel bevorzugt in der Weitung und Verengung von Möglichkeitshorizonten zeigt. Die Beiträge dieses Bandes knüpfen an diese Vorüberlegungen an und loten exemplarisch die Pluralität gesellschaftlicher Möglichkeitshorizonte in der Geschichte aus. Zugleich spüren sie Prozessen ihrer Weitung und Verengung nach. Mit einem monolithischen Verständnis von Gesellschaft, das dieser einen einzigen Möglichkeitshorizont unterstellt, geht vielfach ein homogenisierendes Verständnis von Kultur einher, das diese mit einem Kollektiv von Akteuren, einer Epoche oder einem Raum als Ganzem identifiziert und so von anderen Kollektiven, Epochen oder Räume mit anderen Kulturen abgrenzt. Dabei wird Kultur implizit oder explizit vor allem als ein ideelles Phänomen verstanden, das seinen Ort im menschlichen Bewusstsein hat. Eben hier verorten die meisten geschichtlichen Entwürfe die historisch fassbaren Möglichkeitshorizonte. Praktiken und Handlungsstrategien, mit denen Menschen versuchen, diese Möglichkeiten zu realisieren oder zu verhindern, erscheinen als Resultat neuer Ideen beziehungsweise einer neuen Mentalität. Die Pluralität von Möglichkeitshorizonten in der Geschichte lässt sich so jedoch nicht erschließen, sondern nur, wenn außerdem Praktiken und Handlungen in den Blick genommen und darauf befragt werden, vor welchem Möglichkeitshorizont Akteure sie vollziehen. Denn Möglichkeitshorizonte sind nicht nur ein explizites Wissen, dass etwas künftig möglich ist, sondern auch (oftmals implizites) Wissen, wie etwas möglich ist bzw. möglich aber auch unmöglich gemacht werden kann. Als Untersuchungsgegenstände dienen den Beiträgen daher weniger die Zukunftsvorstellungen intellektueller Eliten, sondern bevorzugt die aktiven Haltungen, die Akteure zur Zukunft einnehmen, und ihre Handlungsoptionen, die diese aktiven Haltungen ermöglichen. Der Band dokumentiert zugleich die Abschlusstagung für die erste Kohorte der Kollegiatinnen und Kollegiaten des Graduiertenkollegs 1919 "Vorsorge, Voraussicht, Vorhersage. Kontingenzbewältigung durch Zukunftshandeln", die im Oktober 2016 im Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen stattgefunden hat. Er vereint Beiträge von Mitgliedern des Kollegs, die an dieser Stelle zentrale Ergebnisse ihrer Forschungsvorhaben vorstellen, mit Artikeln prominenter Gäste, die sich dankenswerterweise auf dessen Konzeption und Fragestellung eingelassen haben. So spricht Christian Meier in seinem Essay "Möglichkeitsweitung/ Möglichkeitsschließung. Zwei Fälle aus der antiken Geschichte Europas" der Geschichtswissenschaft die grundsätzliche Berechtigung und Befähigung zu, die Möglichkeitshorizonte historischer Akteure zu untersuchen. Um die Dimensionen dieser Möglichkeitshorizonte in der antiken Geschichte auszumessen, führt er zwei Extrembeispiele an: deren enorme Weitung im Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr. und deren Schließung im Untergang der römischen Republik. So ließen bei den Athenern die gewaltigen Erfolge bei der Perserabwehr und im Seebund das Selbstvertrauen und die Zuversicht in das unausweichliche Glücken all ihrer Unternehmungen wachsen. Das daraus erwachsende "Könnensbewusstsein" bildete laut Meier die Vorbedingung der griechischen Klassik und zudem ein Äquivalent zum modernen Fortschrittsbewusstsein. Für die Römer am Ende der Republik konstatiert Meier hingegen die Einsicht in die unüberbrückbare Kluft zwischen der Notwendigkeit struktureller Veränderungen der Verfassung und der Unmöglichkeit, diese zu verwirklichen. Denn dafür waren alle gesellschaftlich zentralen Gruppen viel zu eng in das überkommene System verwoben. Die Republik sei schließlich untergegangen, ohne zuvor wirklich in Frage gestellt worden zu sein. Andrew von Ross führt in seinem Aufsatz "Incertus et inaestimabilis. Kontingenz und Risikopraxis in der mittleren römischen Republik" als Beispiel für eine Gesellschaft, in der Elemente der kontingenzaffinen und kontingenzaversen Idealtypen gemischt waren, die römische Republik an. Darin hegten einerseits die normativ eng gerahmte Politik und die starke Kohärenz der Nobilität Kontingenz ein, andererseits wurden durch das Volkstribunat seit jeher Kontingenzen produziert und waren gerade die jungen nobiles auf dem Schlachtfeld, als Ankläger in Prozessen und bei Wahlen zu den niedrigen Ämtern verstärkt Kontingenzen ausgesetzt. Für hochrangige Imperiumsträger zeigt van Ross auf, wie sie durch ein mehrstufiges Kontingenzarrangement - sie lösten ihre Entscheidung in eine Vielzahl von Entscheidungen auf und sequenzierten diese zeitlich - die Risiken ihres ungewöhnlich aggressiven Vorgehens in ihren Provinzen, das sie absehbar mit dem Senat in Konflikt bringen musste, minimierten. Dass einzelne dies vermochten, ist umso bemerkenswerter, als nobiles normalerweise in der Sequenzierung risikoträchtiger Entscheidungen keineswegs geübt waren, sondern durch die Annuität ihrer Ämter und Imperien in den Provinzen unter großem Zeitdruck standen. Jan Timmer skizziert in seinem Aufsatz "Planen - Vertrauen - Ignorieren. Die Unsicherheit der Zukunft und das Handeln des Aristokraten" verschiedene Strategien der römisch-republikanischen nobiles zur Bewältigung derjenigen Kontingenzen, die gerade ihnen in der zumeist auf den Augenblick fixierten Politik Roms drohten. Bei Niederlagen entkoppelten römische Feldherren wie auch Ämterkandidaten die eigene Entscheidung vom eingetretenen Schaden, indem sie den Zorn der Götter bzw. den Wankelmut des als Pöbel verstandenen Wahlvolkes dafür verantwortlich machten. Als zentrale Strategie für den alltäglichen Umgang der nobiles miteinander hebt Timmer jedoch das gegenseitige Vertrauen hervor. Denn dieses war unerlässlich für Verhandlungen, die in der Republik zumeist zum Konsens aller Beteiligten führen sollten. Dieses Vertrauen aufzubringen wurde durch die soziale Abgeschlossenheit der Nobilität, ihre überschaubare Gruppengröße und die große Vertrautheit ihrer Mitglieder ermöglicht, was zuweilen sogar dazu verleitete, Handlungen des Gegenübers, die dieses Vertrauen massiv untergraben mussten, vollständig zu ignorieren. Jasmin Hettinger greift in ihrem Aufsatz "Nil mutandum censuerat. Wie aus religiöser Scheu antike Hochwasserprävention wird" das zentrale Vorurteil der Moderne auf, religiöse Scheu habe die Menschen der Antike davon abgehalten, wirksame Schutzmaßnahmen gegen Naturkatastrophen zu ergreifen. Ihre Widerlegung geht von den Plänen des Jahres 15 n. Chr. zur Regulierung des Tibers durch Ableitung eines seiner Zuflüsse und Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens am Veliner See aus. Dass diese Pläne nicht umgesetzt wurden, ist laut Hettinger weniger religiöser Scheu als vielmehr der - womöglich Cicero entlehnten - Argumentation der Seeanlieger, der Reatiner, zuzuschreiben, die Natur sorge schon am besten für die Menschen. Offenbar war damit jedoch kein ursprünglicher Naturzustand gemeint, sondern eine vom Menschen bereits verbesserte Natur, denn so wurde gerade der im frühen 3. Jahrhundert v. Chr. künstlich geschaffene Seeabfluss vor Veränderung geschützt. Anstatt die Quellflüsse des Tibers massiv zu beschränken, wurde 15 n. Chr. eine mit hochrangigen Senatoren besetzte Kommission zur Aufsicht über das Tiberbett geschaffen. Die von dieser Kommission veranlasste weitreichende Uferbefestigung an dessen Unterlauf wertet Hettinger als eindrucksvolles Beispiel für antike Hochwasserprävention. Gegenstand des Beitrages von Barbara Schlieben ist das unter dem Titel "Von der Wiedereroberung des Heiligen Landes" (De recuperatione Terre Sancte) bekannte Werk, das der französische Jurist und advocatus regis Pierre Dubois im Jahr 1306 verfasste. In diesem Werk rief er nicht nur zur Wiedergewinnung des 1291 mit dem Fall von Akko verlorenen Heiligen Landes für die Christen auf. Er beschrieb außerdem die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Kreuzzug, dessen Finanzierung und militärische Durchführung sowie die künftigen Lebensbedingungen der Christen und ihre Aufgaben vor Ort. In Anknüpfung an Otto Gerhard Oexle und Frank Rexroth versteht sie den Kreuzzugstraktat als Entwurf einer Utopie, fragt jedoch nicht nach den konkreten Ausformungen des Künftigen bei Dubois, sondern nach den argumentativen Strategien, mit denen er für die von ihm entworfene Zukunft warb und zum Handeln in der Zukunft motivieren wollte. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, inwiefern und wie er in seine Überlegungen integrierte, dass Aussagen über die Zukunft aller Vorsorge zum Trotz kontingent blieben. Die "phantastische" Präzision von Dubois' Zukunftsentwurf wurzelt darstellerisch-argumentativ im Wissen um die Kontingenz von Aussagen über Künftiges. Dabei stützte Dubois seine Zukunftsvisionen zum einen mit Argumenten aus der Naturkunde und der Metaphysik und berief sich so auf Bereiche, die bereits nach Boëtius sichere Aussagen über Künftiges ermöglichten. Zum anderen verwies er immer wieder auf die Erfahrung (experiencia), um seinen planerischen Entwürfen Gewicht zu verleihen und konturierte sie so als "Bindeglied zwischen einzelnen Ereignissen der Vergangenheit und Gegenwart und dem möglichen Handeln in der Zukunft". Jan Hendryk de Boer untersucht, wie der Humanist Francesco Petrarca (1304-1374), der englische Philosoph und Theologe Wilhelm von Ockham (ca. 1285-1347) und der irische Theologe und Bischof Richard FitzRalph (ca. 1299-1366) die Diskontinuität, die ihre Erfahrungen im Avignon der Päpste und die reflexive Bezugnahme auf dieselben prägte, als Wandel des Ichs narrativ plausibilisierten. Mit Jurij Lotman unterscheidet er zwei Typen historischen Wandels: sukzessive Entwicklung, bei der das Kommende nie gänzlich unbekannt, sondern für die Zeitgenossen zumindest ansatzweise antizipierbar ist, und Explosion, die eine unvorhergesehene Veränderung darstellt. Am Beispiel der drei Gelehrten deutet er die Begegnung mit dem Avignoneser Papsttum als Konfrontation mit einer Explosion, "die neue, unerwartete Entwicklungen in Gang setzte". Während für Petrarca und Ockham Avignon einen Negativort darstellte, war das Avignoneser Papsttum für FitzRalph positiv besetzt. Allen drei Gelehrten gemeinsam war jedoch, dass die Begegnung mit ihm für sie einen Einschnitt auf ihrem Lebensweg darstellte. Indem sie diesen schriftstellerisch bearbeiteten, entwarfen sie alle in unterschiedlicher Weise "ein verändertes Ich, das sich von demjenigen unterschied, das Jahre zuvor nach Südfrankreich gekommen war". Konfrontiert mit den Ereignissen und Prozessen, die die Explosion Avignon auslöste, sahen Petrarca, Ockham und FitzRalph ihre Gewissheiten und Erwartungen herausgefordert und bewältigten diese Kontingenzerfahrung durch die Narration personaler Identität. In Gedichten, Briefen und Gebeten erzählten sie ihre Erfahrungen in Avignon als Veränderung des Selbst. "Im Angesicht der Explosion war es ihnen wichtig, die gemachten Erfahrungen zu akzentuieren und auf diese Weise gestaltend in das Werden der Zukunft einzugreifen." In ihrem Beitrag untersucht Franziska Klein, wie der Übertritt von Juden zum Christentum im lateinischen Mittelalter Kontingenz generierte und fragt nach den Möglichkeitshorizonten, die in den Kontingenz bewältigenden Zukunftspraktiken der Akteure fassbar werden. Der Religionswechsel eröffnete den Konvertiten die Möglichkeit einer neuen Zukunft und schuf neue Gefahren, denen jüdische und christliche Autoritäten präventiv vorzubeugen versuchten. Dabei ging es nicht nur "um politische oder ökonomische Möglichkeiten, sondern um das Seelenheil", doch spielten erstere immer wieder eine wichtige Rolle. Die Konversion konnte ein Ausweg aus Armut, Haft oder der Ehe mit einem ungeliebten Partner sein. Neue Karrieremöglichkeiten einer weltlichen Karriere eröffneten sich Konvertiten zum Christentum seit dem Hochmittelalter vor allem an den Herrscherhöfen, wie etwa das Beispiel des Philippe le Convers de Villepreux zeigt, der in der zweiten Hälfte des 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts zu einem der bedeutendsten Männer am französischen Königshof aufstieg. Die soziale Situation der allermeisten Konvertiten war jedoch prekär. Da Armut in den Augen der Zeitgenossen die Gefahr des Rückfalls in den früheren Glauben barg, hatte Fürsorge für Konvertiten seit dem Hochmittelalter fast immer das Ziel, Vorsorge gegen diese Gefahr zu treffen und damit präventiven Charakter. Dabei lässt sich im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit eine Verschiebung vom "Gefahrenmanagement post [f]actum hin zu einer Risikokalkulation prae actu" beobachten. Vor allem Katechumenenhäuser und ähnliche Institutionen sollten Taufwillige registrieren, kontrollieren und nach ihrer Taufe in einer Weise sozial platzieren, dass es die "besonders unsicheren Konvertiten" nach Möglichkeit gar nicht mehr geben konnte. Für die Frage nach den historisch wandelbaren Formen des Umgangs mit dem Ungewissen sind Lotterien besonders geeignet, handelt es sich doch um einen Fall massenhaft willentlich herbeigeführter Kontingenz. Stefan Brakensiek behandelt in seinem Beitrag die systematischen Versuche von staatlichen und privaten Lotterieveranstaltern des 18. Jahrhunderts, die eigenen geschäftlichen Risiken zu begrenzen und die Kontingenzen des Spielausgangs auf die Lottospieler abzuwälzen. Die Käufer von Lotterielosen gingen das Risiko ein, einen meist überschaubaren Einsatz zu verlieren, aus der Überlegung, im unwahrscheinlichen Fall eines Hauptgewinns mit einem Schlag reich zu werden. Die Kalküle der Lotterieveranstalter zielten auf Gewinnsteigerung und zugleich auf Einhegung der geschäftlichen Risiken. Der Artikel zeigt, wie ausgefeilte Formen des "Kontingenz-Managements" das Geschäft mit dem Zufall für die Veranstalter in der Tat finanziell immer risikoloser machten. Hierbei schritten private Lotterieunternehmer voran, mussten sich jedoch gefallen lassen, dass zahlreiche Staatsverwaltungen ihre innovativen Geschäftsmodelle kopierten und Lotterieunternehmen in Eigenregie führten. Der Artikel zeigt, wie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Verheißung mühelosen Gewinns Lottospieler und Lotterieveranstalter gleichermaßen beflügelte, sodass individueller Wohlstand und fiskalische Prosperität am Horizont der Möglichkeiten erschienen. Für die Fürstenstaaten war dies besonders verführerisch, da Lotterien steigerungsfähige Einnahmen ohne ständische Mitsprache versprachen. Die Risiken lagen weniger auf geschäftlichem, als auf politischem Felde. Es entspann sich eine publizistische Debatte um die angeblich verheerenden Folgen des Lottos, das für den finanziellen und moralischen Ruin von tausenden Untertanen verantwortlich gemacht wurde, die der Lottosucht verfallen seien. Der aufgeklärten Öffentlichkeit galt vor allem die Verquickung von staatlicher Autorität und Lotterie als skandalös: Fürsten könnten sich nicht als fürsorgliche Landesväter gerieren und zugleich gewinnorientierten Lotterieunternehmern ein ausbeuterisches Spiel gestatten, oder - noch skandalöser - ihre Untertanen selbst in den Ruin treiben. Unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit schloss sich der skizzierte Möglichkeitshorizont mühelosen Wohlstands seit den 1780er Jahren allmählich: Ein Staat nach dem anderen hob das Zahlenlotto wieder auf; zur Mitte des 19. Jahrhunderts war die erste Konjunktur dieses staatlich lizensierten Glücksspiels vorüber. Arno Barth behandelt ein politisch folgenreiches Kapitel der Planungsgeschichte des 20. Jahrhunderts, die Bevölkerungspolitik als Risikomanagement während und nach dem Ersten Weltkrieg. Bereits einige Zeit vor dem Ende der Kampfhandlungen befassten sich in Großbritannien und in den USA eigens für diesen Zweck geschaffene politische Beratungsgremien mit der Frage, wie eine künftige internationale Ordnung beschaffen sein müsste, um dauerhaften Frieden zu gewährleisten. Für diese Gremien rekrutierte man Diplomaten und Wissenschaftler, darunter zahlreiche Historiker, in der Regel Absolventen von Elite-Universitäten, die man als Experten für diese Zukunftsproblematik ansah. Grundlage der neu zu schaffenden Ordnung sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker sein, da man in Nationalstaaten, die am Prinzip gemeinsamer ethnischer Zugehörigkeit der Bevölkerung orientiert waren, die Garanten größtmöglicher Stabilität sah. Angesichts der in vielen Teilen Europas und der Welt vorherrschenden ethnischen, sprachlichen und religiösen Heterogenität stand den Experten jedoch vor Augen, in welchem Maße die Stabilität dieser neu zu schaffenden Ordnung durch Konflikte zwischen Mehrheitsbevölkerung und Minderheiten gefährdet war. Der Artikel arbeitet heraus, welche weitreichenden Maßnahmen in diesen Gremien ventiliert wurden, die teils als Grundlage der Pariser Friedensverträge dienten, teils die anschließenden Verhandlungen in den frühen 1920er Jahren vorstrukturierten. Zwar sahen viele der Experten im völkerrechtlich verbindlichen Minderheitenschutz den entscheidenden Lösungsansatz, waren sich freilich bewusst, wie schwierig es sein würde, dieses Schutzversprechen im Konfliktfall gegenüber künftig souverän gewordenen Staaten auch einzulösen. So entsann man als Alternative humanitär intendierte Umsiedlungsprojekte, die in der politischen Praxis den Charakter gewaltsamer Vertreibung von Minoritäten annahmen. Um die "Zukunftsstrategien der deutschen Antarktispolitik in den langen 1970er Jahren" geht es in dem Beitrag von Christian Kehrt. Er arbeitet heraus, wie der erste, von dem "Abenteurer" und Erfolgsautoren Karl-Maria Herrligkoffer in den 1950er Jahren unternommene Versuch, mit dem Vorschlag für eine Antarktisexpedition an die heroischen und expansionistischen Traditionen deutscher Polarforschung vor 1945 anzuknüpfen, am Widerstand der scientific community in der Bundesrepublik scheiterte. Erst nach dem "Ölpreisschock" entdeckten Wissenschaft und Politik die Antarktis als Ressourcenraum und als "Rohstoffzukunftsreserve" für die Bundesrepublik. Die seit den 1970er Jahren intensivierten Anstrengungen zur Erforschung des sechsten Kontinents und der antarktischen Meere standen unter dem Vorzeichen der Sicherung dort vermuteter Öl- und Erzvorkommen. Besondere Erwartungen waren mit der Erforschung des Krills verbunden, Schwärme von Kleinkrebsen, in denen man eine nahezu unbegrenzte Quelle künftiger Eiweißversorgung der wachsenden Weltbevölkerung sah. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Und mit der Untersuchung möglicher ökologischer Folgen einer Erdölförderung für die besonders verwundbare Natur der Antarktis verengte sich der gerade erst geweitete Möglichkeitshorizont auch in Bezug auf diese zentrale Ressource rasch wieder. Der Beitrag verdeutlicht, dass beide Prozesse der Weitung und Verengung in hohem Maße von wissenschaftlichen Akteuren beeinflusst wurden. "Es ist charakteristisch für die Wahrnehmung der Antarktis, dass diese als Möglichkeitsraum im Spannungsfeld ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte wahrgenommen wurde." Dennis Gschaider widmet sich am Beispiel der Bayer AG Raumstrategien gentechnologischer Industrieforschung in den 1980er Jahren. Als Untersuchungsobjekt dient ihm der 1988 als Pharmaforschungszentrum eröffnete "West Campus" im amerikanischen West Haven (Connecticut), auf dem die Firma Bayer neue Strategien in der anwendungsbezogenen Genforschung erprobte. Das Gelände, auf dem man seit den späten 1980er Jahren einen neuartigen "Innovationsraum" für die seinerzeit als emerging technology empfundene Gentechnik entwickelte, wurde 2007 von der Universität Yale übernommen. Gschaider stellt diesen technologischen und architektonischen Planungs-, Entwicklungs- und Ausbauprozess der Bayer AG als einen Zeitraum dar, der von Unsicherheit, Diskontinuität und der "Emergenz neuer Akteure, Räume, Netzwerke und Produktionsformen des Wissens" geprägt war. Er beschreibt in seinem Beitrag die Entwicklung der Pharmaforschung seit den 1960er Jahren und sieht in der Genforschung seit den späten 1970er Jahren einen Paradigmenwechsel, der wenig abschätzbare Chancen und Gefahren in diesen Forschungszweig brachte. Das habe zu einer Zunahme von Kontingenz geführt, die sich auch in den planerischen Strategien niederschlug, mit denen der Raum des "West Camus" erschlossen wurde. Diesen Erschließungsprozess zeichnet der Autor detailliert nach und kann dabei die immer wieder auftretenden Unisicherheitssituationen markieren, an dem der Fortgang des Ausbauprozesses von der kontingenten Frage nach den Chancen und Risiken der Genforschung eingeholt wurde. Er beschreibt West Haven als einen grenzüberschreitenden "Wissensraum zwischen industrieller und akademischer Forschung, in dem sich konventionelle und gentechnologische Forschungsstrategien der Arzneimittelentwicklung überschnitten". Die vormals bestehende Grenze zwischen industrieller und akademischer Forschung begann sich aufzulösen. Frederike Schotters befasst sich mit der Rolle möglicher Zukünfte in der französischen Sicherheitspolitik während der Präsidentschaft Mitterrand. Sie umreißt die Konturen einer "Gefühlsstrategie" der Équipe Mitterrand, der es gelang, die französische Diplomatie wirkungsvoll ins internationale Spiel zurück zu bringen. Das betraf zum einen die fehlende Dynamik innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, die vor allem mit der intransigenten Haltung von Margaret Thatcher blockiert wurde, zum anderen die Gefahr eines Nuklearkriegs zwischen den Supermächten. Gegenseitiges Misstrauen hatte die USA und die Sowjetunion zu Beginn der 1980er Jahre in den sog. "Zweiten Kalten Krieg" geführt, der mehrfach an der Schwelle zum atomaren Inferno stand. Der Artikel erprobt die Kategorien "Erfahrung" und "Erwartung" für die Analyse internationaler Beziehungen und vermittelt Einsichten, "wie historische Akteure mit Kontingenz umgegangen sind, welche Rolle mögliche Zukünfte für politische Entscheidungen und Handlungen gespielt haben und wie diese Erkenntnisse für eine Geschichtsschreibung der internationalen Beziehungen fruchtbar gemacht werden können." So kann rekonstruiert werden, wie es dem französischen Präsidenten im Lauf des Jahres 1984 gelang, die amerikanische und die sowjetische Führung dazu zu veranlassen, aus der eigenen Perspektivität herauszutreten, indem er die Selbst- und Fremdwahrnehmungen der jeweils anderen Seite und die daraus resultierenden Ängste ansprach. Durch Appell an die Empathie bestärkte er alle Beteiligten darin, die Bedrohungsperzeptionen der anderen Seite ernst zu nehmen und schuf dadurch eine "Empathie zweiter Ordnung" als Voraussetzung für die Wiederaufnahme von Abrüstungsgesprächen ab Mitte der 1980er Jahre. Sabrina Schmitz-Zerres widmet sich in ihrem Beitrag den "Zukunftsnarrationen" in deutschen Geschichtsschulbüchern in den 1950er und 1960er Jahren. Es handelt sich dabei um Erzählungen, in denen von den Autoren der Lehrbücher - in der Regel am Ende des letzten Bandes - ein erzählerischer Ausblick in die Zukunft gegeben wird. Diese Texte sind in der umfangreichen Forschung über Schulbücher bislang unberücksichtigt geblieben. Zu Unrecht, wie Schmitz-Zerres überzeugend herausarbeitet. Die Zukunftserzählungen tragen nämlich dazu bei, die Orientierungsfunktion von geschichtlichem Lernen in der Schule zu begründen. Sie bilden den Abschluss einer spezifischen Sinnfigur, die für Geschichtsschulbücher geradezu konstitutiv ist: die Verbindung von Gegenwartserfahrung, Vergangenheitsdeutung und Zukunftsgestaltung. Der Geschichtsunterricht scheint bei der Formung dieser Verbindung auf eine erzieherische Perspektive ausgerichtet zu sein, welche die Kontingenz der Zukunft bändigen soll, statt ihre grundsätzliche Janusköpfigkeit zu zeigen. Das ist nach Schmitz-Zerres der Kern einer von ihr so bezeichneten "Gattungslogik" des Genres. Alle an der Entstehung von Schulbüchern beteiligten Akteure wissen - zumindest implizit - um diese Gattungslogik, weshalb Geschichtsschulbücher eher ein "Lernen aus der Geschichte" (historia magistra vitae) vermitteln wollen, statt historische Erzählungen und Deutungen selbst einer Analyse zugänglich zu machen, wie es die Didaktik der Geschichte seit Jahrzehnten fordert. Holger Thünemann fragt nach der Umsetzung dieser erzählerischen Sinnfigur in anderen Epochen der Schulbuchgeschichte, indem er Aspekte der historischen Schulbuchforschung mit zentralen Begriffen des Graduiertenkollegs "Vorsorge, Voraussicht, Vorhersage" verbindet. Die geschichtsdidaktische Theoriebildung erweise sich mit ihrem Konzept des "Geschichtsbewusstseins in der Gesellschaft" bei dieser Verbindung als anschlussfähig, wie auf der anderen Seite zentrale Kategorien des Graduiertenkollegs wie "Möglichkeitshorizonte", "Kontingenzbewältigung" oder "Zukunftshandeln" geeignet seien, der historischen Schulbuchforschung neue Impulse im Hinblick auf die in den Schulbüchern realisierten Zukunftsentwürfe zu verleihen. So erkennt Thünemann in Schulbüchern eine grundsätzliche Tendenz, bereits vergangene Kontingenz zu reduzieren, um daraus eine Zukunft zu entwerfen, die dann ebenfalls über eine Normierung und Minimierung von Möglichkeitshorizonten weitgehend kontingenzfrei konstruiert wird. ? Diese Konstruktion verlaufe in Abhängigkeit zu dominanten gesellschaftlichen Diskursen im jeweiligen historischen Kontext. Zur Stützung dieser These stellt er vier Beispiele aus unterschiedlichen Epochen der deutschen Geschichte vor, die er in "typologisierender Absicht mit den Begriffen Gegenwartsobsession, Vergangenheitsfixierung, hypertrophe Zukunftseuphorie sowie Gegenwarts- und Zukunftsvergessenheit" kennzeichnet.
| Erscheinungsdatum | 07.04.2018 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Kontingenzgeschichten ; 4 |
| Co-Autor | Arno Barth, Stefan Brakensiek, Dennis Gschaider, Jasmin Hettinger, Anja Hoppe, Christian Kehrt, Franziska Klein, Christoph Marx, Christian Meier, Stefanie Rüther, Benjamin Scheller, Barbara Schlieben, Sabrina Schmitz-Zerres, Frederike Schotters, Holger Thünemann, Jan Timmer, Andrew van Ross |
| Verlagsort | Frankfurt |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 143 x 215 mm |
| Gewicht | 462 g |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Allgemeines / Lexika |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Geschichtstheorie / Historik | |
| Schlagworte | Chance • Geschichte • Geschichte / Theorie u. Methoden • Handlungsforschung • Risiko • Versicherung • Vorhersehen • Vorsorge • Zukunft |
| ISBN-10 | 3-593-50807-9 / 3593508079 |
| ISBN-13 | 978-3-593-50807-8 / 9783593508078 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich