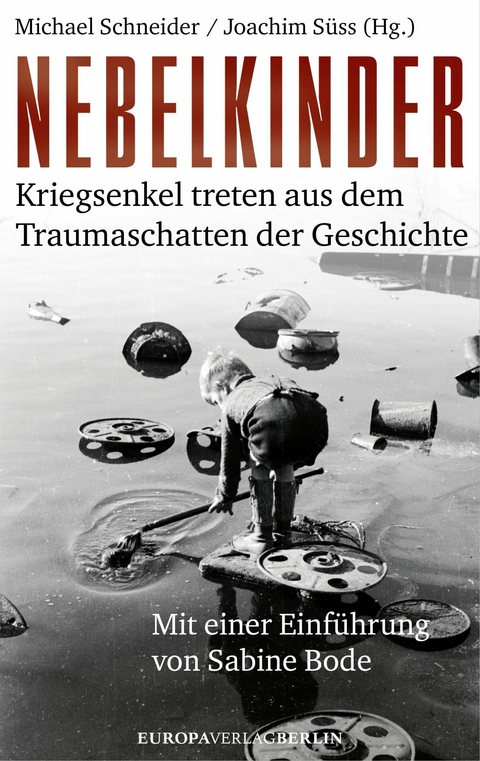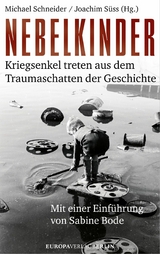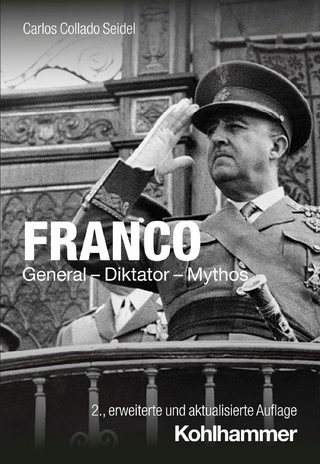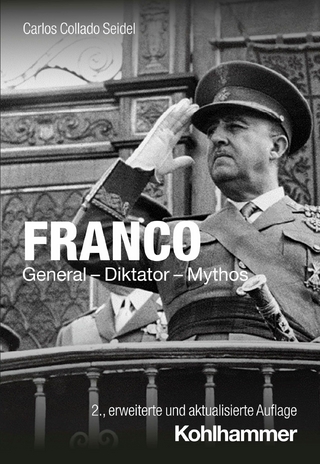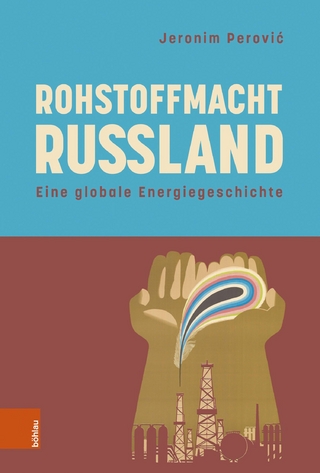Nebelkinder (eBook)
385 Seiten
Europa Verlag GmbH & Co. KG
978-3-944305-92-9 (ISBN)
Joachim Süss, Jahrgang 1961, Studium der Theologie und Religionsgeschichte, 1994 Promotion, arbeitete bis 2007 als Referent im Thüringer Kultusministerium, ist heute als Autor, Herausgeber und Seminarleiter tätig. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins Kriegsenkel e.V. und hat zahlreiche Bücher und Beiträge veröffentlicht, u.a. Vertreibung - Verständigung - Versöhnung (2011). Michael Schneider, geboren 1960, studierte Theologie, Philosophie und Architektur. Bis 2013 war er Leiter der Akademie Sandkrughof in Lauenburg und siedelte dort zahlreiche Angebote im Themenkomplex Kriegskinder/Kriegsenkel an. Er ist Mitbegründer des Vereins Kriegsenkel e.V., dessen Vorstand er angehört.
Joachim Süss, Jahrgang 1961, Studium der Theologie und Religionsgeschichte, 1994 Promotion, arbeitete bis 2007 als Referent im Thüringer Kultusministerium, ist heute als Autor, Herausgeber und Seminarleiter tätig. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins Kriegsenkel e.V. und hat zahlreiche Bücher und Beiträge veröffentlicht, u.a. Vertreibung – Verständigung – Versöhnung (2011). Michael Schneider, geboren 1960, studierte Theologie, Philosophie und Architektur. Bis 2013 war er Leiter der Akademie Sandkrughof in Lauenburg und siedelte dort zahlreiche Angebote im Themenkomplex Kriegskinder/Kriegsenkel an. Er ist Mitbegründer des Vereins Kriegsenkel e.V., dessen Vorstand er angehört.
EINFÜHRUNG VON SABINE BODE
Mitte der 1990er-Jahre begann ich der Frage nachzugehen: Wie geht es eigentlich den deutschen Kriegskindern heute? Von Anfang an bezogen sich meine journalistischen Recherchen nicht nur auf die entsprechenden Jahrgänge von 1930 bis 1945 – es interessierte mich auch die spätere Generation. Ich wurde hellhörig, wenn mir damals 20- bis 35-Jährige von schlechten Beziehungen zu Mutter und Vater erzählten, meistens mit dem Zusatz: »Meine Eltern wissen gar nicht, wer ich bin.« Die Kinder hatten eine weit bessere Ausbildung als ihre Eltern erhalten und waren sozial aufgestiegen. Hier in einer kulturellen Entfremdung die Ursache zu suchen, erschien naheliegend. Doch ein einleuchtender Grund für schlechte Beziehungen ist das nicht. Die meisten Klagen, die ich über Eltern hörte, bezogen sich auf unbegreifliches Verhalten, verbohrte Sichtweisen, auf ein extremes Sicherheitsbedürfnis und ein gänzliches Desinteresse an irgendeinem neuen Thema.
Fragte ich dann nach der Kindheit der Eltern, erfuhr ich zu 80 Prozent von gravierenden Dramen: Da hatte ein Vater mit sieben Jahren die Zerstörung Kassels erlebt, eine Mutter war als Zwölfjährige mit ihrer Familie aus Ostpreußen geflohen. Dafür fanden die eine Generation Jüngeren bloß wenige, nüchterne Worte. Es deckte sich mit der Art und Weise, wie ich Kriegskinder über ihre frühen Schrecken hatte reden hören: unerschüttert, fast gefühlsfrei, jedenfalls in keiner Weise larmoyant. Dazu der Satz: »Das war für uns normal, so was hat man eben weggesteckt.«
Wenn ich damals einem Menschen, der sich heute womöglich Kriegsenkel nennt, zu bedenken gab: »Vielleicht sind Ihre Eltern deshalb so, wie sie sind, weil sie als Kinder Schreckliches erlebt haben«, herrschte eine Weile Schweigen. Dann folgte der Satz, der in allen Gesprächen wortgleich auftauchte: »Darüber habe ich noch nie in meinem Leben nachgedacht.« – Und dabei blieb es. Es wurde nicht weiter darüber nachgedacht.
Seitdem sind 20 Jahre vergangen, und in Deutschland ist ein Phänomen festzustellen, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, das Phänomen der Kriegsenkel-Gruppen, eine Basisbewegung. In manchen Großstädten, vor allem auch in Berlin, sind die Kriegsenkel und was sie so alles auf der Suche nach ihren Wurzeln erleben, Partythema. Wer mehr darüber wissen möchte, wird in dieser Anthologie viel Nachdenkenswertes finden. In den Beiträgen der Nebelkinder spiegelt sich, dass der Satz »Meine Eltern wissen gar nicht, wer ich bin« unbedingt einer Ergänzung bedurfte im Sinne von: »Hätten mich meine Eltern damals gefragt: Ja, wer bist du denn? Hätte ich überhaupt keine Antwort gewusst.« Und der eingangs zitierte Kriegsenkel würde vermutlich einräumen: »Lange Zeit war ich mir selbst ein Rätsel, weil ich mich nie weder emotional noch faktisch mit meiner Familienvergangenheit auseinandergesetzt habe.«
Als ich Mitte der 1990er-Jahre begann, Angehörige der Kriegskinder-Generation zu ihrem Schicksal zu befragen, weil ich wissen wollte, wie sich frühe Erfahrungen mit Leid, Bedrohung, Gewalt, Bomben, Heimatverlust, Hunger und Tod in der Familie im Erwachsenenleben ausgewirkt haben, wurde mein Interesse überwiegend als befremdlich bis zudringlich empfun den. An Kriegserinnerungen war noch heranzukommen, aber das Nachdenken über mögliche seelische Kriegsfolgen wurde durchweg abgewehrt. Auch in meinem Umfeld wurde mit Unverständnis reagiert. Zwar war man sich einig, dass auch viele Deutsche Schreckliches erlebt hatten, doch wollte man dem kein öffentliches Gewicht geben, weil man den Vorwurf befürchtete, hier solle deutsches Leid gegen das der vielen Millionen Opfer des Holocaust und eines Vernichtungskrieges aufgerechnet und damit die deutsche Schuld relativiert werden.
In dieser Zeit kannte ich nicht mehr als fünf Personen, denen meine Recherchen zu traumatisierten Deutschen nicht abwegig, sondern gesellschaftlich wichtig erschienen. Wir überlegten, ob die Kriegskinder jemals ihr Schweigen brechen oder ihre Erinnerungen mit ins Grab nehmen würden. Doch hielten wir es für wahrscheinlicher, dass dann, wenn die Mehrheit dieser Jahrgänge die Rentnerphase erreicht hätte, die Kindheit wieder näher rücken würde. Und dann, stellten wir uns vor, wären auch Reflexionen über die Langzeitfolgen möglich. Genau so ist es schließlich auch gekommen.
Gewiss ist es nach wie vor eine Minderheit, die sich einer solchen Lebensbilanz unterzieht. Aber sie scheut sich nicht, darüber zu sprechen, auch öffentlich. Das Schicksal der Kriegskinder wird heute gesehen und ernst genommen.
Als mein Buch Die vergessene Generation 2004 erschien, waren die Spätfolgen in der Gruppe der Kriegskinder noch nicht erforscht. Der Begriff »Trauma« wurde im Wesentlichen im Zusammenhang mit den Opfern des Nationalsozialismus genannt. Ein öffentliches Interesse am Thema »deutsche Kriegskinder« existierte nicht. Es erwachte erst im April 2005, ausgelöst durch den ersten großen Kriegskinder-Kongress in Frankfurt am Main, zu dem sich 600 Teilnehmer anmeldeten. Hatten sich die Medien bis dahin überwiegend auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus konzentriert, wurden nun dem The menkomplex »deutsche Vergangenheit« die Schrecken von Bombenkrieg und Vertreibung aus Kindersicht hinzugefügt.
An Zeitzeugen herrschte kein Mangel. Jahrzehntelang hatten die Kriegskinder ihre frühen Traumatisierungen verdrängt oder bewusst auf Abstand gehalten, doch nun war die Zeit reif, Worte für Erlebnisse zu finden, die bis dahin unaussprechbar gewesen waren. Was dabei sichtbar wurde: Natürlich weisen die Lebensbedingungen riesige Unterschiede auf, jedes Kriegskind hat seine unverwechselbare Erfahrungsgeschichte. Doch gleichzeitig zeigte sich überdeutlich: Ohne Zweifel haben Kriegsgewalt und abwesende Väter, Heimatverlust und große Entbehrungen sowie das Aufwachsen mit Eltern, die glühende Nationalsozialisten oder Feinde des Regimes waren, im späteren Leben Folgen – auch dann, wenn die Betroffenen nicht wahrnehmen, wodurch sie untergründig gesteuert werden.
Erst jetzt, im Alter, werden sich viele Menschen dessen bewusst und fangen an, sich Fragen zu stellen. Häufig setzen sie sich damit auseinander, indem sie ihre Kindheitserinnerungen aufschreiben. Unzählige ältere Menschen waren oder sind derzeit damit beschäftigt. Viele ihrer Generation haben das Gefühl, sie müssen es tun, denn im Alter fällt das Verdrängen immer schwerer.
Es gab also eine Zeit in Deutschland – die erst vor zehn Jahren zu Ende ging –, in der die Angehörigen der Kriegskinder-Jahrgänge keineswegs der Meinung waren, sie hätten als Generation ein bemerkenswertes gemeinsames Schicksal, und sie bekräftigten dies mit der Aussage: »Die Eltern, ja, die hatten Schlimmes hinter sich. Aber wir doch nicht! Wir waren Kinder! Das war für uns normal, das haben wir doch alle erlebt.«
Nun, so empfinden es Kinder. Da später in der deutschen Gesellschaft diese gefühlte »Normalität« nie als korrekturbedürftig angesehen wurde, blieb sie im Erwachsenenalter über viele Jahrzehnte bestimmend. Das wirklich Neue am Thema Kriegskinder sind ja nicht die Schrecken des Krieges. Es ist bekannt, dass Kinder, Alte und Kranke am stärksten unter kollektiver Gewalt leiden. Das Neue ist: Hier handelt es sich um eine große Gruppe von Menschen, die in der Kindheit verheerende Erfahrungen machten, aber ihr ganzes Leben in der Mehrzahl eben nicht das Gefühl hatten, etwas besonders Schlimmes erlebt zu haben. Denn es fehlte ihnen der emotionale Zugang zu diesen Erfahrungen und damit auch der Zugang zu ihren wichtigsten Prägungen.
Wer dies nicht im Blick hat, versteht nicht den Kern des spezifischen Problems – warum die Kriegskinder, die traumatisiert waren, dies nicht wussten. Litten sie an Depressionen, Ängsten, Panikattacken, fanden sie und ihre Hausärzte dafür keine Erklärung. Wie sollten da ihre Kinder auf die Idee kommen, dass die Eltern sich nicht vom Krieg erholt hatten?
Viele von ihnen haben in der Kindheit überlebt, indem sie sich selbst betäubten. Dabei halfen Sätze wie: »Indianerherz kennt keinen Schmerz«, »Anderen geht es viel schlimmer!« und die in der Hitlerjugend erworbene Überzeugung, »hart wie Kruppstahl« zu sein.
Die Nachwirkungen von NS-Gewaltherrschaft, Krieg und Vertreibung bei den Kriegskindern sind inzwischen erforscht. Die Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen: 8 bis 10 Prozent der heutigen Rentnerinnen und Rentner haben eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, das heißt, sie sind psychisch krank. (Dazu Vergleichszahlen aus der Schweiz, ein Land ohne Krieg: Hier sind in der entsprechenden Altersgruppe nur 0,7 Prozent betroffen.) Darüber hinaus sind weitere 25 Prozent zwar leichter, aber immer noch erkennbar von den Spätfolgen belastet.
Häufig drückt sich dies in sonderbaren Verhaltensweisen aus, in Vermeidungsstrategien, gespeist aus der Angst vor Veränderungen. Daraus ergibt sich unter anderem ein schlechter Kontakt zu der Welt der Jüngeren. Fast alle Kinder der Kriegskinder, die in meinem Buch Kriegsenkel zu Wort kommen, berichten von einem Mangel an Wärme in ihren Herkunftsfamilien. Der immer wiederkehrende Satz dazu lautet: »Ich kann meine Eltern emotional nicht erreichen.«
Diese Äußerung ist für Mütter oder Väter unverständlich. Hatten sie nicht alles für ihre Kinder getan? War es je einer Generation besser ergangen als jenen Kindern, die in den 1960er- und 1970er-Jahren geboren wurden? Vielen Kriegskindern fällt auf, dass die Generation ihrer Kinder längst nicht so tüchtig und durchsetzungsfähig ist wie ihre eigene Generation. Sie verstehen nicht, wenn bei den...
| Erscheint lt. Verlag | 5.3.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Zeitgeschichte |
| Schlagworte | Deutsche Nachkriegsgeschichte • Nachkriegszeit • transgenerationelles Trauma • Vergessene Generation • Vertreibung |
| ISBN-10 | 3-944305-92-2 / 3944305922 |
| ISBN-13 | 978-3-944305-92-9 / 9783944305929 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Digital Rights Management: ohne DRM
Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich