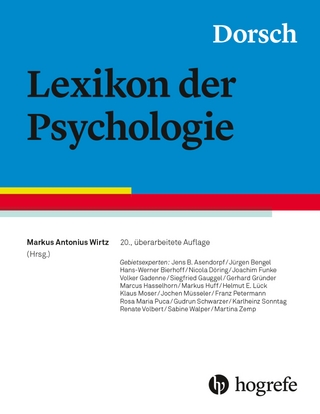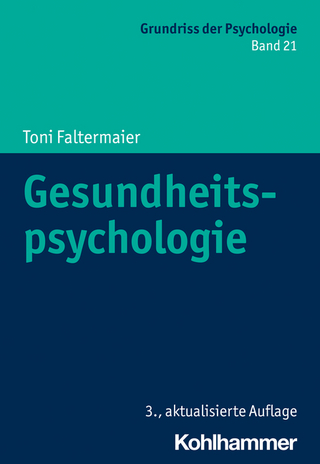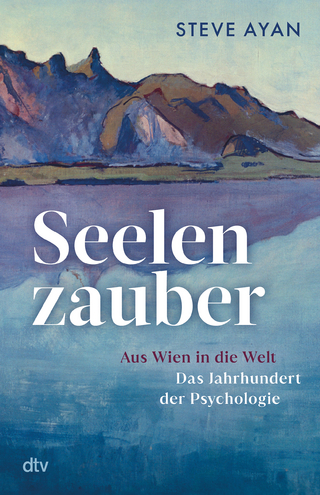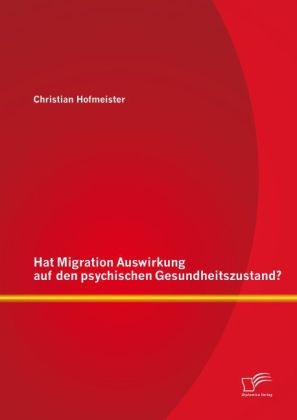
Hat Migration Auswirkung auf den psychischen Gesundheitszustand?
Diplomica (Verlag)
978-3-8428-8015-3 (ISBN)
Nachdem im ersten Teil allgemeine Auskünfte zum Begriff der Migration, zu gegenwärtigen Tendenzen und zu geschichtlichen Aspekten bezüglich des Migrationsgeschehens in Deutschland gegeben werden, wird im zweiten Teil dieser Arbeit geklärt, welche Auswirkungen die Migration auf den Gesundheitszustand insgesamt hat und ob ein Zusammenhang zwischen Migration und psychischer Erkrankung gefunden werden kann. Im dritten Teil werden einzelne psychiatrische Krankheitsbilder beschrieben und auf migrationsspezifische und transkulturelle Aspekte hin untersucht, um im vierten Kapitel Probleme bei der Versorgung von Migranten zu beschreiben und Handlungsansätze für die Arbeit mit den Betroffenen aufzuzeigen. Der Fokus wird dabei auf häufig beschriebene Aspekte der aktuellen Wissenschaft und Praxis gelegt, weshalb bestimmte Migrantengruppen einen höheren Stellenwert in verschiedenen Teilen dieser Arbeit einnehmen.
Textprobe:
Kapitel 3, Psychische Erkrankung und Migration - Darstellung seelischer Erkrankungsbilder - migrationsspezifische Gesichtspunkte und transkulturelle Perspektiven: Es gibt ein sehr unterschiedliches, von der jeweiligen Kultur geprägtes Verständnis von der Entstehung, dem Verlauf und der Heilung einer Krankheit. Gerade auf dem Gebiet der psychischen Störungen sind die Unterschiede groß. (...) Abhängig ist dies immer vom entsprechenden Krankheitsverständnis, welches beispielsweise eher westlich rational geprägt sein kann, basierend auf der Zweiteilung von Körper und Seele, oder der östlichen Mentalität entsprechend eher ganzheitlich geprägt ist oder auf den magischen Vorstellungen vieler Völker, die Götter und Geister für das Verständnis von Krankheiten heranziehen, basiert (Haasen et al. 2005, S. 147). Bei türkischen Klienten, die in Deutschland in einer nicht zu geringen Anzahl aufzufinden sind, ist die Erwartungshaltung an den behandelnden Arzt z.B. eine ganz andere, geprägt von schnellem Erfolg und großem Respekt vor dem Behandler (vgl. Haasen et al. 2005, S. 147).
Auch Ursachen der gleichen Krankheit können, wie eingangs bereits beschrieben, einen kulturellen Hintergrund haben; nicht nur hinsichtlich eines unterschiedlichen Krankheitskonzepts oder gesundheitsschädlicher Verhaltensweisen, sondern auch hinsichtlich verschiedener, kulturell bedingter Gesellschaftsbilder. So ist die Rollenverteilung in einer typisch türkischen Großfamilie eine völlig andere als bei uns, was wiederum ein Grund dafür ist, dass z.B. das Auftreten eines depressiv-phobischen Syndroms unter anderem auf die Einengung der so genannten Sippe zurückgeführt werden kann, wobei bei Deutschen das gleiche Syndrom eher auf emotionale Mangelerlebnisse zurückzuführen ist und somit genau entgegengesetzte Auslösekomponenten vorhanden sind (vgl. Kolcak 1995, S. 315).
Im folgenden Kapitel sollen Symptome verschiedener Krankheitsbilder wie der Depression, posttraumatischer Belastungsstörungen, psychosomatischer Beschwerden, der Sucht und der Schizophrenie dargestellt werden. Zu Beginn eines jeden Abschnitts werde ich jeweils allgemeingülltige Aussagen zur Krankheit machen, um dann migrationsspezifische und. kulturelle Aspekte bzw. Einflüsse darzustellen. Hintergründe einzelner Migrantengruppen, von denen man ausgeht, dass sie besonders häufig betroffen sind, nehmen im jeweiligen Abschnitt einen besonderen Stellenwert ein. Vor allem werden das Arbeitsmigranten im Abschnitt über Psychosomatiken sein, Flüchtlinge im Abschnitt über Posttraumatische Belastungsstörungen und Aussiedler im Abschnitt über Sucht.
3.1, Depressionen: Hauptmerkmal (der Depression) ist die niedergedrückte und pessimistische Grundstimmung mit allgemeiner Lust- und Antriebslosigkeit. Hinzu kommen häufig verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, Schuldgefühle mit unangemessenen Selbstvorwürfen, Hoffnungslosigkeit und körperlichen Beschwerden wie Schlafstörungen, Appetitverminderung, Gewichtabnahme, Verdauungsunregelmäßigkeiten und andere vegetative Symptome. Es besteht eine weitgehende Unfähigkeit, Freunde oder Interesse an normalerweise angenehmen Tätigkeiten und Erlebnissen zu empfinden bzw. darauf angemessen emotional zu reagieren. Das Gefühl der Verzweiflung und Aussichtslosigkeit führt bei schweren depressiven Verstimmungen nicht selten zu einer Suizidgefährdung (Zimmermann 2002, S. 199).
In der Regel werden drei Formen der Depression unterschieden. Neben der psychogenen Form zählt man die exogene als auch die endogene Form hinzu.
Die psychogene Form zeichnet sich dadurch aus, dass die Ursache, oft ein belastendes Erlebnis, für den Beobachter klar erkennbar und nachvollziehbar ist. Mann spricht dann auch von einer reaktiven Depression, die nach einem angemessenen Zeitraum wieder abklingt. Auch die neurotische Form gehört hierzu. Die Psychoanalyse sieht die Ursachen hierfür in einem nicht verarbeiteten frühkindlichen Kon
| Zusatzinfo | m. 16 Abb. |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 156 x 221 mm |
| Gewicht | 159 g |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie ► Allgemeines / Lexika |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Sozialpädagogik | |
| Schlagworte | Gesundheit • Migration • Migration / Migrant • Psychosomatik |
| ISBN-10 | 3-8428-8015-4 / 3842880154 |
| ISBN-13 | 978-3-8428-8015-3 / 9783842880153 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich