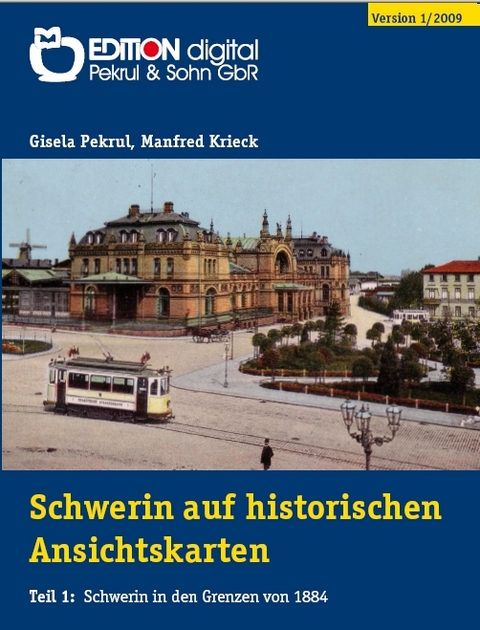
Schwerin auf historischen Ansichtskarten
EDITION digital (Hersteller)
978-3-931646-34-9 (ISBN)
Geschichte der Stadt Schwerin
Merian-Stich
Schwerin um 1700
Schwerin um 1850
Stadtplan von 1884
Wappenkarte von 1905
750-Jahrfeier
Historische Persönlichkeiten
Stadtwappen
Die Altstadt
Der Marktplatz
Markttreiben vor dem Neuen Gebäude, Bismarckdenkmal
Das Haus Am Markt 2
Markttreiben 1911 vor den Häusern 2 und 3
Das Haus Am Markt 4/5 mit Brunnen
Das Haus Am Markt 6
Das Haus Am Markt 7 mit dem Residenzcafé
Das Haus Am Markt 8
Die Häuser Am Markt 9-13 um 1900
Das Rathaus
Das Stadthaus neben dem Rathaus
Der Ratskeller
Festumzug zur 750-Jahrfeier vor dem Rathaus
Straßenbahn vor dem Rathaus
Der Dom vor dem Turmbau
Dom von Süden 1899
Das Innere des Doms
Grabstätten
Glocken
Kreuzgang am Dom
Marinetag in Schwerin 1933
Straßenbahn in der Puschkinstraße
Café Prag
Schlachterstraße und Schlachtermarkt
Café Wallhof
Hotel de Paris
Blick in die Schusterstraße und zum Hotel Fürst Bismarck
Weinhaus Uhle
Buschstraße
Weinhandlung Michaelis
Enge Straße
Schmiedestraße
Kaufhaus Karstadt
Das Kunstgewerbehaus
Seifenfabrik Brunnengräber
Großer Moor 38
Großer Moor 30
Großer Moor 1
Gaststätte Gartenlaube
Salzstraße
Baderstraße
Scheels Säle
Scheithers Säle
Werderstraße (Annastraße)
Schlossstraße
Altes Palais und Schlossstraße
Das Regierungsgebäude 1905
Der Nordische Hof
Blick auf die Graf-Schack-Allee
Rokoko-Haus
Katholische Kirche
Gasthof "Deutscher Kaiser"
Graf-Schack-Allee
Das Archivgebäude
Das Kaiserliche Postamt 1899
Die Mecklenburgstraße
Drogerie Lüss und Behrmann 1906
Vor dem Straßenbahnbau
Straßenbahn fährt zum Pfaffenteich
Sterns Hotel
Martinstraße
Helenenstraße
Marienplatz
Vor dem Straßenbahnbau
Stadthallen
Konzerthaus Flora
Faun-Künstlerspiele
Sparkasse und Kino
Lübecker Straße
Hotel Stadt Hamburg
Hotel Stadt Lübeck
Turnhalle des Männerturnvereins
Wismarsche Straße
Tonhalle
Restaurant "Stadtkrug"
Sparbank
Riecks Hotel
Hotel "Schweriner Hof"
Hamanns Gasthof
Restaurant Küchenmeister
Geschwister-Scholl-Straße
Thalia
Heinrich-Mann-Straße
Lobedanzgang
Lyzeum
Der Pfaffenteich
Arsenalstraße
Blick zum Demmlerhaus
Einzug der Königin Wilhelmina und des Prinzen Heinrich
Hensesche höhere Mädchenschule und Seminar
Friedrichstraße um 1910
Die Schelfstadt
Puschkinstraße
Das Weinhaus Wöhler
Werderstraße
Das Stadtkrankenhaus
Das Geschäft Wiese in der Werderstraße 41
Die Kaserne des Großherzoglich-Mecklenburgischen Grenadierregiments
Bornhövedstraße
Möbeltransport Heuck
Schelfmarkt
Das Haus Schelfmarkt 1
Das Neustädtische Rathaus
Schelfkirche
Schelfstraße
Blick zur ehemaligen Justizkanzlei
Lindenstraße
Ersparnisanstalt
Basedowsche Privat-Mädchenschule
Ziegenmarkt
Röntgenstraße
Marienkrankenhaus
Städtisches Brauhaus
Gaußstraße
Körnerstraße
Alexandraheim
Stephanus-Stift
Pfaffenstraße mit Casino
August-Bebel-Straße
Eislauf auf dem Pfaffenteich
Kücken-Stiftung
Gymnasium Fridericianum
Schliemann-Denkmal und Perzina-Haus 1935
Spieltordamm
Partie am Spieltordamm
Das Elektrizitätswerk
Die Paulsstadt
Alexandrinenstraße
Alexandrinenstraße 24
Alexandrinenstraße 33
Arsenal
Erinnerung an den Kaiserbesuch
Arsenal am 21.3.1933
Niederländischer Hof
Moritz-Wiggers-Straße
Zum Bahnhof
Hotel Niendorff
Ehemalige Augustenstraße
Hauptbahnhof und Grunthalplatz
Reisende im Bahnhofsrestaurant
Eingang zum Fürstenzimmer
Droschken
Straßenbahn vor dem Bahnhof
Im Hintergrund die Bischofswindmühle
Mit Eisenbahndirektionsgebäude
Einzug des Königspaares der Niederlande
Die Bahnsteige
Großherzogliches Eisenbahn-General-Direktionsgebäude
Im Mitropa-Speisewagen
Fahrt zum Kriegsschauplatz
Blick auf den Demmlerbau
Hotel Louisenhof
Bahnhofshotel
Hotel de Russie
Hotel Reichshof
Die Löwenapotheke
Die Bischofsmühle am Aubach
Platz der Freiheit
Franz-Mehring-Straße
Das Innere der Paulskirche
Zeppelinankunft, von der Paulskirche gesehen
Friedensstraße um 1900
Großherzogliches Realgymnasium
Wittenburger Straße
Restaurant Lüth
Junkers Restaurant
Voßstraße
Fritz-Reuter-Straße
Die Feldstadt
Goethestraße
Dampfmühle Linow
Drogerie Studier
Feltmanns Bierhalle
Delikatessenhandlung Friedrich Behncke
Platz der Jugend
Ansicht mit dem Anna-Hospital
Berliner Tor mit Straßenbahn
Das Stadtarchiv
Wallstraße
Stiftstraße
Brunnenstraße
Brunnenkrug
Schlachthausrestaurant
Hermannstraße
Ostorfer Ufer
Die Artilleriekaserne
1916: Straßenbahn und Pferdewagen
Artilleriekaserne 1940
Neue Artilleriekaserne um 1900
Die Offiziersmesse
Unteroffiziere des 89. Infanterieregiments
Das Wandschneider-Museum in Plau
Literaturverzeichnis
Nachdem im Jahre 1870 der Oldenburger Hofbuchdrucker August Schwarz die erste "Correspondenz-Karte" herausgegeben hatte, gab es sehr bald ein großes Interesse an diesen Ansichtskarten. Zum Glück entwickelte sich gleichzeitig eine Sammlerleidenschaft, die uns die Karten über mehr als hundert Jahre, oft sogar in einem sehr guten Zustand, erhalten hat. Die vorliegende Publikation zeigt, dass Ansichtskarten sehr bald zu bedeutenden und weniger bedeutenden Häusern, Straßen und Plätzen herausgegeben wurden. Das trifft auch auf politische Ereignisse der jeweiligen Zeit zu. Foto-Ansichtskarten wurden ebenfalls sehr schnell beliebt. Man fotografierte z.B. sein Haus, die Familie, die Hochzeitsgesellschaft, die Schulklasse oder ließ sie fotografieren. Wenn auf die Rückseite das Adressfeld gedruckt wurde, war sofort eine neue Ansichtskarte geboren. Diese "Bilder" sind besonders interessant, wenn sie tatsächlich als Karte versandt wurden und im Text auf das Ereignis auf der Vorderseite Bezug genommen wurde. Die Publikation enthält eine weitere Abwandlung der Ansichtskarte, indem eine Rechnung als Karte versandt wurde. Ansichtskarten wurden nicht nur wegen der interessanten Bilder so beliebt. Sie boten auch eine sehr praktische Möglichkeit, in Kurzform wichtige Mitteilungen, Grüße und Glückwünsche zu verschicken oder nur einfach ein Lebenszeichen zu geben. Nach teilweise mehr als hundert Jahren sind diese Mitteilungen von historischem Interesse, ganz besonders die aus dem 1. und 2. Weltkrieg. In diese Zeit fallen dann auch postalische Vermerke, mit denen die Karten zurück zum Absender gingen, wie "Gefallen auf dem Feld der Ehre". Auch ein Blick auf die Höhe des Portos, das in der Inflationszeit rasant anstieg, spiegelt ein Stück Zeitgeschichte wider. Nachdem wir voller Begeisterung den immensen Fundus an Ansichtskarten sichteten, stellten wir fest, dass sich große Teile der Geschichte Schwerins an Hand dieser Karten beschreiben lassen. Wenn wir wichtige Stätten oder Ereignisse ausgelassen haben, so stand uns hierfür keine mindestens 50 Jahre alte Karte zur Verfügung. Andererseits sind andere Häuser, wie z.B. Gaststätten und Hotels, überpräsentiert, weil es hierfür interessante postalische Belege gab. Bis auf ganz wenig Ausnahmen haben wir versucht, die Wertung der Ereignisse dem Leser zu überlassen. Wir haben auch Karten aus der Zeit des Faschismus aufgenommen, legen sie doch Zeugnis davon ab, dass Schwerin von diesen Ereignissen nicht verschont blieb. Schwerin in den Grenzen von 1884 bezieht sich nicht auf ein wichtiges Ereignis in der Stadtgeschichte, sondern das Jahr 1884 wurde aus praktischen Erwägungen heraus gewählt. Im Internet haben wir von einem Sammler aus den USA einen interessanten Stadtplan von 1884 erworben. Er ist in dieser Publikation unser Bezugspunkt. Deshalb enthält sie nur die Schweriner Altstadt, Schelfstadt, Paulsstadt und Feldstadt, alles andere ist Teil einer späteren Publikation. Karten vom Schloss mit dem Burg- und Schlossgarten, vom Alten Garten und dem Marstall sowie Karten mit den Fotos der Herzöge und Großherzöge sollen ebenfalls in einem anderen Teil veröffentlicht werden. Die Publikation bezieht sich zwar auf die Grenzen von 1884, hat aber in diesem Gebiet später entstandene Straßenzüge und Häuser mit aufgenommen. Die Trennung zwischen den vier Stadtteilen wurde bei Straßen, die durch mehrere Stadtteile gehen, nicht immer vorgenommen. Straßen, die über diese vier Stadtteile hinausgehen, wie z.B. die Wismarsche und die Lübecker Straße, wurden nur bis zu den Grenzen von 1884 beschrieben. Die Straßennamen haben in der Geschichte der Stadt mehrmals gewechselt, so dass es Karten zu dem gleichen Objekt mit bis zu drei verschiedenen Straßennamen gibt. Um die Leser nicht zu sehr zu verwirren, haben wir im Text immer den 2009 gültigen Straßennamen verwendet, nach Möglichkeit auch die aktuelle Hausnummer. In der Beschreibung zur Straße finden Sie alle in der Geschichte verwendeten Namen, meist auch mit der Erklärung der Herkunft dieses Namens. Die Autoren haben gemeinsam mit den beiden Hobbyfotografen versucht, den Standort der historischen Ansichten durch aktuelle Fotos zu beschreiben. Nicht immer konnte die ursprüngliche Perspektive verwendet werden. Das liegt daran, dass Gebäude vorgebaut wurden oder der Standort des früheren Fotografen nicht eingenommen werden konnte. In den meisten Fällen konnten die Autoren nicht feststellen, wann das Foto für die Ansichtskarte erstellt wurde. Deshalb wird bei gelaufenen Ansichtskarten von dem Datum des Poststempels ausgegangen. Die sachlichen Texte wurden teilweise in der Rubrik "Wissenswertes" durch Sagen aus den Büchern von Erika und Jürgen Borchardt, aber auch durch Anekdoten aus dem eigenen Erleben ergänzt. Der Verlag und die Autoren freuen sich über weitere Hinweise für diese Rubrik, um sie in einer späteren Auflage zu veröffentlichen. Damit Sie viel Freude an dieser CD-ROM haben, wurden die Informationen durch einige interessante Funktionen ergänzt. Über den Link "Stadtplan" können Sie zu jedem Bild die Karte von 1884 aufrufen, wobei der jeweilige Standort andersfarbig markiert ist. Wählen Sie Bilder aus der CD aus und erstellen Sie sich hiermit Ihren eigenen Kalender, in den Sie Geburtstage und andere wichtige Ereignisse eintragen. Sie können auch eine Karte mit Ihren Grüßen versehen und per E-Mail verschicken. Alle Bilder können vergrößert dargestellt werden. Bilder und Texte können kopiert, gespeichert und gedruckt werden. Für kommerzielle und öffentliche Nutzung sowie für elektronische Medien beachten Sie bitte die Lizenzbedingungen. Sie können auch vergrößerte Fotos der für Sie besonders interessanten Karten erwerben. Schließlich sind auch Updates dieser CD geplant, die Sie ebenfalls über das Internet kaufen können. Uns hat das Aufspüren der Geschichte Schwerins an Hand von alten Ansichtskarten sehr viel Freude bereitet und wir wünschen Ihnen beim Blättern durch den großen Fundus dieser CD-ROM und beim Ausprobieren der interessanten Zusatzfunktionen ebenfalls viel Spaß.
Werderstraße Die Werderstraße wurde in Etappen gebaut, der äußere Teil ist der älteste. Die Werderstraße begann bis 1912 an der Amtstraße und führte von da nach Norden. Zum ersten Mal taucht diese Straße, als geplant gekennzeichnet, in einem Bebauungsplan von 1747 auf. Lediglich ein unbefestigter Feldweg, der vom "Alt Ziegell-Hauß" und zum Hirtenhaus führte, verlief ein Stück ungefähr in Richtung der späteren Werderstraße. Die Häuser selbst lagen weit östlich der geplanten Trasse. Nur ein Haus stieß mit der Schmalseite an die Werderstraße, die Front lag zur Amtstraße. Sonst gab es nichts als Acker, im Plan stand "überhaupt das Schelff Feldt". Eine Karte von 1766 zeigt noch nichts von der geplanten Straße, erst aus dem Jahre 1772 gibt es eine unklare Notiz, die wohl auf den Baubeginn verweist. Aus einer normalen Straße wurde nun eine in den Schelfwerder führende Promenade, auf beiden Seiten mit Bäumen bepflanzt. Um diesen Charakter zu wahren, - und wohl auch wegen des zu leichten Unterbaus – war das Befahren mit Lastfuhrwerken verboten. Offenbar schwebte der Regierung so etwas vor wie ein Korso der vornehmen Welt vor; denn bis 1825 war die Straße selbst für Fußgänger gesperrt. Zugelassen waren nur Reiter und Kutschen. Der gesamte Straßenzug von der Amtstraße bis zum Beginn des Waldes, also auch Teile der heutigen Güstrower Straße, hieß von 1772 bis 1840 Werderallee. Eine Neubepflanzung erfolgte 1816, 1825 wurden Fußgänger zugelassen. Wegen der stillen und abseits gelegenen Lage wurde an der damaligen Werderallee in den Jahren 1839 bis 1840 das Städtische Kranken- und Seuchenhaus errichtet, der ältere Teil des späteren Krankenhauses. Allerdings ging es mit der Ruhe bald zu Ende, als 1840 die Arbeiten zur Schüttung des Paulsdammes begannen. Die Werderallee wurde in Werderstraße umbenannt und nach der Pflasterung und dem Entfernen eines Teils der Bäume für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Schon vorher wurden einige Häuser an der Allee gebaut, 1799 waren es 10 Häuser. In ihnen wohnten trotz des betont "vornehmen" Charakters der Allee meist nur "kleine Leute". Nach der Freigabe der Werderstraße für den allgemeinen Verkehr nahm die Bebauung sprunghaft zu. 1856 waren es bereits 49 Häuser, viele davon mit fünf und mehr Haushalten, also Mietwohnungen für die ärmeren Schichten. 1858 unterbreitete Demmler den Vorschlag, die Werderstraße bis zum Alten Garten zu verlängern. Der Magistrat lehnte ab, weil bei sehr hohen Kosten wenig Nutzen zu erwarten war. Immer wieder wurde dieser Plan aufgegriffen, bis der Magistrat 1890 zustimmte. Nun lehnte die Regierung ab, weil es genügend und bessere Bauplätze gäbe. 1864 wurde der Teil vom Alten Garten zum Marstall ausgebaut und Annastraße genannt. Das geschah aber nicht im Zusammenhang mit der Verlängerung der Werderstraße, sondern diente nur der besseren Verbindung zwischen Schloss und Marstall. In der Zeit von 1908 bis 1912 führte man die Werderstraße doch bis an die Annastraße heran. Das hing wahrscheinlich mit dem Bau der Werderkaserne in der Zeit von 1901 bis 1904 zusammen. Im Bereich zwischen dem Alten Garten und dem Marstall findet man vor allem meist nur von einer Familie bewohnte Villen, während im nördlichen Teil vorwiegend Mietskasernen stehen. 1913 standen neun Häuser im Südteil. Unter den 11 Familien waren drei Excellenzen, nur zwei Familien waren nicht adlig. Die Bebauung des Mittelteils, der den Namen Alexandrastraße bekam, ging nur langsam voran. 1920 standen erst drei Häuser, 1930 waren es acht. Es gab hier auch eine Autoreparaturwerkstatt, eine kleine Bootsbauerei mit Verleih und eine Kohlenhandlung. Die Verbindung vom Alten Garten bis zum Güstrower Tor im Norden hieß von 1939 bis 1945 Graf-Heinrich-Straße, ab 1945 Werderstraße. Auf Grund der Entstehungsgeschichte beginnt die Nummerierung im Norden und endet am Alten Garten. Die Werderstraße gehört zur Altstadt, zur Schelfstadt und zur Werdervorstadt. Der Bereich der Altstadt endet etwa am Marstall. Die bedeutendsten Gebäude an dieser Straße sind der Marstall und das Krankenhaus, beide nach Entwürfen von Demmler Hier eine Auswahl der Gewerbe und Geschäfte in dieser Straße. Ungerade Hausnummern (rechte Seite ab Güstrower Tor) Nr. 3: 1949: Einwohnermeldeamt, Schutzpolizei, Industriegewerkschaft Eisenbahn, Gaststätte "Zur Werderecke" (Inhaber Wilhelm Lettow) Nr. 33: 1949: Lebensmittelhandlung von Otto Trost Nr. 35: 1949: Glas und Porzellan von Karl Dambeck Nr. 41: 1949: Kolonialwarenhandlung von Elisabeth Auer Nr. 49: 1949: Herren- und Damen-Frisiersalon von Willy Westphal Nr. 73: 1949: Magdalena Wendt, staatlich geprüfte Klavier- und Gesanglehrerin, Gartenbaubetrieb von Robert Wendt, Konsum-Gaststätte Nr. 75: 1949: Milch- und Butterhandlung von Ernst Redding Nr. 79: 1949: Werder-Apotheke Nr. 139: 1949: Industriegewerkschaft Lehrer und Erzieher, Landesfernschule Gerade Hausnummern (linke Seite ab Güstrower Tor) Nr. 4: 1949: A. T. G. Autotransportgemeinschaft Mecklenburg, Vereinigung volkseigener Betriebe Nr. 12: 1949: Bäckerei und Café Otto Fanter Nr. 26: 1949: Konsum-Lebensmittelverkaufsstelle Nr. 28: 1949: Obst-, Gemüse- und Kartoffelhandlung von Fritz Brüggert Nr. 30: 1841: Stadtkrankenhaus Nr. 48: 1949: Lebensmittelhandlung von Otto Garlitz Nr. 50: 1949: Kolonialwarenhandlung von Rudolf Tonagel Nr. 70: 1949: Fahrzeugbau und Reparatur von Heinrich Horstmann Nr. 72: 1949: Segelmacherei und Bootsbau von Hans Oberländer Nr. 74: 1949: Kohlen- und Holzhandlung von Franz Moll Nr. 76: 1949: Konsumgenossenschaft Brennmaterialien Nr. 118/122: 1949: Kraftfahrzeuge von Willi Tietz Nr. 124: 1949: Gaststätte Seglerbootshaus Marstall, FDJ-Sparte Segelsport, Bootsbauerei von R. Horlach
Das Haus „Am Markt 4/5“ mit Brunnen Die Karte von 1910 zeigt die Häuser "Am Markt 3", "Am Markt 4/5" und die Häuser auf der Südseite. Im Erdgeschoss des Hauses 4 ist wieder das Geschäft von H. J. Junge zu sehen, darüber eine Kaffee-Großrösterei. Im Haus 6 gibt es ein Putz- und Modewarengeschäft. Sehr schön kommt der Marktbrunnen "Rettung in Seenot" zur Geltung. Der Jugendstilbrunnen mit Bronzeplastiken von Hugo Berwald wurde 1911 aufgestellt und aus Platzmangel 1927 zum Bahnhofsvorplatz verlagert. Den Brunnen stiftete die Witwe des Zigarrenhändlers Mühlenbruch, die Kommerzienrätin Emma Mühlenbruch, der Stadt. Zu sehen sind Wasser speiende Seelöwen, ein Felsen sowie ein Bootswrack, und hoch oben hält ein Jüngling ein Mädchen im Arm, gerettet aus dem Wasser. Bei der feierlichen Einweihung soll die Witwe Mühlenbruch entsetzt gerufen haben: "Dat Wiew is ja ganz naakt, un he hett sei mi mit'n Sleier wiest! Nee, sowat!" Die Karte ist nicht gelaufen. Sie wurde um 1910 gedruckt. Man erzählt sich folgende Anekdote: Bei der Enthüllung des Brunnens soll Frau Mühlenbruch in Ohnmacht gefallen sein. Vor Entrüstung über die Sittenlosigkeit des Künstlers: Waren da doch ein nackter Jüngling und ein nacktes Mädchen zu sehen, vor aller Augen! Die Anekdote ist nicht verbürgt, wohl aber der Protest der Frau in einer Zeitung. Sie habe beim Künstler eine leicht bedeckte Frauengestalt bestellt, und nicht diese frivole Darstellung! Eine andere Zeitung druckte daraufhin ein Gedicht ab (Auszüge): Schäm dich, Schwerin Schäm dich, Schwerin, dass du so tief gesunken! Sonst Tümpel der Kultur – nun in der Mitten Ein nacktes Denkmal! Und die Unken unken, Dass deine Sittlichkeit 'Schiffbruch' erlitten. O Künstler du, von Satans Höllengnaden, Der du die Reinheit von Schwerin befleckt, Warum schufst du so splitternackte Waden, Sie waren doch 'bestellt' auf 'leicht bedeckt'! Nun ist die Keuschheit hin. O lasst mich weinen, Schwerin, du bist um deinen Ruf betrogen! Oder es werden – Trost gibt’s weiter keinen – Dem Denkmal Badehosen angezogen… Aus: "Das sagenhafte Schwerin" von Erika und Jürgen Borchardt
| Erscheint lt. Verlag | 11.6.2009 |
|---|---|
| Verlagsort | Godern |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 135 x 190 mm |
| Gewicht | 92 g |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |
| Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Kulturgeschichte | |
| Schlagworte | Ansichtskarten • Geschichte • Schwerin |
| ISBN-10 | 3-931646-34-3 / 3931646343 |
| ISBN-13 | 978-3-931646-34-9 / 9783931646349 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |